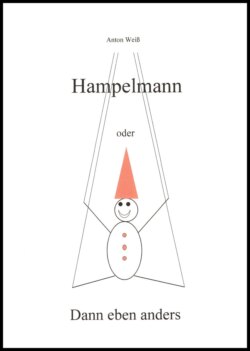Читать книгу Hampelmann - Anton Weiß - Страница 11
7
ОглавлениеIch war vollauf beschäftigt mit Schule, Training und kleineren Turnieren, bei denen ich ein ständiges Auf und Ab erlebte, so dass niemand im Ernst damit rechnete, dass aus mir einmal ein großer Tennisspieler werden würde.
Das war es ja, was mir so zu schaffen machte, dass es bei mir keine Beständigkeit gab, dass nach einigen guten Ballwechseln fast regelmäßig ein Einbruch kam. Ich konnte 40 : 0 in einem Spiel oder 5 : 1 in einem Satz vorausliegen und verlor dann noch das Spiel oder den Satz. Es gab ja auch so viel, was es zu beherrschen galt. Allein den Stoppball zu üben, brachte mich fast zur Verzweiflung. Unterschnitt ich ihn zu sanft, ging er nicht über das Netz, drückte ich ihn mehr nach vorne, ging er zu weit ins Feld, so dass er vom Partner leicht zu erreichen war. Ähnlich war es mit dem Lop; entweder setzte ich ihn zu hoch an, dann ging der Ball ins Aus, hielt ich ihn niedriger, konnte er vom Gegner erreicht werden. Es war zum Verzweifeln, aber es stachelte auch meinen Ehrgeiz an. Ich wollte das alles in den Griff bekommen, es musste doch durch Übung zu erreichen sein, dass solche Abläufe automatisiert wurden. Aufgeben war nicht meine Art und so übte ich immer wieder zäh die gleichen Abläufe. Squash kam mir dabei besonders entgegen, denn da brauchte ich niemanden. Ich konnte stundenlang immer die gleichen Bewegungen üben, ohne dass ich fürchten musste, die Geduld eines Partners zu sehr zu strapazieren. Ich versuchte, den Slice immer auf die gleiche Höhe zu spielen und suchte mir Ziele aus, die ich immer wieder anpeilte. Auch den Top-Spin versuchte ich so zu spielen, dass er immer wieder an die gleiche Stelle zurückkam. Besonders wichtig war mir, dass niemand sehen konnte, wie ich mich verbesserte. Das war mein Traum: Eines Tages auf den Platz zu gehen, als Nobody, und den besten Tennisspieler zu besiegen. Da merkte ich, wie sich der Zwerg so richtig aufpumpte, dass er aufpassen musste, nicht zu zerplatzen.
Als kleiner Junge hatte ich da ein Erlebnis, als ich mit dem Fahrrad freihändig fuhr. Ich war stolz, freihändig fahren zu können und wollte es allen zeigen: „Schaut her, wie toll ich freihändig fahren kann“, schrie es in mir. Aber schnell merkte ich, dass es überhaupt keinen auf der Straße interessierte, dass da ein kleiner Junge auf dem Fahrrad seine Künste zeigte. Da wurde mir schon klar, dass anderen das, was für mich so wichtig und so herzeigenswert war, überhaupt nichts bedeutete. Da begegnete mir zum ersten Mal der Zwerg. Ich hatte immer das Empfinden, dass ich mich zu wichtig nahm und litt darunter. Aber so sehr ich mich auch bemühte, dagegen etwas zu tun – immer wieder ertappte ich mich dabei.
Später beobachtete ich, wie es die anderen hielten. Da erlebte ich, wie Mütter, die kleine Kinder oder gar Babys hatten, über gar nichts anderes mehr sprachen als über ihre Kinder. Die Welt bestand nur aus dem Wohl und Wehe ihres Jüngsten: dass das Baby schon zwei Tage keinen Stuhlgang mehr hatte, wie es gestern so viele Blähungen hatte, dass die Windeln bald zu klein werden und man viel zu viele gekauft hatte, dass man viele Kleidungssachen im Secondhand-Laden kaufe, weil man es ja sonst nicht mehr bezahlen könnte, dass andere gar keine Ahnung davon haben, wie sehr man mit so einem kleinen Knirps rund um die Uhr beschäftigt sei, und so weiter. So langsam begriff ich, dass jeder in seiner Welt lebt, in der er der Mittelpunkt zu sein schien. Für das, was die anderen bewegte, brachten nur die wenigsten echtes Interesse auf. Meistens wartete der eine nur, bis der andere geendet hatte, damit er dann von sich erzählen konnte. Das erlebte ich sehr deutlich bei meiner Mutter; wenn sie mit ihrer Nachbarin auf ihre Krankheiten zu sprechen kam – und das kam es immer, ein anderes Gesprächsthema habe ich kaum je erlebt – dann konnte es keine von beiden erwarten, bis die andere geendet hatte, um sofort von ihren Krankheiten zu berichten. Da erlebte ich den Zwerg bei anderen und nahm mir vor, es anders zu machen.
Ich selbst hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich entdeckte, dass ich mich in den Mittelpunkt gestellt hatte; das war wohl auch der Hintergrund des Leeregefühls nach guten Gesprächen. Wenn es mir einmal gelang, in einem Gespräch die Rede auf Dinge zu lenken, die mich interessierten und ich ins Reden kam und von meinen eigenen Gedanken überrascht und überwältigt war, fühlte ich mich zu Hause immer wie ausgebrannt, wie wenn ich Geld ausgegeben hätte, das mir nicht gehörte.
Dennoch versuchte ich auch, den anderen zuzuhören und auf das einzugehen, was sie bewegte. Ich war ein religiöser Mensch und bemüht, das was Jesus sagt, in meinem Leben umzusetzen, und da steht ja bekanntlich das Interesse am anderen obenan, was mit Nächstenliebe bezeichnet wird. Vielleicht tue ich anderen unrecht, wenn ich behaupte, dass man einen religiösen Menschen heute mit der Lupe suchen muss, und damit meine ich einen Menschen, der das zu leben versucht, was im Neuen Testament steht und nicht nur die konventionellen religiösen Formen vollzieht. Und das kann jemand sein, der sich selbst gar nicht als religiös einstufen mag, weil er sich von den Menschen, die vorgeben, religiös zu sein, abgestoßen fühlt. Wichtig ist nicht, wozu sich einer bekennt, sondern wie er handelt. Nicht, was einer sagt ist der Maßstab, nach dem er beurteilt wird, sondern wie sich einer verhält. Und da klafft bei vielen zwischen Reden und Tun doch eine große Lücke.
Dass ich religiös bin, ist kein persönliches Verdienst, ich habe überhaupt nichts dazu getan, ich habe mich so vorgefunden. Meine Mutter erzählte mir, wie ich schon mit vier Jahren kaum vom Rockzipfel einer Ordensschwester wegzubringen war, wenn sich eine Gelegenheit dazu bot wie zum Beispiel bei einem Besuch in einem Krankenhaus, das damals noch oft von Ordensschwestern geführt wurde.
Ob es mit meiner Religiosität zusammenhing oder einfach mit meinem Menschsein, vermag ich gar nicht zu sagen. Seit ich denken kann war ich bemüht, kein ichhafter Mensch zu sein; ob mir dabei die Religion den Weg dazu wies oder ob ich durch die Religion erst darauf gestoßen wurde, weiß ich gar nicht. Tatsache ist, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mich bei ichhaftem Verhalten ertappte oder mich ertappt fühlte. Es war mir furchtbar peinlich und ich schämte mich vor mir selbst, wenn ich mir eingestehen musste, dass ich aus egoistischen Gründen gehandelt hatte, was sich bei ganz alltäglichen Situationen einstellte, zum Beispiel, wenn ich mir beim Essen schnell das leckerste Stück angelte, damit es keinem anderen in die Hände fiel. Oft merkten es die anderen gar nicht, wenn es aber der Fall war, dann wäre ich am liebsten im Boden versunken.
Mir kam der Verdacht, dass ich überhaupt nicht weniger ichhaft war als alle anderen, dass ich die Religion benützte, um mich als Ich in den Vordergrund zu schieben, also als Vorwand, um mich wichtig zu machen. Da befand ich mich in einer grotesken Situation: Mein ganzes Bemühen kreiste darum, nicht ichhaft zu sein und mein Leben auf Gott auszurichten, und genau darin lag meine Ichhaftigkeit. Da stellte sich mir die Frage, wie ernst es mir nun mit der Religion war, deren Kern ja darin lag, das Ich zu transzendieren. Ging es mir nun im Innersten darum oder wollte ich mich nur damit wichtig machen? Und ich kam zu der Überzeugung, dass beides richtig war, dass beides ganz nahe beieinander lag und dass es genau darum ging, sich auf die richtige Seite zu schlagen.