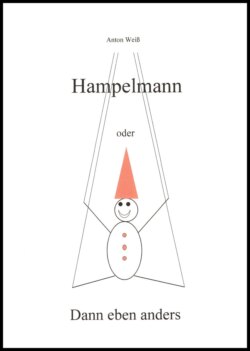Читать книгу Hampelmann - Anton Weiß - Страница 9
5
ОглавлениеIch muss wohl interessierte Fragen gestellt haben, auch schon bei der Besprechung von „Verlust der Mitte“, denn eines Tages sprach mich der Religionslehrer nach der Unterrichtsstunde an und fragte mich, ob ich nicht am Sonntag zum Gottesdienst kommen wollte. Eigentlich war ich kein begeisterter Kirchgänger, Religion und Kirche waren für mich zwei verschiedene Dinge. Nur meinem Vater zuliebe ging ich öfters, obwohl er selber auch nicht in die Kirche ging, aber von seinen Kindern verlangte er es. Das religiöse Zeremoniell sprach mich wenig an und die Predigten langweilten mich. Aber das Singen gefiel mir sehr, wenn es nur lebendigere Lieder gewesen wären und mehr Gottesdienstbesucher mitgesungen hätten. Ich litt sehr darunter, dass kaum jemand beim Singen den Mund aufmachte und mit „O Haupt voll Blut und Wunden“ konnte man mich regelrecht zur Kirche hinausjagen.
„Überleg es dir“, sagte er, nachdem er mir beschrieben hatte, wie ich das Haus finden konnte, in dem der Gottesdienst stattfinden würde, und ging die Treppe hinunter.
„Ich weiß nicht“, ging es mir durch den Kopf, meine Gefühle waren gespalten. In einem Haus sollte der Gottesdienst stattfinden und nicht in einer Kirche? Und warum spricht er ausgerechnet mich an und nicht auch andere? Interessieren würde es mich schon und am Sonntagvormittag hätte ich Zeit, zum Training ging ich ja erst nachmittags.
Als ich am Sonntag nach dem Gottesdienst nach Hause kam, erzählte ich ganz begeistert meinem Vater von dem eben Erlebten. Die Messfeier hatte in einem ganz normalen, großen Raum stattgefunden. Alle saßen in einem Kreis, der an einer Stelle durch einen schlichten Tisch unterbrochen war, auf dem zwei Kerzen brannten. Unser Religionslehrer saß auf einem Stuhl hinter dem Tisch und links und rechts von ihm schloss sich der Kreis. Als das erste Lied gesungen wurde – es war ein Liederheft ausgeteilt worden – war ich überwältigt. Alle sangen kräftig mit, ohne dass eine Orgel oder sonst ein Musikinstrument gespielt worden wäre, und ich versuchte zaghaft vom Blatt und getragen von den vielen Stimmen, mitzusingen. Ein solches lebendiges, frohes Singen hatte ich noch in keiner Kirche erlebt. Und die Predigt – zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich eine Predigt, die mit meinem Leben etwas zu tun hatte und die einige von den Fragen beantwortete, die ich schon lange mit mir herumtrug.
Mein Vater spürte meine Begeisterung und eigentlich hätte er zufrieden sein müssen, dass ich so für einen Gottesdienst schwärmte. Aber scheinbar machte ihn mein Überschwang misstrauisch, und was ich von der Messfeier erzählte, war nicht dazu angetan, seine skeptische Haltung zu verscheuchen, denn nicht nur, dass die Hostie in Form eines echten Stück Brotes gereicht wurde, nahm auch jeder aus dem Kelch einen Schluck Wein. Das war für ihn schon hart an der Grenze zur Ketzerei; meine Maßstäbe waren da andere.
***
So beschwingt und froh bin ich noch nie zum Training gegangen, und heute gelangen mir Aufschläge, die ich schon so lange geübt hatte, die aber in dieser Regelmäßigkeit noch nie klappten. Es gelang mir, die Bälle gezielt an die Linien zu spielen, so dass mein Gegenüber Mühe hatte, sie zu erreichen, oder wenn er sie erreichte, wieder zurück in mein Feld zu schlagen. Es sollte ja nur ein lockeres Trainingsspiel sein, aber wie meistens, wenn ich auf dem Platz stand, setzte ich mich voll ein, nur nicht immer mit dem Erfolg wie heute. Es ging mir gar nicht in erster Linie ums Siegen, es ging mir eigentlich um das Spiel. Häufig spielte ich verkrampft, wollte den Ball um jeden Preis so knapp wie möglich über das Netz oder an die Linie spielen, wodurch er häufig im Netz landete. Nicht dass der Ball zum wiederholten Mal nicht dort ankam, wo ich ihn haben wollte, betrübte mich, sondern dass meine Bewegungen nicht harmonisch waren, dass ich den Schläger überhastet nach unten drückte oder den Ball viel zu früh nahm. Es machte mir relativ wenig aus, wenn ich verlor, mir aber sagen konnte, dass ich ziemlich auf dem Niveau gespielt hatte, das ich mir bis jetzt erarbeitet hatte. Dass andere besser waren als ich konnte ich durchaus akzeptieren. Nur wenn nichts lief, wenn alles, was ich trainiert hatte, nicht gelang, dann empfand ich eine Niederlage äußerst schmerzlich. Es war nicht die Niederlage als solches, sondern meine Unzulänglichkeit und mein Unvermögen, was mir so zu schaffen machte.
Heute aber lief alles hervorragend, so dass der Trainer scherzend sagte: „Da kannst du ja bald in der Bezirksliga spielen“, was ich als ganz große Anerkennung empfand.
Dann war ich wieder in den Schulalltag eingespannt.
***
Deutsch war ein Fach, dem ich mit gemischten Gefühlen gegenüberstand. Der Unterricht war mir keineswegs unerträglich, aber bei den Aufsätzen musste ich mir die Gedanken aus den Fingern saugen, entsprechend holprig war auch dann der Stil, so dass meine Noten eher im Bereich von Vier lagen als von Drei. An Zweier war überhaupt nicht zu denken. Da mein Vater meinte, es dürfte doch nicht so schwer sein, einen guten Aufsatz zu schreiben, setzte er sich einmal bei einem Hausaufsatz hin und schrieb ihn mir; ein Deutschaufsatz im Jahr wurde immer als Hausaufsatz aufgegeben, der aber auch strenger bewertet wurde. Als die Aufsätze herausgegeben wurden, war ich auf die Note sehr gespannt. Seit dieser Zeit war mein Vater viel zurückhaltender, sich in meine schulischen Angelegenheiten einzumischen. Das Ergebnis muss für ihn sehr niederschmetternd gewesen sein, obwohl ich es mir sehr verkniff, auch nur die geringste Spur von Triumph zu zeigen, was mir aber durchaus Mühe bereitete – es war nämlich eine Vier.
Wie gesagt, mit Ausnahme des Aufsatzschreibens fand ich den Deutschunterricht durchaus interessant, denn man konnte über viele Dinge diskutieren, und das machte mir Spaß, da ich mich ja mit vielen Problemen des Lebens auseinander setzte. So kam einmal das Gespräch anlässlich eines Gedichtes von Friedrich Schiller auf die Frage nach der Freiheit des Menschen. Es war eine derart lebhafte Diskussion unter uns in Gang gekommen, dass sich der Lehrer regelrecht überflüssig vorkam. Er lehnte sich ans Fensterbrett und schaute auf die buntgefärbten Blätter der mächtigen Kastanienbäume, die im Schulhof standen, während wir uns in einer hitzigen Debatte fast in die Haare gerieten. Ich war natürlich der Meinung, dass der Mensch Freiheit haben müsse, da sonst alle Schuld und Verantwortung sinnlos wären und ein Mensch für sein Tun gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden könnte, während viele meiner Mitschüler der Meinung waren, dass alles durch Gesetze geregelt sei, denen jeder unterworfen wäre und nach denen alles ablief. „Wenn dem ganzen Weltgeschehen ein unabänderlicher Mechanismus zugrunde liegt, nach dem alles geschieht, wieso ist es dann möglich, dass ihr eine andere Meinung habt als ich? Dann muss es entweder verschiedene Mechanismen geben, was die Frage nur verschieben würde oder es gibt eben Freiheit.“ Ich war begeistert von meinem guten Argument, aber obwohl keiner ein überzeugendes Gegenargument vorbringen konnte, brachte es niemanden von seiner vorgefassten Meinung ab. An diesem Tag begriff ich, dass man durch Argumente niemanden überzeugen kann; jeder findet immer solche Anhaltspunkte, die seine Auffassung unterstützen. Zuerst hat man seine Auffassung und dann erst findet man Argumente, die diese Ansicht rechtfertigen. So waren gar nicht die Argumente das Interessante, sondern die Frage, warum man gerade diese Auffassung hatte, und mir schien, dass das sehr schwer herauszufinden sei.
Für mich zeigte sich immer deutlicher, dass die einen von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ausgingen, während ich, scheinbar durch meine religiöse Einstellung, oft zu einer anderen Sicht der Dinge gelangte. Mir war aber klar, dass ich mich eingehend mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen musste, denn ich wollte mich nicht in ein Abseits stellen lassen, aber mein eigenständiges Denken wollte ich mir auf keinen Fall nehmen lassen, wenn ich auch merkte, dass ich damit bei manchen Kopfschütteln hervorrief. Ich hatte aber das Empfinden, dass es in der Auseinandersetzung mit den naturwissenschaftlich denkenden Leuten letztlich um die Frage geht, ob es Gott gibt oder nicht. Eigentlich alle, mit denen ich diskutierte und die die naturwissenschaftliche Seite vertraten, glaubten nicht an Gott, obwohl doch führende Vertreter der Naturwissenschaft wie Einstein und Max Planck durchaus überzeugt waren, dass die Welt ohne eine dahinterstehende Intelligenz nicht möglich wäre. Ich fühlte mich immer in der Verteidigungsposition.
Was mir leider nie als Argument eingefallen ist, weil mir zu meinem Ärger die guten Argumente oft erst hinterher einfallen, ist zu fragen, ob sie, wenn sich nun wissenschaftlich beweisen ließe, dass es Gott gibt, dann zum Glauben kommen würden; was ich sehr bezweifle.
Ich wollte mir, wie gesagt, mein eigenständiges Denken nicht nehmen lassen, nur lief es oft in eine andere Richtung als bei den naturwissenschaftlichen Vertretern. Aber Glauben ohne Verstehen wäre mir unmöglich gewesen, und manchmal fragte ich mich, ob das zusammenginge oder ob man den Verstand zugunsten des Glaubens aufgeben müsse. Da fühlte ich mich durch einen Traum bestätigt, den ich in dieser Zeit hatte. Wir, d. h. lauter Frauen meist höheren Alters und ich, befanden uns in einer Schwimmhalle am Rande des Beckens. Um hinein zu gelangen, musste man einen weiten Sprung auf die gegenüberliegende Seite machen, wobei der Landepunkt ein nur eine Fliese breiter Absatz am Rande des Beckens war. Die Entfernung war so groß und der Landeplatz so klein, dass ich nie im Leben gewagt hätte, zu springen. Die Frauen aber sprangen, und wie magnetisch angezogen landeten sie jeweils auf dem fliesenbreiten Absatz. Sie ermunterten mich, auch zu springen, aber obwohl ich ihnen genau zuschaute, wie sie es machten, konnte ich mich nicht überwinden zu springen. Es war mir unmöglich etwas zu tun, dessen Folgen ich nicht abschätzen konnte. Während des Erwachens, zutiefst erregt von dem Geschehen, dachte ich: „Nein, und wenn es auch mein Heil gewesen wäre, zu springen – ich werde es nie tun, nicht gegen jede Vernunft!“ Und ich fühlte mich wohl dabei. Allmählich wurde mir der Unterschied klar. Er lag in einer Unterscheidung der Begriffe „verstehen“ und „begreifen“. Verstehen sollte man, aber begreifen darf man nicht. So nah diese beiden Begriffe beieinander liegen, so verschieden sind sie auch. Man muss nicht das Verstehen aufgeben, sondern das Begreifen-Wollen. Der Unterschied zwischen beiden könnte größer nicht sein: Begreifen will die Ratio, der Intellekt, er will alles in seinen Griff bekommen, um darüber zu verfügen und ist Ausdruck des Ichs; Verstehen hingegen umgreift auch das, was sich der Ratio entzieht; in ihm zeigt sich ein umfassenderes Bewusstsein. Es liegt nahe beieinander und ist doch so verschieden.
Es war die gleiche Situation wie beim Bocksprung. Der, der den Sprung verweigerte war der gleiche wie der, der springen sollte und musste. Und es lag ein unüberbrückbarer Abgrund zwischen beiden. Lag da irgendwie ein Grundprobleme vor, das ich in diesem Leben lösen musste?
Es gelang mir nie, mich völlig zu entspannen, mich richtig fallen zu lassen. Ich spürte immer eine innere Blockade, ich hatte Angst davor, in eine unbekannte Tiefe zu fallen. In einer der Geschichten, die unser Religionslehrer häufig zu Unterrichtsbeginn vorlas, ging es einmal um ein brennendes Haus, in dem sich in einem oberen Stockwerk noch ein Kind befand. Sein Vater stand unten und rief ihm zu: „Spring!“ „Ich sehe dich nicht“, kam es von oben. „Aber ich sehe dich“, rief der Vater, und das Kind sprang. Fehlte es mir an einem Urvertrauen, das einen in einer solchen Situation etwas tun lässt, wovor sich innerlich alles dagegen sträubt? Gab es Situationen, wo man seine Vernunft aufgeben musste? Ich betrachtete meine Vernunft als etwas sehr Kostbares, was ich mir nicht nehmen lassen wollte und ich begriff auch, dass das, was ich mit Vernunft meinte, etwas anderes sein müsste als Verstand, Intelligenz. Von letzterem war ich nämlich gar nicht so sehr gesegnet, das merkte ich ja im Unterricht, wenn andere eine Mathematikaufgabe viel schneller erfassten als ich. Was mich ausmachte war ein Bestreben, den Dingen auf den Grund zu gehen, wodurch sich in mir immer mehr ungelöste Fragen auftürmten, weil ich ja möglichst viele Stellungnahmen kennenlernen wollte, bevor ich mich für eine Auffassung entschied. Häufig war es so, dass ich einem Standpunkt zuneigte, weil jemand gute Argumente dafür hatte; vertrat dann ein anderer die gegenteilige Meinung mit ebenso überzeugenden Argumenten, dann stand ich da und wusste nicht, wem ich recht geben sollte, denn beide hatten gute Argumente für ihre Ansichten; welche war nun die richtige? Ob es um Euthanasie ging, um Abtreibung oder Todesstrafe – immer stand ich vor dem gleichen Problem, nicht zu wissen, was richtig oder falsch, gut oder böse ist. Ich musste die absolut richtige Antwort finden, denn ich wollte mich ja richtig, das heißt eben gut verhalten, und immer mehr begriff ich, dass es die Wahrheit, die einzig richtige Ansicht gar nicht gibt, sondern dass ich mich zu meiner Wahrheit durchfinden musste.
Das begriff ich erst nach und nach, und was mir dabei im Weg stand, war, dass ich eigentlich schon anerkannt sein wollte, ja – ich muss es gestehen – sogar bewundert werden wollte. Ich merkte selbst den Widerspruch in mir: Einerseits glaubte ich, dass es mir völlig gleich sei, ob mich die anderen anerkannten oder nicht. Ich war immer überzeugt, dass ich die Anerkennung, die ich brauchte, sowieso nie durch Menschen bekommen würde; die einzige Anerkennung, die mir wichtig war, musste von Gott kommen. Dadurch war ich ziemlich unabhängig von Lob und Tadel – so dachte ich wenigstens. Aber da gab es eben auch die andere Seite: Wenn ich ganz tief in mich hineinhorchte, dann zeigte sich sehr wohl, wie viel mir daran lag, von anderen gelobt und anerkannt zu werden und wie viel ich dafür tat. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. So lebte ich einen Zwiespalt, der irgendwann zutage treten musste. So weit war es aber noch lange nicht.