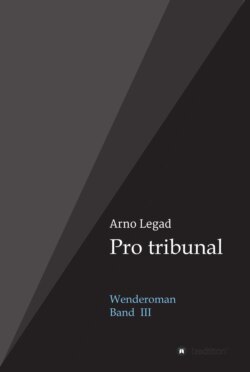Читать книгу Pro tribunal - Arno Legad - Страница 12
ОглавлениеWeg der Erkenntnis
USA-Präsident Bush ging zeitgleich einen weiteren Schritt zur Beruhigung der Ost-Menschen. Bei der ebenfalls stattfindenden NATO-Tagung bestand er auf den Erhalt der beiden Militärblöcke und der Unverletzbarkeit der bestehenden Grenzen. Die Sache ist erledigt! dachte er dabei. Keiner merkt etwas. Wir müssen die Leute nur in gewohnter Sicherheit und Behaglichkeit wiegen. Er lächelte sympathisch. –
Ein Wolf lässt sich nicht streicheln. Er lässt sich auch nicht zähmen. Er lässt sich domestizieren bis tausend Jahre vergangen sind. Doch dann ist er kein Wolf mehr. Dieser hier war einer; er kam direkt von der Räuberbande „Europäische Gemeinschaft“. Er nannte sich EG-Kommissar Frans Andriessen und wollte in der DDR erkunden, ob man vor „Einheit“ und vor dem westdeutschen Kapital noch rasch ein Stückchen Freihandel und Absatzmarkt erbeuten und vertraglich festschreiben könne. Freihandel ist Freiheit aller Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzung die es gibt; Knebelhebel des Handelskapitals gegen Staat und Menschen und Ausschaltung jeder rechtlichen Bestimmung. Böse kalte Augen hatte der Wolf Frans. Das DDR-Fernsehen wollte ihn possierlich finden und streicheln, und er gab beißenden Schwachsinn von sich. Die Frage hieß: „Herr Andriessen, welche Chancen sehen Sie für die DDR?“
„Ich glaube, dass auch die DDR große Chancen hat. Es gibt eine substanzielle Reform in der DDR hier, das haben wir auch in anderen RGW-Ländern gesehen. Und wenn das so weitergeht, dann gibt es im Prinzip die gleichen Chancen.“
„Welche Gebiete könnte der Handel DDR – EG umfassen? Wo könnte man kooperieren?“ fragte streichelnd das DDR-Fernsehen.
„Ich glaube, dass man auf dem Gebiet des Handels kooperieren kann mit Zusammenarbeit die Strukturen zu schaffen und so weiter. Ich bin hier nicht zu entscheiden, sondern zu sehen was wir tun können. Wir bereiten eine Verhandlung mit der DDR vor, ein Handelsabkommen, vielleicht irgendein weiteres Abkommen. Und in diesem Abkommen können wir dann verhandeln, was die konkreten weiteren Möglichkeiten sein werden.“
„Welche Voraussetzungen“, streichelte der DDR-Reporter, „muss die DDR dazu erfüllen?“
„Ich glaube, dass eine Demokratisierung wie sie heute im Gange ist, eine Kondition ist. Und wenn die Demokratisierung sich durchsetzt, dann sind wir im Westen Europas bereit, zu einer Zusammenarbeit zu kommen, wie wir das mit Polen und Ungarn machen.“
„Was könnte schon bis 1992 Früchte tragen?“
„Schwierig zu sagen“, druckste der Wolf. „Ich glaube, eine Reformpolitik im Wirtschaftsbereich braucht einige Jahre, und wenn wir schon im nächsten Jahr ein Abkommen verhandeln könnten, wäre es möglich, dass wir unsere Märkte weiter öffnen als bisher, und dass dann die Handelsräume der DDR nach der EU und andersherum sich ausweiten könnten.“
„Gibt es dabei auch Nachteile?“
„Ehöhm…“ – Wolf Andriessen verlor etwas die Fassung. „Das ist nicht was wir beabsichtigen mit einem Abkommen. Aber inwieweit sich Wettbewerb durchsetzt, da wird… Das kann ein Nachteil sein. Aber…“, setzte er grollend hinzu und kratzte die Kreide im Schlund zusammen. „Das kann auch ein Nachteil für die Westeuropäer, für die westeuropäische Gemeinschaft sein.“ Er grinste und zeigte seine Hauer.
Wenn man wirkliche Gemeinschaft eintauscht gegen ein Wort, gegen einen Titel oder Namen – dann bleibt Barbarentum übrig. In dreißig Jahren gibt es zwecks zügelloser Kapitalherschaft in mehreren Staaten der westeuropäischen „Gemeinschaft“ halbfaschistische Regimes.
Es war der fünfte Dezember. Der Wolf schob Güter und manipulierte Währung und fraß und fraß; und dieser und jener zudem. Des Sandes letzter Teil rann durchs Glas. Wir wollen’s nochmals erheben. Denn es ist einmalig.
Schaltmeister saß im rasenden Zug gen elterlicher Heimat. Diese Heimat zog an ihm vorbei; deren dichte Wälder, lichte Auen und neblige Weiden. Dann stieg er um, es ist nun einmal so. Was konnte er dafür? Er musste es, er stammte aus einem entlegenen Dorf im Erzgebirge, die wackere ratternde Gebirgsbahn ruckelte höher hinauf und weiter empor auf die Bergesspitzen. Er saß im weichen Polstereck und hatte nach Soldatenart den Kopf gegen die Jacke gelehnt, um zu schlafen. Sicher hat die barmende Mutter Kammer und Kühlschrank vollgestopft, um ihn zu feiern. Der schweigsame Vater säße trotz aller Kälte auf der Bank vorm Häuschen und hielt die lange Pfeife in der gewaltigen Hand. Schaltmeister öffnete die Augen und beschaute die dichten Wipfel der Erzgebirgswälder.
‚Tja’, würde der Vater sagen und nicken.
‚Kumm mei Jung!’, würde die Mutter im Hause sagen und Kammer und Kühlschrank öffnen. Schaltmeister schloss die Augen. So ist es. Aber das kann doch nicht alles sein? Er öffnete den Blick und sah durchs Fenster endlose Weite von Tannen- und Fichtenspitzen. Die Dämmerung nahte bereits. Höher klomm die Bahn und höher, ganz wie im ‚Zauberberg’, und hätte Schaltmeister diesen gelesen, so wüsste er wohl, dass er auf dem Wege der Erkenntnis fuhr; was ihn erwartete. Da war etwas zwischen dem nickenden Vater und der barmenden Mutter einerseits und der Heimat insgesamt. Und dies Etwas hieß Thomas Arndt und hieß auch ein wenig Ball, vielleicht sogar ein wenig Haber… Er schloss die Augen und schlief durchaus nicht und dachte: Ich geh meine LPG besuchen!
Wie lange ist er nicht mehr daheim gewesen! Rübenau liegt weiter als eines Arndts Heimatstadt in der Lausitz oder eines Balls Elternhaus in Dresden. Es galt ja fast eine Tagesreise.
‚Tja…’ ‚Kumm mei Jung…’
Schaltmeister nickte ein. „Blumenau!“ rief es draußen. Er sprang hoch, riß die Bundjacke vom Haken, griff die Tasche und sprang aus dem Zuge. Die Lok keuchte los.
Dann rannte er auf dem kiesigen Bahnsteig wiederum zur Waggontür und zerrte sie auf. Er lief nebenher, warf die Tasche einwärts und sprang hinein.
Ein Schaffner erschien und musterte den keuchenden Schaltmeister. „Wohin mogst denn?“
„Ich wollte gar nicht weg“, erklärte Schaltmeister. „Ich wollte bleiben. Hab mich nur geirrt!“
„Glück gehobt! Meistens ist es scha zu spat.“
Noch weiter hinauf fuhr ihn dann der Bus. Er entstieg diesem am Weißen Hirsch und wandelte zum elterlichen Häuschen. Auf der geteerten Fahrbahn wie überm Berg lag ein Hauch glitzernd weißer Schnee.
Da saß der Vater wie erwartet. Er sagte: „Tja! Geh mol ins Heisel…“
„Vater!“ hub Schaltmeister an. „Ich leg nur meine Tasche ins Zimmer und geh noch mal los.“
Was entfaltete der Vater unversehens für eine Redseligkeit! „Mutter wort dach!“ erklärte er. „Kumm doch mol erst on!“
Eisenstirnig trat der Schaltmeister entgegen: „Heut abend!“ widersprach er. „Ich will nur noch zur LPG.“
„Kummst noch Has un hast ka Zeit!“ tadelte Vater. Schaltmeister schlug die Augen nieder. „Hast ka Zeit für dein Herkumm!“ mahnte der Vater. „Musst gla weg!“
„Ja!“ sprach der Schaltmeister. „Ich muss gleich wieder weg.“
Beredsamkeit kam auch ihn an, wie eines Thomas Arndt: „Ich muss weg! Ich will zur LPG, jetzt erwisch ich noch einen. Heut abend bin ich dann da.“
„Wenn’s zurück bist… is zu spat!“ wandte der Vater ein.
„Dann is zu spat!“ entgegnete Schaltmeister. „Ich muss mich umseh’n! Ich muss wissen!“
„Do fehlt die Zeit!“ wandte der Vater ein. „Do ist’s zu spat…“
Frohen Mutes begrüßte Schaltmeister die Mutter, warf seine Tasche in eine Ecke und schritt im Dämmerlicht zum Rat der Gemeinde. –
Im Rathaus am Dorfplatze betrachtete ihn die Vorzimmer- und Schreibdame wie einen Pinguin. „Aus Berlin? Da bist dach de Dominus Uwe?“
Schaltmeister nickte. Freundlich erklärte sie: „Do Voositzende war vahin do.“ – „Ich will nicht zum Vorsitzenden“, erklärte Schaltmeister. „Ich will nur irgend jemand von der LPG sehen. Von meinen Kollegen sozusagen. Na, dann geh ich zum Rinderstall. Oder ich nehm den nächsten Bus nach Ansprung.“
„Wart mol.“ Sie hob den Hörer ab und wählte. „Ist Genosse Mehnert da? Hier ist ein Heimkehrer aus Berlin… von der LPG. Aogenblick… Vom Silo?“
Glücklich blitzte sie den Schaltmeister an. „Der Vorsitzende kommt gleich vorbei. Der will do glei bgrüß’n!“ –
Unruhig ging Schaltmeister vors Rathaus. Raucher müsste man sein! dachte er dabei. Dann könnte ich mir jetzt eine anbrennen. Ein hochbeiniger „Moskwitsch“ näherte sich. Weit oben glänzte kalt der silbrige Mond.
Dem Wagen entstieg ein drahtiger grauhaariger Mann. „Gut“, sagte er ins Wageninnere. Er schlug die Tür zu und schritt eilig zum Schaltmeister, trotz der Kälte mit offener Wattejacke. Schaltmeister erschrak etwas. Der liebe Gott! Der Vorsitzende persönlich! Will mich begrüßen! Fast hätte er wie zur Grundausbildung die Hacken zusammengezogen. Freundlich lächelnd wurde ihm eine sehnige Hand hingestreckt. Schaltmeister drückte sie. „Aaner der unseren!“ begrüßte ihn der Vorsitzende halb abwesend lächelnd, „…der nachsieht, wie es im Arzgbirg steht. Wollen wir uns hier im Weißen Hirsch niederlassen?“
Schaltmeister kannte plötzlich keine Diplomatie. „Sagen Sie…
Was wird denn jetzt hier?“
– „Ich habe deinen Namen gerad nicht parat.“
„Uwe Dominius.“
„Ach ja, ich weiß. Du bist aaner von denen die uns das Leben sauer gemacht haben. Ihr seid als Lehrjungs immer wie die Kampfhähne ums Lehrlingsinternat geschlichen, um bei den Mädchen zu landen.“
„Nein!“ widersprach Schaltmeister entschieden. „Das waren welche aus dem Dorf.“ Man stand unverändert vorm Gemeindehaus. Von der Kirche klangen hohl und schaurig sechs Glockenschläge über das schimmernde Weiß. „Aber du bist doch aus dem Dorf?“ fragte der Vorsitzende. Schaltmeister nickte.
„Jedenfalls hast du unseren LPG-Betrieb nur als Lehrling kennengelernt. Du hast es nur so gesehen: Das und das wird von mir verlangt. Wie muss ich die Arbeit durchführen… wie funktioniert das Melk-Karussell und so was. Da steckt aber noch viel mehr drin. Da steckt Geschichte drin, da gibt’s unendlich viele Schicksale von Bemühung und Fleiß. Daron denk ich jetzt viel. Du willst wissen, wie alles weitergeht?“
Der Vorsitzende sah zu Boden und sann. „In den letzten Jahren hat sich manches eingespielt, Uwe. Wir hier haben jedenfalls ein reines Gewissen. Es gab von oben anen Rahmen. Und dann gibt es dos, was wir daraus gemaocht hobn. Hier auf dem Land haben wir uns oaber an gutes Leben geschaffen. Wie geht es weiter? Als ihr um das Wohnheim gestrichen seid, hattet ihr keine Sorgen mehr wie früher de Leit. Wir haben den Rahmen aus der Hauptstadt ja aach immer mit Leben erfüllt. Die Leit sind stolz darauf. Aober sie fragen wie du: Was wird denn jetzt? Das Genossenschaftsleben, das ganze soziale Gefüge hier auf dem Land… Das ist unser Inhalt vom Rahmen. Ich weiß auch nicht was daraus wird, Uwe. Ich dachte, vielleicht kannst du mir wos erzählen? Du kammst da aus Berlin…“
Unversehens hatten die Rollen gewechselt, als hätte Schaltmeister das graue Haar. „Aber wenn ein Rahmen wegfällt“, sprach er leise, „fällt dann nicht auch das Innenleben weg?“
Erstaunt blickte ihm der Vorsitzende ins Gesicht. „Dafür haben wir hier die Grundlagen geschaffen“, wiederholte er. „Das war zu Anfang harte Arbeit, Uwe. Aber wir haben in dreißig Jahren mehr verändert und umgestaltet als alle Bauerngeschlechter vorher… in Jahrhunderten. Anfang der Achtziger habe ich eine Chronik über die Entwicklung unserer LPG geschrieben. Ich kenne mich ein bisschen aus.“
„Kann ich die mal haben, Kollege Mehnert?“
Dieser schmunzelte. „Interessant! Wenn wir euch das bei der Lehrausbildung gegeben hätten, wär es euch sonstwo vorbeigegangen! Aber sicher kannst du sie haben. Ich geh den Kuhberg hoch, zum Einsiedlerhof. Komm glaa mit; ich geb sie dir.“
Neben dem Schaltmeister gehend behauptete Mehnert: „Das Denken hat sich umgestellt aaf dem Land. Das war zuerst schwer. Vom Ich zum Wir – so hieß das Motto. Dos musste ja erst in die Köpfe hinein. Es hat auch nicht glei geklappt. Aber irgendwann hat es gegriffen. Das trug dann Früchte.“
Sie gingen nebeneinander. Die Sterne und der Mond blinkten.
„Das ist“, sagte Mehnert leise, „ein Stück Geschichte das wir geschrieben haben. Aber wie soll ich wissen, wie es weitergeht?“
Schaltmeister stiefelte nebendrein und lauschte.
„Das Arzgebirg war früher arm und trostlos. Im Mittelalter nannte man es Waldgebirge, im elften Jahrhundert kam der Name ‚Dunkelwald’ auf. Erst um Sechzehnhundert gab es die ganzen Erzfunde und den heitigen Namen. Die Leute blieben trotzdem orm, die mussten sich als Bergknappen und Stollenknechte verdingen. De kamen oft ums Leben, hungerten. Den Gewinn eingesteckt haben sich der deutsche Adel und die Kaufleute. Also dasselbe was die westdeutschen Konzerne jetzt in Südafrika oder der Elfenbeinküste tun.“
Schaltmeister grinste.
Irritiert sah Kollege Mehnert ihm auf den Mund. „Sie kommen mir vor“, erläuterte Schaltmeister respektlos und ehrerbietig zugleich, „wie eine wandelnde Bibliothek.“
„Bin ich auch“, bestätigte Mehnert trocken. „Alte Schriften berichten über die Bodenbeschaffenheit hier: schlecht, steinig. Dann die Jahresdurchschnitts-Temperatur von 5,2 Grad.“
Man erstieg den engen, steilen Kuhbergweg zwischen Gehöften beiderseits.
„Die Leit haben georbeit von Nacht bis Nacht, Uwe. So war das Leben früher. Neben dem bäuerlichen Kleinbetrieb betrieben sie nach Köhlerei, Glasmacherei, waren Sensenschmiede. Nagelschmiede, Waldarbeiter… Die letzte Köhlerei gab es hier im Wald noch in den Sechziger Jahren. Ja.“
Die steile Steigung war überwunden. Man schritt auf einer sauberen Straße.
„Dann kam der Wendepunkt 1945. Bis dahin hatte man am alten Denken festgehalten, in den eigenen Flurgrenzen. Das war man so gewohnt. Dann musst man neu anfangen, Neues schaffen aus Krieg, Trümmerhaufen, kaputten Wirtschaften und kaputten Betrieben. Die Befreiung von der faschistischen Diktatur verdanken wir zwar der Sowjetarmee. Aber der neue Anfang musste selbst geschafft werden. Es fehlte an allem, an Nahrung, Kleidung, Material und vor allem an Zuversicht. Es fehlte da Glauben an die Zukunft. Die Leit worn verzweifelt, Uwe. Das war nuomol so. Und kein Ami wollte uns was finanzieren. Hier hat keiner aanen Dollar reingesteckt. Dafür gab es bei uns den demokratischen Neubeginn, das Aktionsprogramm der KPD vom Juni 45, die Aktivisten der ersten Stunde. Leit, die nicht zuerst an sich dachten, die einfach zupackten, entrümpelten.“
„Was war nochmal das Aktionsprogramm der KPD?“ fragte Schaltmeister.
„Völlige Beseitigung des Faschismus, Enteignung der Kriegsgewinnler, der Konzerne und Banken, Liquidierung des ausbeuterischen Großgrundbesitzes und die Übernahme dieser Vermögen in Volkseigentum. Die Aufteilung des Bodens an die werktätigen Bauern. Die Bodenreform war eine demokratische Massenbewegung. Die Überschrift war: Alles Land in Bauernhand! Nur gab es in unserer armen Gegend gar nicht viel zu verteilen. Das war hier anders als sonst im Land. In Ansprung wurden 46 Hektar Wald und Wiesen verteilt – an 26 Klein- und Mittelbauern und Arbeiter. In Zöblitz erhielten 55 Siedler sechs Hektar Land und dreißig Hektar Wald. In Rübenau waren es vierzig Bauern, die vierzig Hektar Wald erhielten. Die hatten dann erstmal eine Existenzgrundlage. Man fand das ganz gut, was die Kommunisten machten. Es gab eine Art Vertrauen… und Vertrauensvorschuss.“
„Daran“, bemerkte Schaltmeister, „konnte man sich lange festhalten.“
„Dann gab es großzügige Kredite durch die neue Staatsbank. Für Ackergerät und Saatgut. Die Ablieferung wurde genauer bestimmt. Prompt kam’s dann zur Steigerung der Landwirtschaftsproduktion. 1946 hatten wir 2100 Dezitonnen Milch, 1950 dann 2600. Zuerst gab’s 236 Rinder und dann 279 und so weiter. Trotzdem war damals alles noch sehr primitiv. Kaum Traktoren oder Pferde, stattdessen Kühe vor den Pflügen. Man begann zu diskutieren, sich über die beste Arbeitsorganisation zu streiten. Denn die Neusiedler waren ja nicht so ans egoistische Denken gewöhnt wie die alten Großbauern. Es galt, die Volksernährung zu verbessern, Uwe.“
„Hm… ja“, sagte Uwe.
„Manche heiße Bauernversammlung währte die ganze Nacht! Am frühen Morgen fasste man plötzlich einen Entschluss, rieb sich die Augen und ging an die Arbeit…“
Unvermittelt öffnete sich der Horizont. Nur noch vereinzelt lagen die umzäunten Grundstücke an der Straße. Über die weiten, weiß überhauchten Berge konnte man kilometerweit blicken. Hier und da sah man in der Ferne Anwesen. „Hie a Heisel – da a Heisel“, sagte Schaltmeister.
Mehnert nickte. „Dieses abgelegene, ausgedehnte Streudorf ist scho eine Seltenheit. Dann kamen die ersten Organisationen der Bauern, die Vereine der gegenseitigen Bauernhilfe. Das hatte keiner befohlen, keine Besatzungsmacht und keine Partei. Das haben die Bauern selbst in die Hand genommen, weil sie begriffen haben, dass man sich abstimmen kann. Gemeinsam erreicht man doch viel mehr. Man muss es nur tun; und nicht bloß davon reden. Aber so war das damals. Da hat man’s einfach getan, Uwe.“ „Ja“, sagte Uwe ehrlich überzeugt. „Aber das ist die komischste Nachtwanderung, die ich gemacht habe.“
„Für mich auch! Für mich auch!“ versicherte der LPG-Vorsitzende. „Und das habe ich dir zu verdanken! Es ist als ob ich mir selber wieder ganz klar werde. Bei diesen VdgB ging es nicht nur um Feld-Geschichten; wer welchen Trecker nutzt. Da wurde das ganze dörfliche Leben reingepackt. Es ging um demokratische Mitarbeit, um Entscheidungen übers Leben hier. Über politische Fragen, ökonomische Sachen und auch über kulturelle. Nach der Organisation des bäuerlichen Handels, dem Bezugsverein, kam dann die BHG. Es gab dann Außenstellen, sogenannte Bauernläden. In Rübenau war das auf dem Hess-Hof. Und das alles hat funktioniert – und besser als jemals vorher. Jetzt haben wir ja ein sehr niveauvolles Geschäft. Für alles hat man die Leute frei gewählt, für alles, für die Organisation bis zur Klassifizierung und Bewertung der Rinder… Dann gab es einen Maschinenstützpunkt für alle Bauern beim VdgB. Das war bald zu klein und reichte nicht mehr aus. Also musste die vielbeschworene Arbeiterklasse ran. Und die half. Durch Vermittlung der SED gob’s bald die erste Maschinen-Ausleih-Station, die MAS. Das war schon eine leistungsfähige Angelegenheit. Der VdgB-Maschinenhof Lengefeld hatte fünf Zugmaschinen, zwei Hänger, zwei Dreschmaschinen und noch dies und das. Das war 1948. Die MAS hatte bei ihrer Gründung schon neun Zugmaschinen. 1979 gab es im Kreis 265 Traktoren, 33 LKW, 24 Mähdrescher, 18 Mähhäcksler, 45 Hochdrucksammelpressen, 26 Kartoffelkombines und 23 Schwadmäher. Und ohne dass irgendein Kapitalist ein Geschäft darin sah. Doas ist alles selbst erwirtschaftet, aus eignem Willen und aus eigner Kraft.“
Überrascht blieb Schaltmeister stehen und sah in den Mond. Kollege Mehnert war weitergegangen „Alles Menschenwerk ist wandelbar“, klang es von vorn, und Schaltmeister stapfte eilends hinterher. „Erscheint heut so und morgen anders, ist übermorgen abgeschafft und in fünf Jahren vergessen. Vielleicht auch darum heißt es bei Shakespeare: Oh schwöre nicht beim Mond, beim wandelbaren, damit nicht wandelbar dein Leben sei! Alles hängt doch an Menschenwerk. Damit wird alles wandelbar. Das Leben selbst. Man denkt nicht mehr dran, aber das hat doch die Grundlage gelegt für das was kommt. Wir haben zu oft auf die Partei geschworen. Das war der Fehler. Nicht auf Schwüre kommt’s an, sondern auf Taten. Doas haben wir im Lauf der Jahre ein ganz klein wenig vergessen.“
Schaltmeister hatte das überraschende Gefühl, neben einem ganz ungewöhnlichen Menschen einherzuschreiten. Der maß die Welt nicht an Worten, sondern an Taten! Ganz Berlin mitsamt dem Thomas Arndt nahm sich dagegen ärmlich aus.
„Das zählte früher hier für uns“, sagte Mehnert. „Das allein zählt für mich. Wir haben etwas zuwege gebracht. Jeder weiß es und spürte es. Aber jetzt?“
Unbeirrt schritt Mehnert voran und sprach leise: „1949 kam die Gründung der DDR. Das war ja eigentlich nur die Antwort auf die vorangegangene Spaltung Deutschlands durch die Westmächte. Aber es wurde gefeiert. Jetzt konnte endlich passieren, was Thomas Müntzer einst gefordert hatte: ‚Alle Macht muss gegeben werden in die Hand des gemeinen Mannes! Auf dass mein Volk in Häusern des Friedens wohne, unter sicherer Hut und in stolzer Ruh.’ Die Zusammensetzung der Volkskammer in Berlin war ja dann auch so: 286 Arbeiter und 57 Angestellte, 82 Bauern und Handwerker und 41 Intelligenzler. Diese Volkskammer war wirklich ein Parlament des Volkes.“
„DIESE Volkskammer…“, murmelte Schaltmeister. „Da vorn ist schon Ihr Einsiedlerhof!“
Zwischen Feldern gingen sie den Weg zum Gehöft herab.
„Die landwirtschaftlichen Erträge wurden gesteigert“, sprach Mehnert. „Aber es war irgendwann spürbar, dass es eine Grenze der Entwicklung gibt. Da dachte man wieder an Lenins Genossenschaftsplan: Großraumwirtschaft, weil es effektiver ist! Das macht der Agrarkonzern im Westen genauso, nur dass der Vorteil einem einzigen Besitzer zufließt. Aber es war hart, die Bauern davon zu überzeugen.“
„Ich weiß“, erklärte Schaltmeister.
„Für die Kleinen war es gut. Die sahen es sofort ein. Aber die großen Bauern hatten natürlich ihren Besitzerstolz und wollten gern allein entscheiden, was auf ihrem Boden passiert.“
„Wann ging das eigentlich mit den LPG los?“
Man betrat den großen Vierseiten-Hof und hörte leises Gewieher aus den Ställen. Ein Hund bellte. „Die ersten LPG-Gründer gab es schon 1956 in Ansprung mit acht Gründungsmitgliedern, 1957 dann in Zöblitz.“
Sie schritten über den unebenen Hof, im Schein einer Laterne, und Mehnert klappte die unverschlossene Haustür auf. „Gehen wir hoch. Kriegst ein Bier. Trinken wir ein Glas auf deinen Urlaub.“
Im doppelstöckigen Hause war es dunkel, nur aus einer Zimmertür schimmerte ein Spalt Licht. „Meine Frau korrigiert Arbeiten, sie ist Lehrerin.“
Zwei schwere Sessel standen vor einem Schreibtisch. Herr Mehnert schaltete die Schreibtischbeleuchtung ein, wodurch der Raum im Halbdunkel lag. Er öffnete eine Schranktür, zog die beiden Flaschen und zwei stabile Seidel heraus. „Die Grenzland-LPG Rübenau wurde 1957 gegründet. In der ersten Inventarliste steht: zwei Wassereimer, drei Sensen, ein Barometer und ein Transparent… und 116 Bücher. So begann das. Die ersten LPG-Mitglieder wurden gemieden, geschnitten. Da war die Stimmungsmache vom Westen. Ja, es war ja auch insgesamt nicht einfach. Das genossenschaftliche Vieh blieb zunächst wo es stand. Die Arbeit schien eher noch zuzunehmen. Hier in den Erzgebirgsdörfern war es aber Tradition, dass man sich abends zusammenfand, Geselligkeit pflegte. Das musste jetzt darunter leiden. Dann kam die Schnapsidee von Chruschtschow mit den Offenställen.“
Mehnert lachte auf. „Du kennst doch den Fischer-Stall? Der wurde 1958 als ein solcher Offenstall erbaut. Nachdem man sah, dass es ein Reinfall ist, hat man ihn zugebaut. Das war dann ein Stall für 88 Kühe. Dann gab’s einen Umbau für Jungvieh. Der wurde vorübergehend auch als Schafstall genutzt. Bis 1978 wurde dann daraus ein Kälberstall. Manchmal sind Wege zum Erfolg auch verschlungen, Uwe. 1959 hat man mit Ferkel- und Junghennenaufzucht begonnen. Damals hat die Bevölkerung aktiv beim Bauen geholfen. Es kam ihr ja selber zugute. Da hat auch niemand nach Geld gefragt. Oder nach Feierabend. Die ersten 500 Küken wurden im Wohnraum bei einer Kollegin untergebracht, weil der Bau noch nicht fertig war. Dann kam erst der Stall. Aber schon bald gab es 4000 Küken jährlich, und genauso rasch eine stabile Eier- und Broiler-Produktion. Diese alten Ställe gibt’s schon gar nicht mehr. Die standen da, wo jetzt die Bungalows und Finnhütten stehen.“
Mehnert trank einen Schluck Bier und sagte bestimmt: „Am meisten beeindrucken mich die Menschen! Die Genossenschaftsbäuerin die 500 Küken nach Hause nimmt oder die Kollegin Söll. In einem Zeitungsartikel der Sechziger Jahre hat sie mal gesagt: ‚Die Genossenschaft gab mir einen neuen Lebensinhalt. Die Schweine müssen doch fast wie kleine Kinder bemuttert werden, und das erfordert natürlich Zeit und Geduld und viel Liebe.’ Das ist eine Arbeitshaltung! Oder der Max Fischer mit seiner Schafherde im Schwarzwassertal, die er übernommen hat. Da gab es damals, früher Streit wegen der Versorgung von Rindern oder Schafen mit Winterfutter. Da hat er dann einfach so manchen Sack Heu selber gekauft, um seine Schafe zu erhalten.“
„Die nennen mich im Regiment“, erzählte Schaltmeister, „Schaltmeister. Aber ich glaube, ich schalte manchmal nicht so gut. So ein schwerer Anfang! Und jetzt läuft alles so glatt und in solchen Dimensionen. Das kann man doch gar nicht aufs Spiel setzen?“
„Steht denn alles auf dem Spiel? Das weißt du besser. Es war wirklich beachtlich, wie die Unterstützung damals manchmal aussah. Der Kreisbaubetrieb, das Ministerium für Staatssicherheit – alle haben uns geholfen. Aktiv, unentgeltlich, mit Taten. Das war auch später oft noch so. Sogar private Gasthöfe haben die Erntehelfer versorgt. Wir haben die Bauern am Anfang beredet und beredet und beredet. Die LPG-Nutzfläche lag 1960 bei 217 Hektar. Der Erfolg stellte aber alle zufrieden. Die Leistung der Kühe stieg auf knapp dreitausend Kilogramm Milch bei 3,49 Prozent Fett, also eine Erhöhung pro Kuhleistung um 1200 Kilo gegenüber 1956. Der Plan 1960 war übererfüllt: 321 Dezitonnen Rind Plan und 332 Dezitonnen Leistung. Es gab den Plan 338 Schweine und 369 Erfüllung. 126.700 Eier waren Plan, 135.400 Stück wurden geschafft. Im Johr 1963 wurde hier die Technik der MTS Lauterbach übernommen und schon komplett aus Eigenmitteln bezahlt. Dann kam es zur Zusammenlegung der LPG Sorgau mit der LPG Typ III Ansprung. Das hatten die beiden Vollversammlungen beschlossen. Der Wert der Arbeitseinheiten stieg. Plötzlich lief alles rund. Die Genossenschaftler waren überall vertreten, in allen örtlichen Volksvertretungen. Es gab viele Neubauten, Stallmodernisierungen. 1966 kamen die Haflinger für die Weidewirtschaft, für Touristik und Fortwirtschaft. Die Technik wurde konzentrierter eingesetzt, die Spezialisierung weitergeführt, bei uns ging man zum Rind…“
Mehnert sann über etwas nach und sagte langsam: „Das Umdenken gab es durchaus. Vom Ich zum Wir. Das war kein Traum. Das ist kein Traum… Das hat alles funktioniert. Die ehemalige Gastwirtschaft Weber in Ansprung war schon seit den ersten Jahren Schweinemast. Und die lag in den Händen von Hilde Weber. Und da lag sie gut. Die trauerte früheren Gasthaus-Zeiten überhaupt nicht etwa nach. Andere haben noch anders gedacht, und sowieso gab’s bei jeder neuen LPG zuerst wieder eine neue Form von Betriebs-Egoismus: Meine LPG, unsere LPG. Wenn man das wieder zusammenlegen wollte, musste dieser neue Betriebs-Egoismus jedesmal neu überwunden sein. Und jedesmal hat die Einsicht den Sieg davon getragen. Jedesmal per Mitgliederbeschluss. Doas ist eigentlich Demokratie, wie ich das versteh. ‚Vorwärts’ in Ansprung hat sich 1960 mit ‚Freundschaft’ zusammengelegt. Im Jahr 1965 wurde vereinigt mit ‚9. November’ Zöblitz, 1968 mit ‚Junge Welt’ Sorgau. Dann kam der Zusammenschluss mit ‚Vorwerk’ Zöblitz und ‚Waldfrieden’ Ansprung. 1970 gab’s die Vereinigung mit ‚Grenzland’ Rübenau. Also wirklich: Vom Ich zum Wir…“
Er stand auf. „Hier hast du noch’n Bier.“
Schaltmeister saß stumm da.
„Später ist der Kooperationsgedanke wieder zurückgegangen, Uwe. Warum weiß ich nicht. Jetzt gibt es aber trotzdem nicht nur die komplett gesicherte landwirtschaftliche Produktion, sondern auch Nebenproduktion, Lampenfertigung, Elektrobrigade und prachtvolle Kulturobjekte. Versorgung der 400 Mitglieder mit Frühstück und Mittagessen. Geregelter Feierabend und Urlaub.“ Schaltmeister schwieg.
„Daran lässt sich nichts aussetzen.“
„Nein“, sagte Schaltmeister.
„Wir haben die Zersplitterung der Produktion überwunden. Anfang der Siebziger Jahre wurde die Zentrale Rinderaufzucht beschlossen mit acht LPGen und 5250 Tieren. Der Bau umfasste 6300 Plätze und hatte einen Wertumfang von fast 28 Millionen Mark.“
Schaltmeister schwieg.
„Und trotzdem“, sagte Mehnert. „Trotzdem… Beim zehnten Parteitag war dasselbe zu hören wie schon beim neunten: Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik… Ja, die Sozialpolitik klappt und klappt schon seit 1975. Der Ausbildungsstand ist von 9,2 auf 81,5 Prozent gestiegen. Wir haben jetzt über 50 Hochschulabschlüsse bei einfachen Landarbeiterkindern. 1956 gab es keinen. Wir haben 21 Meister-Abschlüsse und 174 Facharbeiterausbildungen, wo es 1956 je einer waren. Aber was kommt jetzt?“
Schaltmeister schwieg. Mehnert ließ einige Minuten vergehen.
„Wir haben hier Landwirtschaft mit biologisch und ethisch sauberen Kriterien – ganz im Gegensatz zu den großen Konzernen im Westen, wo jedes Ferkel, jedes Huhn nur zu Profit und Gewinn verdonnert sind. Wenn’s dort regelmäßig zu Schweine- oder Geflügelpest kommt, ist es doch vorprogrammiert. Bei uns war das kaum je der Fall. Und wenn, dann wurde das eingetragen. Die Tiere dort drüben: künstlich groß geblasen, mit Chemie vollgestopft und nicht artgerecht gehalten, tote Hühner zwischen lebenden; Blut und Dreck, kaum noch Federn. Die männlichen Küken massenhaft industriell getötet. Das alles gibt es im Sozialismus ja nicht, echte Landwirtschaft eben.“
„Haben wir noch Sozialismus?“ fragte Schaltmeister still.
„Die Leute hier haben sich mit Herzblut eingesetzt für Tiere und Menschen – und auch für den Boden. Das war für uns alle immer eine große Gemeinschaft. Darauf sind wir schon stolz.“
„Ja“, bestätigte Schaltmeister hilflos.
„Die ökonomischen Entscheidungen hier stimmten, Uwe. Das zeigt doch unsere Bilanz! Die stimmten entsprechend der Hauptaufgabe des Achten Parteitages, der weiteren Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande. Diese Verbesserung ist geschafft. Das ist lange erledigt. Aber jetzt?“
Schaltmeister durchzuckte eine Erkenntnis. „Dann reichte die Hauptaufgabe des Achten Parteitages eben nicht“, bemerkte er rasch.
„Was wäre denn die Hauptaufgabe gewesen, die richtige?“ fragte Mehnert.
Er überlegte und betrachtete den Schaltmeister. „Die Gefahren“, murmelte dieser Schaltmeister und kratzte seine Berliner Einsichten zusammen, „richtig einzuschätzen… die Gefahren… des gegnerischen Klassenkampfes einzuschätzen und denen standzuhalten.“
„Wenn das stimmt, lieber Kollege aus Berlin“, fasste Mehnert zusammen, „dann hätten wir hier im Wesentlichen alles richtig gemacht und es trotzdem an entscheidender Stelle fehlen lassen? Weil wir falsch geführt wurden… Dann stände die Erhöhung des Lebensstandards nicht mehr für sich allein. Sondern wäre nur der Maßstab gewesen, im Klassenkampf? Vielleicht hätte das auch noch mehr Anreiz gegeben…“ Mehnert nickte. „oder weiteren Anreiz.“ Er lächelte etwas. „Das ist dann wie bei euch, als ihr wie die Kampfhähne ums Mädchen-Wohnheim gezogen seid. Ihr habt euch weiter keine Sorgen mehr gemacht. Nicht wohr?“
„Ja. Aber ich war’s nicht, Kollege Mehnert!“
Dieser winkte ab. „Wie immer! Keiner war’s.“
„Gut Nocht!“ erwiderte Schaltmeister in heimischer Mundart und erhob sich. –
Durch die weißglitzernde Nacht wanderte er. Zu Hause schliefen die Eltern bereits. Wie gesagt: Do is zu spat.
Ich habe die Chronik vergessen! Vergessen. Vergessen!
Er schaltete den Fernseher ein und schaltete ihn wieder aus. Er aß von einem bereit gestellten Teller mit belegten Schnitten. Er putzte Zähne und stieg dann in sein Dachkämmerchen. Sein gemütliches Federbett erwartete ihn frisch bezogen.
Er nahm den Duft des Holzes wahr und setzte sich auf die knarrende Liege. „Gut Nocht!“ wiederholte er.