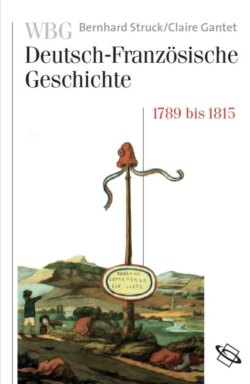Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. V - Bernhard Struck - Страница 12
Wo liegt Deutschland? Wo beginnt Frankreich?
ОглавлениеIm Winter 1807/08 hielt der Philosoph Johann Gottlieb Fichte im von den Franzosen besetzten Berlin seine „Reden an die deutsche Nation“. In der „Stunde der größten Bedrängnis“, so in der ersten der insgesamt vierzehn Reden, wandte er sich an die „deutsche Nation“ und appellierte an das deutsche Volk, insbesondere an die „gebildeten Stände Deutschlands“, sich dem antinapoleonischen Widerstand anzuschließen und sich zu einem nationalen Aufbruch zu erheben.1 Wenige Jahre später, 1813, dem Jahr der sogenannten Völkerschlacht bei Leipzig, als sich die nationale Erhebung gegen Napoleon nicht allein literarisch, sondern auch militärisch längst formiert hatte, fragte Ernst Moritz Arndt in seinem Lied: „Was ist des Deutschen Vaterland?“ In der siebten Strophe gab der in Greifswald tätige Professor und Publizist selbst die Antwort auf die Frage: „So weit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, das soll es sein!“2
Das 19. Jahrhundert ist wiederholt als das Zeitalter des Nationalismus, die Zeit um 1800 als die Zeit der Erfindung der Nation beschrieben worden.3 Besonders die Jahre zwischen der Niederlage Preußens bei Jena und Auerstedt, dem Einzug Napoleons in Berlin und der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, und 1813/15, verknüpft mit den Stichworten Völkerschlacht bei Leipzig und der Schlacht bei Waterloo, können als eine Art Inkubationszeit des nationalen Erwachens gelten.
Eine Vielzahl von Schriftstellern und Publizisten widmete sich in diesen Jahren der Frage nach der Nation. Zu ihnen gehörten im Kontext der Berliner Publizistik Heinrich von Kleist und Adam Müller, in Wien waren Friedrich Schlegel und Friedrich von Gentz literarisch aktiv. Weiterhin sind Autoren wie Achim von Arnim, Clemens Brentano, Jakob und Wilhelm Grimm oder Joseph Görres zu den nationaldemokratischen Publizisten der Zeit um 1806 zu rechnen.4
Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte waren somit nur zwei Vertreter einer schriftstellerischen Elite, die explizit die Frage nach der deutschen Nation, nach ihrem Wesen, Inhalt und ihren Grenzen aufwarf. Beide gehörten jedoch eher den Extrempolen an, sofern man Arndts Antwort auf die Frage nach den Grenzen der deutschen Nation, „so weit die deutsche Zunge klingt“, symbolisch deutet. Denn bei dieser geographischen Lokalisierung der deutschen Nation handelte es sich eher um ein rhetorisches Maximalprogramm, das angesichts des Umfangs und der Zerstreutheit der deutschen Sprachgemeinschaft, vor allem in Ostmitteleuropa, kaum zu realisieren war. So virulent die Frage nach dem Ort und der Lokalisierung der eigenen Nation für die Eliten um 1806 auch war, so macht die Liedzeile Arndts zugleich deutlich, wie unscharf die Vorstellungen nach Umfang, Ausdehnung und Grenzen dieser Nation noch waren.
Mit der Frage nach der Nation war notwendig die Frage nach deren Grenzen verbunden. Denn der Appell der Publizisten an die eigene Nation bedeutete, diese zu definieren. Wer nach dem Eigenen sucht, fragt notwendig nach dem Anderen. Dass die Grenzziehung in nationaler Hinsicht in der Zeit von etwa 1789 bis 1815 aus deutscher Perspektive vor allem gegenüber dem Nachbarn Frankreich vollzogen wurde, liegt nahe angesichts der seit 1792 mehrfach über die Grenze hinweg ziehenden Revolutionskriege.
Aus heutiger Sicht erscheint es kaum fraglich, was Frankreich ist, wo Deutschland liegt oder wo die Grenzen der beiden Nachbarn verlaufen. Was heute selbstverständlich erscheint, muss nicht in gleicher Weise für die Zeitgenossen um 1800 gegolten haben. Denn Grenzen sind stets wandelbar, sowohl in ihrer faktisch-administrativen Handhabung als auch in ihrer alltäglichen Erfahrung und Wahrnehmung.5 Aufgrund der zeitlich veränderlichen Grenzformen, zu nennen sind soziale, regionale, nationale oder konfessionelle Grenzen, ist im Kontext einer deutsch-französischen Geschichte zunächst danach zu fragen, was „Frankreich“ beziehungsweise „Deutschland“ in geographischer Hinsicht in den Augen der Zeitgenossen um 1800 bedeutete.