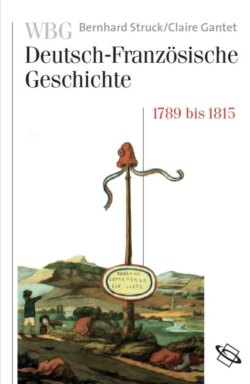Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. V - Bernhard Struck - Страница 14
Konzepte der Nation: Staatsnation und Kulturnation?
ОглавлениеDer volontaristischen Staatsnation steht das Konzept der deutschen Kulturnation gegenüber, eine Unterscheidung, die sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Im Jahr 1797 fragten Goethe und Schiller in ihren „Xenien“ nach dem Ort dieser Kulturnation: „Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf […]. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.“22 Die wenigen Zeilen bilden ab, was viele Publizisten und Dichter in Deutschland um 1800 dachten. Man orientierte sich an dem von Frankreich vorgegebenen Konzept der Nation. Aber auf das territorial, politisch wie konfessionell heterogene Heilige Römische Reich war das Konzept der einheitlichen Staatsnation nicht übertragbar. Was blieb, war die kulturell über Sprache und Literatur definierte Nation, deren Grenzen und Territorium aber weiter unklar blieben.
Als die Zeilen 1797 in den „Xenien“ erschienen, wurde die Frage nach Territorien und Grenzen auf politischer Ebene wieder aktuell. Preußen war bereits 1795 im Frieden von Basel aus der Koalition gegen Frankreich ausgeschieden und hatte auf seine Gebiete links des Rheins verzichten müssen. Dies war ein hoher territorialer Preis, der Preußen dazu veranlasste, die kommenden zehn Jahre Neutralität zu wahren. Im Friedensabkommen von Campo Formio zwischen Frankreich und Österreich 1797 musste Habsburg auf die niederländischen Besitzungen und die Gebiete links des Rheins verzichten. Damit kamen die linksrheinischen Gebiete für knapp zwei Jahrzehnte an Frankreich. Im September 1800, Napoleon war mittlerweile Erster Konsul, wurden die rheinischen Departements administrativ endgültig in den französischen Staatsverband eingegliedert. Im Frieden von Lunéville wurde dieser territoriale status quo noch einmal bestätigt.23
Diese territoriale Veränderung bedeutete, dass Frankreich aus deutscher Sicht seit 1797/1801 faktisch am Rhein begann. Von einer emotional besetzten, als national wahrgenommenen „Gränze des Vaterlandes“24, wie Johann Daniel Mutzenbecher kurz nach 1815 den Rhein beschreiben sollte, konnte jedoch 1800, unmittelbar zum Zeitpunkt der Gebietsverluste aus deutscher Sicht, noch nicht die Rede sein. Reisende, die in diesen Jahren die ehemals deutschen Gebiete beziehungsweise neuen französischen Departements bereisten, beschrieben diese kaum anders als ihre Landsleute kurz vor der Revolution. Zwar wurden Kriegsschäden in der Region registriert, auch die Symbole auf französischer Seite hatten sich geändert, so fiel den Passagieren die allgegenwärtige Kokarde auf. Bemerkt wurde auch die Genauigkeit der Grenzkontrolle.25 Ansatzweise finden sich Hinweise auf eine kritische Betrachtung der französischen Verwaltung links des Rheins. So rügte Friedrich Albrecht Klebe auf seiner Reise durch die vier neu integrierten Departements Donnersberg (Mont Tonnere), Rhein-Mosel (Rhin-et-Moselle), Saar (Sarre) und Rur (Roer) den von Frankreich nur mangelhaft eingerichteten „öffentlichen Unterricht“ und tadelte den in seinen Augen um sich greifenden Aberglauben, „Dummheit, Barbarei und Unwissenheit“.26 Die Frage nach der nationalstaatlichen Zugehörigkeit der Gebiete links des Rheins spielte indes noch keine, allenfalls eine unbedeutende Rolle. Weder der Beginn der Revolution im Jahr 1789 noch der Kriegsbeginn 1792 lösten unmittelbar eine neue Wahrnehmung dessen aus, was Frankreich in geographischer Hinsicht bedeutete.
Der Umbruch in der Wahrnehmung Frankreichs in Bezug auf Nation und nationale Feindschaft folgte erst nach den für Preußen verheerenden Niederlagen in Jena und Auerstedt und der anschließenden Auflösung des Alten Reiches. Ernst Moritz Arndt kann für diesen Wandel innerhalb eines kurzen Zeitraumes stellvertretend stehen. Denn noch der Bericht von seiner Frankreichreise in den Jahren 1798 und 1799 zeigt keinerlei Spuren einer nationalen Gegnerschaft oder Feindschaft.27 Nichts deutet auf den späteren Autor von „Der Geist der Zeit“, einer antinapoleonischen Flugschrift aus dem Jahr 1806, hin.
Erst die Gründung des Rheinbundes, dessen Mitgliedsstaaten wie das Königreich Westfalen zum Teil von der Familie Bonaparte regiert und zunehmend als Vasallenstaaten Frankreichs betrachtet wurden, sowie die Besetzung Berlins Ende Oktober 1806 durch französische Truppen wurden in Teilen der Öffentlichkeit als nationale Niederlage empfunden. In dieser Phase, über zehn Jahre nach Beginn der Revolutionskriege und des erstmaligen Verlustes von deutschen Territorien, formierte sich allmählich ein Widerstand gegenüber dem westlichen Nachbarn, der national argumentierte. Erst die sogenannten Befreiungskriege der Jahre 1813 und 1814, zwischen der Völkerschlacht bei Leipzig und der endgültigen Niederlage Napoleons bei Waterloo, waren Kriege um die Rückgewinnung nationaler Territorien, wobei zwischen Propaganda und Realität der vermeintlich nationalen Kriege unterschieden werden muss.28 Erst vor diesem Hintergrund konnte ein Reisender wie Johann Daniel Mutzenbecher die Erfahrung einer nationalen Grenze machen und 1819 bei Kehl am Rhein von „Schmach“, „Rache“, „Heimath“ und „deutschem Boden“ schreiben. Die Reiseberichte aus der Zeit zwischen etwa 1789 und 1815 machen deutlich, wie sich Frankreich aus deutscher Sicht als nationaler Raum konkretisierte und gleichzeitig das Eigene in Abgrenzung von dem Nachbarn als Nation hervortrat.
Auch in französischen Berichten ist die Konkretisierung der Grenzerfahrung nachvollziehbar: In „De l’Allemagne“, der wie keine andere Darstellung das Bild Deutschlands im Frankreich des 19. Jahrhunderts prägte, schrieb Germaine de Staël: „Die Rheingrenze ist feierlich; indem man sie überschreitet, fürchtet man das schreckliche Wort zu hören: jetzt bist du außerhalb Frankreichs. Vergeblich bemüht sich der Geist, mit Unparteilichkeit von dem Geburtslande zu urteilen, unsere Gefühle trennen sich nie davon; und ist man genötigt, es zu verlassen, so hat die Existenz ihre Wurzel verloren, so fühlt man, daß man sich selbst fremd geworden ist.“29
Der emotionale Bericht über die abrupte Fremde, war ohne Zweifel der Verbannung de Staëls aus Frankreich durch Napoleon und der Situation des politischen Exils geschuldet. Dennoch steht ihr Bericht am Anfang einer Reihe von Reiseberichten, die den Rhein als eine lineare, nationale Grenze zwischen Deutschland und Frankreich beschrieben.30 So kann die Zeit zwischen 1800 und 1815 als Inkubationszeit nationalen Denkens und der Eingrenzung der Nation gelten, in der Zwischenräume wie die Rheinlande, Elsass und Lothringen, die traditionell sowohl von französischen wie auch von deutschen Kultureinflüssen geprägt waren, zu einer Grenze wurden, die Frankreich und Deutschland zunehmend trennte.31
Was den Rhein in seiner Wahrnehmung als Grenze betrifft, kann von einer „Nationalisierung der Geographie“ gesprochen werden.32 Diese Entwicklung verlief in zunehmend emotionaler Weise, so dass Lucien Febvre in seiner Definition von Grenze zuzustimmen ist, dass eine solche weniger durch Grenzkontrollen denn durch Gefühle, oft Abneigung oder gar Hass geprägt sei.33 Obwohl es bereits lange vor und während der Revolution de facto Staatsgrenzen gab, spielten Emotionen, eine gemeinsame Geschichte und kollektive Geschichtserfahrungen in der Wahrnehmung der Zeitgenossen kaum eine Rolle. Dies war eine Entwicklung der Zeit zuerst um 1806/15 und später, im Kontext der Rheinkrise 1840, in deren Verlauf auf deutscher wie auf französischer Seite die nationale Grenze erfunden wurde.
Hinsichtlich der Frage der Periodisierung einer deutsch-französischen Geschichte steht außer Frage, dass der Beginn der Revolution aus französischer Sicht bereits für die Zeitgenossen einen Bruch bedeutete.34 Ohne Frage richtete sich die Aufmerksamkeit nicht nur der deutschen, sondern auch der europäischen Öffentlichkeit seit dem Sommer 1789 auf die Ereignisse in Frankreich. Dennoch bleibt festzuhalten, dass hinsichtlich der Wahrnehmung des eigenen nationalen Raumes nicht 1789 das entscheidende Datum eines Umbruches gewesen ist. Vielmehr bedurfte es über die innerfranzösische Revolution hinaus der deutsch-französischen Kriege und der Erfahrung des Verlustes von Gebieten, Fremdherrschaft und der Wiedergewinnung der durch Frankreich annektierten Territorien, um ein Bewusstsein für die Grenzen der eigenen Nation herauszubilden. In dieser Hinsicht war 1789 aus deutscher Sicht weniger entscheidend als die Jahre zwischen 1806 und 1815.
1 Zitiert nach DEMEL/PUSCHNER (Hg.) 1995 [1], S. 400.
2 Vgl. NIPPERDEY 1994 [271], S. 30; DANN 1996 [774], S. 80f.
3 Vgl. ANDERSON 1998 [755], S. 13.
4 Vgl. DANN 1996 [774], S. 63–73.
5 Vgl. STRUCK 2006 [616], S. 193–229; SCHMALE 2001 [727].
6 Vgl. LA ROCHE 1787 [94], S. 17.
7 Vgl. SANDER 1783/84 [102], Bd. 1, S. 23.
8 Zum Passwesen vgl. HEINDL/SAURER (Hg.) 2000 [862].
9 GRIMM 1775 [88], Bd. 1, S. 198f.
10 Ebd., S. 200, 205.
11 Vgl. BLITZ 2000 [768]; DANN 1996 [774], S. 50–56; MÖLLER 1994 [270], S. 47–58.
12 MUTZENBECHER 1822 [95], S. 88.
13 Zum Rhein als Erinnerungsort vgl. MAYEUR 1997 [709], S. 1152.
14 Vgl. MUTZENBECHER 1822 [95], S. 89–91.
15 Vgl. ROWE 2003 [722], S. 48–83; SMETS 1996 [733].
16 Beide Zitate nach RICHET 1988 [721], S. 1245f.
17 Zur Staatsbürgerschaft vgl. BRUBAKER 1992 [854], S. 35–49; RAPPORT 2000 [872].
18 Im Jahr 1810, zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung des Grand Empire, umfasste Frankreich 130 Departements. Vgl. MARTIN 2004 [394], S. 96; OZOUF 1988 [717]; NORDMAN/REVEL 2000 [716], S. 168–181.
19 Vgl. BERGERON 1988 [310], S. 804.
20 Vgl. GROSSER 1989 [577], S. 183–242.
21 Vgl. OELSNER 1793 [98], S. 437–472.
22 SCHILLER 1964 [138], Bd. 1, S. 267.
23 Vgl. ROWE 2003 [722], S. 88.
24 MUTZENBECHER 1822 [95], S. 88.
25 Vgl. DROYSEN 1802 [83], S. 23–27.
26 KLEBE 1801 [93], Bd. 2, S. 178, 182.
27 Vgl. ARNDT 1802 [77].
28 Vgl. BROERS 1996 [474], S. 239–243, der vom „Mythos“ der Befreiungskriege spricht.
29 STAËL 1813/1985 [105], S. 89f.
30 Vgl. SCHMALE 2001 [727].
31 Vgl. FRANÇOIS 1987 [690], S. 249.
32 Vgl. JEISMANN 1992 [794], S. 52.
33 DEMANGEON/FEBVRE 1935 [682], S. 129.
34 Vgl. unten Kap. I.3 und II.2.