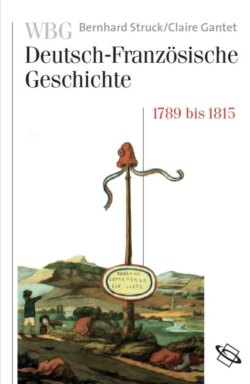Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. V - Bernhard Struck - Страница 19
Lesegewohnheiten, Alphabetisierung und Medien
ОглавлениеTrotz der durch den Krieg intensivierten Mobilität blieben weite Teile der ländlichen Bevölkerung bis ins 19. Jahrhundert weitgehend immobil und illiterat. Zwar stieg die Alphabetisierung in beiden Ländern von etwa 10 Prozent der Bevölkerung um 1700 auf ca. ein Viertel am Ende des Jahrhunderts. Wenn jedoch für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts von einer „Leserevolution“ gesprochen wird, bleibt zu beachten, dass diese weitgehend auf die städtischen Zentren und die dort lebenden bürgerlichen Schichten in Frankreich und Deutschland beschränkt blieb. Denn insgesamt ging in Frankreich im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Zahl der Schüler an höheren Schulen sogar leicht zurück. Somit konnten in Frankreich lediglich in den größeren Städten am Vorabend der Revolution etwa 50 bis 65 Prozent der Männer und 30 bis 40 Prozent der Frauen als alphabetisiert gelten. Ähnliche Zahlen lassen sich für Deutschland aufzeigen.62
Wenn für die Zeit um 1800 konstatiert werden muss, dass trotz einer in den Städten steigenden Alphabetisierung etwa drei Viertel der Bevölkerung in Frankreich und Deutschland weder lesen noch schreiben konnten und zugleich einem weitgehend lokalen lebensweltlichen Rahmen verhaftet blieben, verdeutlicht dies die Grenzen einer Geschichte der gegenseitigen Wahrnehmung und des Transfers. Abgesehen von den Gebieten, die wie die Rheinlande bereits früh direkt von den Revolutionskriegen, Annektion und später von der Wehrpflicht betroffen waren, trat die ländliche Bevölkerung kaum als Akteur von Transferprozessen in Erscheinung.63
Nicht nur in quantitativer Hinsicht ähnelte sich der Alphabetisierungsprozess in Deutschland und Frankreich. Beide Länder wiesen darüber hinaus eine regional sehr unterschiedliche Entwicklung hinsichtlich des Urbanisierungsgrades und der Alphabetisierung auf. Konstitutiv für Frankreich ist eine traditionelle Trennung entlang der inneren Grenze, die in etwa der Linie von Saint-Malo am Atlantik bis nach Genf entsprach. Nördlich dieser Linie lagen die Regionen mit einer höheren Einwohnerdichte, mit mehr Druckereien und Buchhandlungen pro Einwohner und mit einer signifikant höheren Alphabetisierungsrate.64 Obwohl für die Zeit um 1800 nur unzuverlässige Zahlen vorliegen, lässt sich auch für Deutschland eine vergleichbare Trennlinie von Stralsund nach Dresden ziehen. Östlich dieser Linie war der Schulbesuch deutlich niedriger als in den mittleren und westlichen Provinzen Brandenburg-Preußens. So besaßen in den Regionen um Magdeburg und Halberstadt oder in der Neumark nahezu alle Dörfer eine Schule, wohingegen in Pommern nur 65 Prozent oder in Westpreußen sogar nur 30 Prozent eine eigene Schule aufweisen konnten. Für das Alte Reich ist neben der politischen Vielgestaltigkeit somit ein kulturelles Gefälle, am Beispiel Brandenburg-Preußens gar eine Spaltung hervorzuheben.
Die inneren Grenzen ähnelten sich durchaus, so dass von verschiedenen „Deutschlands“ und – in Anlehnung an Pierre Noras „Les Frances“ und Braudels „La mosaïque France“ – von unterschiedlichen „Frankreichs“ gesprochen werden kann. Die innere Spaltung der beiden Nachbarn verdient deshalb eine nähere Betrachtung, da sie die „Geographie von Kulturräumen deutlich macht“, die den politischen Einheiten „Frankreich“ und „Deutschland“ entgegenstand, die sich erst nach 1800 deutlicher herausbildeten.65
Was auf politischen Karten auf den ersten Blick so kontrastreich erscheint, erweist sich im Licht von Alphabetisierungskarten oder Faktoren wie Urbanisierung und Demographie als ähnlich oder vielmehr als sich überlappend. Denn das Frankreich nördlich der Linie Saint-Malo–Genf und Deutschland westlich von Stralsund und Dresden gehörten um 1800 gemeinsam zu einem größeren nordwesteuropäischen Kulturraum mit einem Vorsprung in der Lese- und Schreibfähigkeit, der darüber hinaus die Niederlande, England und Schottland einschloss. Auch die Rheinlande, die in der Forschung aufgrund ihrer territorialen Zersplitterung im Alten Reich und aufgrund des dominanten Katholizismus lange als rückständig betrachtet wurden, gehörten in diesen Raum engerer Kommunikation und dichterer Besiedlung und gelten in der jüngeren Forschung als weitaus dynamischer, als lange angenommen wurde. Für die schnelle mediale Reaktion auf die Französische Revolution war dies eine entscheidende Voraussetzung.66 Dagegen gehörten sowohl das südliche Frankreich als auch das östliche Deutschland und große Teile der österreichischen Gebiete zu einem „peripheren Europa“, in dem noch länger traditionale Strukturen von Bedeutung waren, Urbanisierung und Alphabetisierung erst später einsetzten.67
So vage der absolute Anstieg der Leser angesichts des oft unsicheren Datenmaterials bleiben muss, unzweifelhaft ist, dass mit der quantitativen Veränderung der Leserschaft ein qualitativer Wandel im Leseverhalten einherging. Dieses wandelte sich zunehmend von einer „intensiven“ Lektüre von primär religiösen Texten wie der Bibel oder volkstümlicher Kalender zu einer „extensiven“ Lektüre immer neuer Bücher.68 Ansteigende Alphabetisierung und zunehmende Buchproduktion bedingten sich gegenseitig und können als eine der wesentlichen Voraussetzungen für die kulturellen Ursprünge der Revolution gesehen werden. Diesbezüglich hat die jüngere Forschung mit Studien zu Leserschaft, Autoren der Aufklärung, Auflagenhöhen und Zirkulation von Schriften, vor allem mit Fokus auf Paris, betont, dass es weniger die Schriften der Hochaufklärung wie die von Hume, Voltaire, Rousseau oder Kant waren, deren Publikationen zur Erosion des Ancien Régime beitrugen. Vielmehr hätten in einem erheblichen Ausmaß zweitoder drittklassige Autoren mit Pamphleten satirischen oder gar pornographischen Inhalts die Autorität der französischen Monarchie untergraben.69