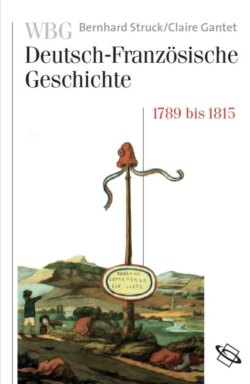Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. V - Bernhard Struck - Страница 20
Intellektueller Austausch in Salons, Sozietäten und neuen Gruppen
ОглавлениеDen gut ausgebildeten bürgerlichen Schichten eröffneten sich am Ende des Jahrhunderts eine Reihe von Aufstiegsmöglichkeiten und der Zugang zu Tätigkeiten wie in der Verwaltung, die traditionell dem Adel vorbehalten gewesen waren. Dem größten Teil der Bevölkerung, der erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in einem langsamen Prozess alphabetisiert wurde, standen diese Möglichkeiten nicht offen. Neben der geographischen war somit auch der sozialen Mobilität im Ancien Régime enge Grenzen gesetzt. Prinzipiell gilt dies für beide Länder, wobei im Fall Frankreichs, vornehmlich in Paris, der Salon einen Raum bildete, in dem sich Adel und Bürgertum begegneten und Umgang miteinander pflegten.
Neben der sozial offenen Geselligkeit des Salons gab es in beiden Ländern Sozietäten, Vereine und Geheimbünde wie Freimaurer und Illuminaten, die einen Austausch zwischen den im öffentlichen Leben getrennten sozialen Sphären ermöglichten. Die knapp 700 Logen der Freimaurer umfassten 1789 in Frankreich etwa 50.000 Mitglieder, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten, vornehmlich dem gehobenen Bürgertum und dem Adel, stammten. In Brandenburg-Preußen gab es zwischen 1741 und 1781 insgesamt 43 Logen. Hamburg beispielsweise hatte gegen Ende des 18. Jahrhunderts fünf Logen, von denen eine 103 Mitglieder zählte. Diese Vielfalt der Sozietäten, aber auch der Akademien erlaubte ihren Mitgliedern einen freien, überständischen und selbst gewählten Zusammenschluss mit eigenen Statuten, so dass sie als „Schule der Demokratie“ bezeichnet worden sind.70 Ab 1790 gerieten die Geheimbünde, allen voran die Freimaurer, aufgrund von Revolutionsfurcht und Verschwörungstheorien, denen zufolge die Freimaurer den deutschen Jakobinern nahestünden, unter strenge Beobachtung. Andere Geheimgesellschaften wie die Illuminaten wurden aufgrund ihrer politischen Ziele einer klassenlosen Gesellschaft und einer republikanischen Gesellschaftsordnung bereits in den 1780er Jahren verboten, wobei während der Revolution die Verfolgung noch einmal verschärft wurde.71
Was die soziale Mobilität und Durchmischung der Stände betrifft, ist das Frankreich des späten 18. Jahrhunderts im Vergleich zu Deutschland in der Forschung wiederholt als offener dargestellt worden, da es vor allem im Kreis der Salons gelang, soziale Grenzen zu überwinden.72 Trotz der relativen Offenheit blieb einer Vielzahl gut ausgebildeter, oft literarisch aktiver Bürgerlicher der soziale Aufstieg verwehrt. So kristallisierte sich in Frankreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Gruppe „entfremdeter Intellektueller“ heraus.73 Diese rekrutierte sich vornehmlich aus Anwälten und Schriftstellern, denen aufgrund eines übersättigten literarischen und professionellen Marktes Aufstiegschancen und gesicherte Einkommen verwehrt blieben.
In Deutschland gab es einen ähnlichen Zuwachs an gut ausgebildeten, studierten Bürgerlichen. Anders als in Frankreich fanden diese oft in der wachsenden Bürokratie und Verwaltung des aufgeklärten Absolutismus ein sicheres Einkommen und sozialen Aufstieg. Im Gegensatz zu Frankreich entstand eine enge Verbindung zwischen Staat und der neuen, gebildeten Schicht bürgerlicher Verwaltungsbeamter. Dieser „verstaatlichten Intelligenz“74 stand auf französischer Seite eine größere Gruppe gegenüber, die im vorrevolutionären Prozess durch das Verfassen von antimonarchischen Schmähschriften und Flugblättern sowie in der Organisation der 1787 einberufenen Generalstände eine entscheidende Rolle spielte. Diese Gruppe hatte wesentlichen Anteil daran, dass die gesellschaftspolitischen Ziele der Aufklärung wie politische Teilhabe und die Verpflichtung der Regierung auf eine Verfassung weitere Verbreitung fanden.75
Zwar sind Begriffe wie „verstaatlichte Intelligenz“ oder „entfremdete Intellektuelle“ von der Forschung eingeführt worden, um bestimmte soziale Gruppen zu charakterisieren, aber auch den Zeitgenossen blieb der mit diesen Kategorien beschriebene Unterschied nicht verborgen. Edmund Burke, Madame de Staël und später Alexis de Tocqueville beobachteten, dass die gebildeten Schichten in Deutschland, anders als beispielsweise in England, kaum an politischen Debatten teilhatten. Deutsche Parisbesucher wiederum staunten über die Freiheit der Meinungsäußerung und über die Vielfalt von Salons und Cafés mit den dazugehörigen Zeitschriften, die eine Gegenöffentlichkeit zum Hof bildeten.76
Was die bei vielen Zeitgenossen negativ konnotierte territoriale Zersplitterung Deutschlands betrifft, ist in der Forschung wiederholt betont worden, dass die einzelnen Teilstaaten des Alten Reichs, ob Preußen unter Friedrich II., Österreich unter Joseph II., Baden oder Bayern, im Unterschied zu Frankreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Zeichen eines „aufgeklärten Absolutismus“ oder „Reformabsolutismus“ einen Modernisierungsprozess von oben eingeleitet hätten. Zu den Reformen gehörten in Bayern die 1750 erfolgte Strafrechtskodifikation und das 1758 eingeführte Zivilgesetzbuch, der „Codex Maximilianeus“. In Österreich wurde 1768 eine Strafrechtsreform durchgesetzt, eine Schulrechtsreform folgte 1774. Joseph II. erließ religiöse Toleranzpatente und dekretierte 1781 die Aufhebung der Leibeigenschaft. Baden leitete in den 1770er Jahren physiokratische Reformen ein. Friedrich II. initiierte 1784 in Preußen die Debatte um ein Allgemeines Gesetzbuch, die schließlich 1794 mit dem „Allgemeinen Landrecht“ zum Abschluss gebracht wurde.77
Die genannten Reformen sind wiederholt als Teil einer staatlichen Modernisierungspolitik betrachtet worden, die aus einer rückbetrachtenden Perspektive den Charakter einer erfolgreichen Revolutionsprävention einnehmen.78 Vergleichbare Reformen waren auch in Frankreich unter Ludwig XV. und Ludwig XVI. in den 1770er und 1780er Jahren durch Maupeou, der eine Reform der Parlamente und einen Gesetzeskodex anstrebte, und später durch Turgot in Angriff genommen worden, konnten aber gegen den Widerstand der aristokratisch dominierten parlements nicht durchgesetzt werden.79
Auch in Bezug auf die Religion waren die Kontraste zwischen beiden Ländern nur relativ. Zwar äußerten einige französische philosophes, allen voran Voltaire und La Mettrie, eine radikale Kritik an der Religion. Ein solcher Atheismus beziehungsweise Materialismus wurde im Heiligen Römischen Reich zu keinem Zeitpunkt so virulent vertreten. Jedoch existierte beiderseits des Rheins eine christliche, protestantische, mit leichter Verzögerung auch katholische Aufklärung.
Die Säkularisation der Kirchengüter, die in Frankreich infolge der constitution civile du clergé im Jahr 1790, in Deutschland im Zuge des Friedensvertrages von Lunéville 1801 und des Reichsdeputationshauptschlusses zwei Jahre später vollzogen wurde, traf die Kirche materiell wie kulturell. Sie stellte aber keinen definitiven Bruch dar. In Frankreich löste die Frage des Eids auf die constitution civile du clergé eher als die Einziehung der Kirchengüter die Opposition zahlreicher Kleriker und in Teilen der Landbevölkerung aus. Der Kontrast zwischen beiden Ländern war eher „imaginärer“ Natur. Denn das Bild eines gänzlich atheistischen Frankreichs à la Voltaire verstärkte in Deutschland die Ablehnung der Revolution zunehmend, vor allem ab 1793, und prägte die Wahrnehmung Frankreichs teilweise bis an das Ende des 19. Jahrhunderts.
Welches Fazit lässt sich aus einer knappen vergleichenden Betrachtung verschiedener Merkmale in Frankreich und Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ziehen? Was auf den ersten Blick als gegensätzlich erscheint, erweist sich im Licht von verschiedenen Merkmalen als ähnlich und vergleichbar. Beide Länder erlebten im 18. Jahrhundert einen erheblichen Bevölkerungszuwachs. Gleichzeitig kann das Jahrhundert, das der Revolution vorausging, als ein relativ wohlhabendes und ökonomisch stabiles gelten, denn Kriege und Seuchen in einem Ausmaß, wie sie noch das 17. Jahrhundert kannte, blieben aus. Beide Länder können darüber hinaus in Hinsicht auf Faktoren wie Demographie, Sprache, Traditionen oder Alphabetisierung als vielfältig und heterogen gelten.
Die Betonung der Heterogenität beider Länder, aber auch der Überlappung von Kulturräumen verdeutlicht die Problematik einer deutsch-französischen Geschichte: Die Rheinlande mit hoher Alphabetisierung, relativer wirtschaftlicher Dynamik, die früh von den Kriegen berührt und schließlich annektiert wurden, erlebten die Zeit zwischen 1789 und 1815 gänzlich anders als die später ins Empire inkorporierten Hansestädte oder die weit entfernten östlichen Gebiete der Hohenzollernmonarchie oder Österreich.80 Während weite Teile der Habsburgermonarchie und Brandenburg-Preußens die Revolution – abgesehen von militärischen Operationen – lange nur aus der Distanz wahrnahmen, waren die Rheinlande und ab 1806 der Rheinbund in ökonomischer, sprachlich-kultureller und institutioneller Hinsicht sehr viel stärker direkt mit Frankreich verflochten.81 Der unterschiedlichen Form von gegenseitiger Durchdringung und Verflechtung folgten gänzlich andere Muster von Widerstand oder Kollaboration.82
Die Identifikation von grenzüberschreitenden, transnationalen Regionen wie jenem vom nordöstlichen Frankreich über die Niederlande und entlang des Rheins verlaufenden Raums mit gemeinsamen Merkmalen wie Alphabetisierung, wirtschaftlicher Dynamik und einsetzender Urbanisierung erscheint zentral für die Erklärung, warum das napoleonische Empire später in diesem Raum, dem „inner Empire“83 Fuß fassen konnte, in anderen Regionen wie dem Schwarzwald oder dem Massif Central hingegen weitaus weniger.
Grundsätzlich ähnelte sich auch die soziale Zusammensetzung der Gesellschaft in Frankreich und Deutschland, wenngleich die soziale Ordnung in Frankreich im 18. Jahrhundert durchlässiger und eine strikte Trennung von noblesse und bourgeoisie oft kaum möglich war.84 Hier jedoch beginnen die Unterschiede zu greifen, die die Forschung in der Untersuchung der Ursachen der Revolution wiederholt betont hat. Neben anderen Gründen, die im Zusammenhang mit der Krise des Ancien Régime in Frankreich im folgenden Kapitel behandelt werden, sind hier zwei Aspekte zu betonen: zum einen die Herausbildung der „entfremdeten Intellektuellen“ mit ihrer Ablehnung der traditionellen Ordnung, der in Deutschland keine Gruppe entsprach, zum anderen der zentrale Unterschied verpasster Reformen auf französischer Seite, denen auf deutscher Seite in vielen Territorien eine Reihe von Reformmaßnahmen im späten 18. Jahrhundert gegenüberstanden.
Anders als in vielen deutschen Staaten war es der französischen Monarchie nicht gelungen, politische Institutionen zu schaffen und zu reformieren, die mit der Ständegesellschaft und neuen gesellschaftlichen Gruppen kompatibel waren.85 Das Frankreich des späten Ancien Régime befand sich bereits vor der Revolution in einer politisch-institutionellen Krise, in der Gruppen und Institutionen einander autonom und konfligierend gegenüberstanden. Dabei wirkte der Ämterverkauf, mit dem die Monarchie versuchte, der Finanzkrise zu begegnen, eher destabilisierend, als dass die neugeadelten Eliten integriert wurden. Zusätzlich bewirkte der grassierende Ämterkauf Spannungen zwischen altem und neuem Adel. Gleichzeitig wuchs die Gruppe der von Steuern Befreiten und Privilegierten. Demgegenüber betont Celia Behrens in einem der wenigen direkten Vergleiche von Frankreich und Preußen, dass es letzterem gelang – nicht zuletzt durch die Abwesenheit von Ämterkauf und restriktiver Nobilitierung –, eine erfolgreiche Synthese von Absolutismus und sich verändernden sozialen Strukturen zu schaffen. Gegenüber Frankreich gab es in Preußen ein effizientes Steuersystem und eine Verwaltungselite, die dem Staat zuarbeitete, nicht gegen ihn.86
Mit dieser Interpretation eines primär politischen Konfliktes mit dem Schwerpunkt auf Institutionen und Verwaltung, gewonnen aus einem direkten Vergleich, folgt Behrens Alfred Cobban, François Furet oder Sarah Maza. Ihnen gemeinsam ist, dass sie die marxistische und liberale Interpretation in Frage stellen, die dem Paradigma der Modernisierung folgten und in der Französischen Revolution die Kulmination eines sozialen Konfliktes zwischen privilegierter Aristokratie und Bourgeoisie sahen.87 Das Ausbleiben der Revolution auf deutscher Seite wurde umgekehrt der Schwäche des Bürgertums angerechnet. Im direkten Vergleich Frankreichs mit Preußen im 18. Jahrhundert kann Behrens darüber hinaus die Kontinuität preußischer Reformen aus der Zeit vor 1789 bis in die oft isoliert betrachtete Reformphase nach 1806 aufzeigen. Zugleich stellt Behrens in Analogie zu Alexis de Tocqueville in „L’Ancien Régime et la révolution“ die Frage, wann eigentlich die Revolution begann, und sieht die institutionelle, aber auch ideologische Krise der Monarchie lange vor 1789 einsetzen.88
35 Vgl. FAUCHOIS 1988 [687]; KUNISCH 1999 [262], S. 181–183.
36 Vgl. PLÖTNER 1989 [720].
37 Zur Integration peripherer Regionen am Beispiel der Bretagne vgl. FORD 1993 [689].
38 Vgl. beispielsweise LA ROCHE 1787 [94], 17f. Zur Wahrnehmung der Provinz vgl. GROSSER 1989 [577], S. 404–421.
39 Vgl. SCHOPENHAUER 1993 [103], S. 34, 38. [„Patois“ meint die Mundart der ländlichen Bevölkerung, Anm. BS].
40 Zur Sprachentwicklung in Frankreich vgl. WEBER 1992 [294], S. 68, 72.
41 Vgl. OZOUF 1988 [717].
42 Vgl. CERTEAU/JULIA/REVEL 1975 [821].
43 Zur Schaffung eines nationalen Kommunikationsraumes während der Revolution vgl. BALIBAR/LAPORTE 1974 [756]; VOVELLE 1992 [456], S. 177.
44 Zitiert nach MÖLLER 1994 [270], S. 68, 70.
45 STAËL 1813/1985 [105], S. 26f.
46 Andere Berechnungen ergeben eine Bevölkerung etwa 29 Millionen. Vgl. MÖLLER 1994 [270], S. 74–78.
47 Vgl. FURET/RICHET 1997 [345], S. 16; STOLLBERG-RILINGER 2000 [286], S. 45–68.
48 Vgl. DEMEL 2000 [245], S. 70–73.
49 Im Jahr 1790 lebten etwa 20 Prozent der Franzosen in Städten über 2000 Einwohnern. Vgl. JOURDAN 2003 [372], S. 320.
50 Vgl. SOBOUL 1968 [438].
51 Vgl. DE VRIES 1980 [293]; REULECKE 1985 [277]; LEPETIT 1994 [263].
52 LA ROCHE 1787 [94], S. 65. Vgl. zu diesen Aspekt STRUCK 2001 [738], S. 24–28; FARGE 1992 [686], S. 41–55.
53 Vgl. GROSSER 1989 [577], S. 359–404.
54 Die Zahlen sind lediglich ein Annäherungswert und weichen in der Forschung aufgrund der im 18. Jahrhundert noch lückenhaften Statistik teilweise erheblich voneinander ab. Zu den hier genannten Zahlen vgl. DE VRIES 1980 [293], S. 281f.
55 Vgl. LEPETIT 1994 [263].
56 Zum Problem der Geschlossenheit und Differenzierung des Adels vgl. KUNISCH 1999 [262], S. 43–46.
57 Vgl. DEMEL 2000 [245], S. 65–70.
58 Vgl. FORREST 1988 [782], S. 691–694; BERTAUD 1979 [761]. Vgl. auch unten Kap. II.3.
59 Vgl. SMETS 1996 [733], S. 715f.; KERMANN 1989 [142], S. 16.
60 Vgl. FORREST 1988 [781], S. 33f.
61 Vgl. SMETS 1996 [733], S. 738.
62 Vgl. CHARTIER 1995 [320], S. 86; FRANÇOIS 1989 [343], S. 406f.
63 REICHARDT 2002 [425], S. 266–303.
64 Vgl. CHARTIER 1997 [681].
65 Vgl. FRANÇOIS 1989 [343], S. 411–413.
66 Vgl. ROWE 2003 [722], S. 19–25, 39f.
67 Vgl. FRANÇOIS 1989 [343], S. 413.
68 Vgl. ROCHE 1989 [428], S. 397–400; WEHLER 1996 [295], S. 303–316, hier S. 303f. Zur vergleichenden Perspektive FRANÇOIS 1989 [343].
69 Vgl. CHARTIER 1995 [320].
70 Vgl. HOFFMANN 2003 [257], S. 21–34.
71 Vgl. MÖLLER 1994 [270], S. 503; STOLLBERG-RILINGER 2000 [286], S. 119.
72 Vgl. FREVERT 1989 [485], S. 263. Zu Frankreich vgl. BELL 1994 [306].
73 Vgl. CHARTIER 1995 [320], S. 225.
74 Vgl. FREVERT 1989 [485], S. 269.
75 Vgl. hierzu MORNET 1933 [406]. Anders als Chartier 1995 betont Mornet das Popularisieren der Ideen der Aufklärung als eine der wesentlichen Ursachen der Revolution, während Chartier auf die Aufklärung zweiten und dritten Ranges abzielt. Ähnlich wie Chartier greift auch Maza auf Habermas Konzept der Öffentlichkeit zurück und sieht politische Skandale, die in die Öffentlichkeit gelangten, für das Untergraben der Monarchie verantwortlich. Vgl. MAZA 1993 [841], S. 7–13.
76 Vgl. TOCQUEVILLE 1967 [166], Buch III, Kap. 1; GROSSER 1989 [577], S. 386.
77 Nach wie vor maßgeblich KOSELLECK 1967 [375].
78 Vgl. MÖLLER 1994 [270], S. 281–317; STOLLBERG-RILINGER 2000 [286], S. 194–230. Zu Österreich kritisch zum Zusammenhang von Reform „von oben“ als Revolutionsprävention vgl. WANGERMANN 1990 [458].
79 Vgl. MEYER 1990 [269], S. 489–496; DOYLE 1992 [247], S. 314–316; SWANN 2003 [740], S. 330–364; JONES 1995 [371]. Zu den parlements vgl. STONE 1986 [444].
80 Zu den Hansestädten vgl. AASLESTAD 2006 [462].
81 Vgl. jüngst zur Verfassungsgeschichte und Transfer HECKER 2005 [861].
82 Vgl. hierzu HAGEMANN 2006 [792]; ROWE (Hg.) 2003 [498]; DERS. 2006 [810]; PLANERT 2006 [719].
83 Vgl. BROERS 2001 [554]. Vgl. ausführlich unten Kap. II.4.
84 Vgl. MAZA 2003 [268].
85 Zu Historiographiegeschichte und „Revisionismus“ vgl. GRUDER 1997 [199].
86 Vgl. BEHRENS 1985 [231].
87 Vgl. FURET 1978 [193]; COBBAN 1999 [323]; MAZA 2003 [268], S. 103f. Zur Revolution als Vergleichsmaßstab vgl. unten Kap. II.4.
88 Vgl. BEHRENS 1985 [231], S. 24–40.