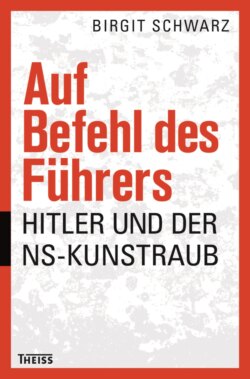Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 10
Meisterwerke der Malerei AH
ОглавлениеDie Bedeutung Haberstocks für Hitler und sein Museumsprojekt lässt sich vielleicht am besten anhand eines prachtvollen Privatdrucks zur Gemäldesammlung Hitlers ermessen: Meisterwerke der Malerei AH. Es handelt sich um zwei monumentale Bände mit eingeklebten Fotographien, auf deren roten Ledereinbänden das Signet Adolf Hitlers in Goldprägung prangt.23 Die wohl nur in wenigen Exemplaren hergestellten Folianten präsentieren im Band Neue Meister 31 Gemälde des deutschen 19. Jahrhunderts und im Band Alte Meister 27 Werke der europäischen Malerei vor 1800. Für Haberstocks Autorschaft sprechen verschiedene Indizien: Er besaß mehrere Exemplare; eines befindet sich in seinem Nachlass, das andere gab er in der letzten Kriegsphase in die Bibliothek der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Offenbar wollte er Hitlers Sammlung über die Fährnisse des Krieges hinaus dokumentiert wissen. Der Grund dafür dürfte gewesen sein, dass fast alle der darin dokumentierten Bilder von ihm selbst geliefert worden waren. Drei Gemälde kamen zwar von seiner Konkurrentin Maria Almas-Dietrich. Doch diese konnte Haberstock schwerlich ignorieren, da es sich um Ikonen der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts handelte: Böcklins Toteninsel, Feuerbachs Nanna sowie Friedrich der Große auf Reisen von Adolph von Menzel. Von anderen Händlern gelieferte Bilder kommen in den beiden Bänden nicht vor. Für die These, dass Haberstock die Auswahl aus der Sammlung Hitlers zusammengestellt hat, spricht überdies der Umstand, dass die Neuen Meister mit seinem Weihnachtsgeschenk an Hitler von 1937 einsetzen, einem Aquarell von Rudolf von Alt, Wiener Ansicht mit Stephansturm.24
Bei den alten Meistern überwiegen Gemälde dekorativen Charakters wie venezianische Frauenporträts des 16. Jahrhunderts, niederländische Stillleben des 17. Jahrhunderts, römische Architekturphantasien und venezianische Stadtansichten des 18. Jahrhunderts. Allerdings trifft man auch auf religiöse Sujets, etwa zwei italienische Madonnenbilder der Renaissance. Ausgesprochen hochrangig ist die deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts vertreten, die mit Hauptwerken von Arnold Böcklin, Franz von Defregger, Anselm Feuerbach, Hans Thoma, Hans Makart, Adolph Menzel, Moritz von Schwind, Georg Ferdinand Waldmüller und Eduard Grützner aufwarten kann.
Haberstock hat vermutlich auch die Bildkommentare verfasst, die jedem Gemälde beigegeben sind. Es handelt sich um typische Beispiele der völkischen Kunstgeschichtsschreibung jener Zeit. Sie erschöpfen sich völlig im Klischee von Volkstum und Heimatliebe, betonen im Falle Menzels dessen „Preußentum“ und im Falle Rudolf von Alts dessen „Wienertum“. Zuweilen versuchen die Texte auch, nichtdeutsche Maler einzudeutschen. Dies betrifft etwa eine so europäische Erscheinung wie den aus Venedig stammenden und in Wien, Dresden und Warschau tätigen Bernardo Bellotto, nach seinem Onkel und Lehrer auch Canaletto genannt: „Sein Auge wird im Norden immer scharfsichtiger für Linien und Luftperspektive, seine Palette immer klarer und lichter, seine Pinselführung immer detaillierter. Man darf wohl sagen, Canaletto wird immer deutscher.“ Dabei hat der Maler die genuin venezianische Vedutenmalerei des 18. Jahrhunderts in den Norden transferiert und wurde von seinen Auftraggebern gerade wegen seiner Italianità geschätzt.
Hans Makart, „Siesta am Hofe der Medici“, 1875, ehemals Gemäldesammlung Hitler, Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
Es handelt sich um nationalchauvinistische, aber nicht spezifisch nationalsozialistische Texte. Der Stand der Kunstkritik, den sie reflektieren, ist jener der Jahrhundertausstellung 1906 in der Nationalgalerie in Berlin, mit der die deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts eine Neubewertung als eine spezifisch nationale Kunst erfahren hatte. 1906 schrieb der Kunsthistoriker Richard Hamann anhand der Exponate eine dreibändige Geschichte der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts, die mehrfach in den Alben zitiert ist, obwohl Hamann als „Linker“ galt.25
Mehr Verve und Gründlichkeit zeigen die Texte dort, wo es um die Vorgeschichte der Werke geht, und darin dürfte ein spezifischer Händlerstolz zum Ausdruck kommen. Zahlreiche der von Haberstock an Hitler gelieferten Werke hatten adelige beziehungsweise berühmte Vorbesitzer. So kam der Madonnen-Tondo, der über dem Kamin in der Großen Halle des Berghofes seinen Platz fand, aus dem Besitz des Prinzen Heinrich von Preußen, einem Bruder Wilhelms II. Der Begleittext verweist auf den rückseitigen Stempel des preußischen Königshauses. Zwei Gemälde von Canaletto (er erscheint hier als Bellotto) stammten aus dem Besitz des Herzogs von Anhalt-Dessau, der Text zur Ansicht des Zwingergrabens vermerkt, dass dessen Vorfahr es als Geschenk der Zarin Katharina erhalten habe. Mehrere Bilder stammen aus alten englischen Sammlungen: Anthonis van Dycks Jupiter und Antiope aus der ehemaligen Sammlung des Earl of Coventry, Paris Bordones Venus und Amor aus der von Sir Peter Lely, einem Nachfolger von Anthonis van Dyck.26
Die beiden Bände Meisterwerke der Malerei AH repräsentieren nicht nur Hauptwerke der Sammlung, vielmehr feiern Texte und Bildauswahl Hitler auch als Kunstmäzen und den Berghof als Musenhof, indem sie etwa auf große Vorbilder verweisen: Hans Makarts Siesta am Hof der Medici von 1875 schildert das Hofleben des Lorenzo de’ Medici (1449–1492) in Florenz, „dieses großen Bewunderers und Förderers der Kunst“, als „Sammelplatz berühmter und genialer Männer, Gelehrter, Dichter und bildender Künstler“, wie im Prachtband zu lesen ist. Lorenzo erhielt wegen seines Mäzenatentums den Beinamen der Prächtige: „Junge Künstler, die als hoffnungsvoll empfohlen werden, nimmt Lorenzo in den Kreis seines Hauses auf, lässt sie im Kasino wohnen, an seiner Tafel teilnehmen, versieht sie mit Geld, erwirbt ihre Arbeiten.“ Das Gemälde war 1937 von dem Berliner Kunsthändler in den Berghof gebracht worden.
Die Fotoalben widerlegen anschaulich die vor allem von Albert Speer lancierte Vorstellung, Hitler habe vor 1939, als er den Gemäldeexperten Hans Posse als Berater gewann, lediglich eine unbedeutende Sammlung an Malerei des 19. Jahrhunderts besessen.27 Die Berghof-Kollektion ist bereits zuvor beachtlich, und ihre Qualität ist wohl hauptsächlich Haberstock zu verdanken; andererseits ist die persönliche Prägung durch Hitlers Geschmack deutlich spürbar. Die Maler Makart und Feuerbach waren schon in jungen Jahren seine Vorbilder gewesen, lange bevor er überhaupt zu sammeln begonnen hatte.28 Hitler gab also die Richtung vor und Haberstock sorgte dafür, dass sich sein Geschmack auf hohem Niveau realisieren konnte.
Giovanni Paolo Pannini, „Römische Ruinenlandschaft“, ehemals Gemäldesammlung Hitler, verschollen
Natürlich hat auch Hitler mindestens ein Exemplar des zweibändigen Prachtwerks besessen, das jedoch verschollen ist. Immerhin hat es eine Spur in der Erinnerungsliteratur des engeren Hitlerkreises hinterlassen. Hitlers Chefsekretärin Christa Schroeder verbrachte, nachdem sie dem Führerbunker und dem Berliner Inferno entronnen war, die letzten Wochen des Dritten Reiches auf dem Obersalzberg. Während dieser Zeit machte sie sich Notizen über Hitlers Kunstsammlung und legte eine Liste von Künstlernamen an, die sie in ihren Memoiren Er war mein Chef anführt. Diese Liste folgt dem Künstlerindex der Meisterwerke der Malerei-Folianten.29 Wir dürfen also davon ausgehen, dass sie die Alben benutzte und dass sich diese im Berghof befanden. In seiner dortigen Bibliothek verwahrte Hitler weitere Dokumente, die seine diversen Sammlungen präsentierten: den Fotokatalog der Gemäldegalerie Linz, das schon vorgestellte Album seiner Privatsammlung und die Bildmappen des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg, welche die „Führerauswahl“ aus den konfiszierten jüdischen Sammlungen aus Frankreich enthielten.30
Als die Prachtbände hergestellt wurden, hatte Hitler seine Hand bereits auf beschlagnahmtes Kunstgut gelegt. Demgegenüber sind die in den beiden Bänden reproduzierten Gemälde in den meisten Fällen noch regulär über den Kunsthandel erworben. Dabei profitierte Hitler jedoch mehrfach von den Zwangsverkäufen jüdischer Kunstsammler und Kunsthändler. Um zwei Beispiele anzuführen: Das Porträt der Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (1872) von Franz von Lenbach hatte Haberstock von der Wiener Galerie Neumann angekauft, die es wiederum im Wiener Pfandleih- und Auktionshaus Dorotheum erworben hatte, wo es von der Gestapo eingeliefert worden war. Es stammte aus dem Besitz des jüdischen Industriellen Bernhard Altmann, der nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich geflohen war, worauf sein Besitz beschlagnahmt und zur Begleichung der Reichsfluchtsteuer versteigert worden war. Viele Jahre befand es sich als Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland im Wallraf-Richartz-Museum in Köln, bis es 2005 an die Erben Bernhard Altmanns restituiert wurde.31
Die Römische Ruinenlandschaft, gemalt von dem venezianische Vedutenmaler Giovanni Paolo Pannini, die in der Großen Halle des Berghofes hing, dürfte aus dem Besitz des jüdischen Kunst- und Antiquitätenhändlers Jakob Oppenheimer stammen, der Deutschland bereits im Jahre 1933 verlassen hatte.32 Seine Gemälde, Möbel und Antiquitäten waren konfisziert und zu Schleuderpreisen im April 1935 in Berlin versteigert worden. Jakob Oppenheimer verstarb am 3. Juni 1941 in Nizza, seine Frau Rosa wurde nach der Besetzung der freien Zone Frankreichs verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Wie das Gemälde aus der Auktion an Hitler gelangte, ist unbekannt. Möglicherweise war Maria Almas-Dietrich daran beteiligt, die in jenen Jahren häufig auf Berliner Auktionen im Auftrag Hitlers ankaufte. Würde das verschollene Gemälde heute auftauchen, wäre es ein Restitutionsfall. Deshalb wurde es von den Erben von Jakob und Rosa Oppenheimer vor wenigen Jahren der Koordinierungsstelle in Magdeburg gemeldet und von dieser in die Datenbank lostart eingestellt.
Ungeachtet ihrer Vorgeschichte ist jedoch klar: Die Gemälde, die sich auf dem Berghof befanden, sind von Hitler gekauft und von seinem Privatkonto bezahlt worden.33 Bei den Alben handelt es sich um hochrangige Dokumente seiner Sammeltätigkeit vor der Installation des „Sonderauftrags Linz“ im Juli 1939. Die letzten in den beiden Pracht bänden verzeichneten Erwerbungen – die Ansicht des Canale Grande von Canaletto und Menzels Friedrich besucht den Maler Pense auf dem Gerüst – fanden am 16. Juni 1939 statt, zwei Tage vor der Berufung Posses zum Sonderbeauftragten für die Verteilung der Raubkunst.