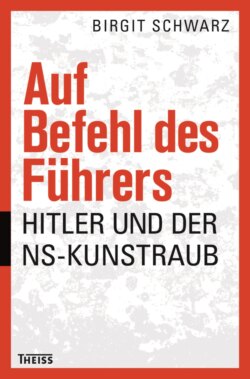Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 15
Hitler sammelt österreichisch
ОглавлениеDie Denkmalschutz-Gesetzgebung im „Altreich“ (Deutschland ohne die „Ostmark“/Österreich) war, was von österreichischer Seite immer wieder moniert wurde, weniger streng, im Sinne der Denkmalpfleger rückständig und damit schlechter als in der „Ostmark“. Die Reichsverordnung über den Schutz von Denkmalen und Kunstwerken vom 11. Dezember 1919 schützte lediglich national bedeutende Kunstwerke vor einer Ausfuhr; sie wurden auf eine sogenannte „Reichsliste“ gesetzt. Die Objekte, welche nicht auf dieser Liste standen, also der Großteil der Kunst, konnten frei exportiert werden. Aufgrund dieser Gesetzesungleichheit zwischen dem Deutschen Reich und Österreich befürchtete das Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten in Wien eine Abwanderung von Kunstgegenständen über das „Altreich“ ins Ausland.
Von dieser Problematik war auch Hitler betroffen, der nach dem „Anschluss“ seine Kunsthändler nach Wien sandte, um seine Gemäldesammlung, deren Schwerpunkt die Münchner Schule war, zu „austrifizieren“. Wenn er die Sammlung an das Landesmuseum in Linz stiften wollte, brauchte er natürlich auch bedeutende Beispiele österreichischer Malerei. Mitte Mai kam der Sachbearbeiter für Kunst und Kulturfragen im Stab von Rudolf Hess, Reichsamtsleiter Ernst Schulte-Strathaus, mit dem doppelten Auftrag nach Wien, „im höheren Auftrag“ nach Werken erstens des Führers und zweitens des Wiener Aquarellisten Rudolf von Alt Ausschau zu halten.7 Schulte-Strathaus war im Stab des Stellvertreters des Führers, Rudolf Hess, zuständig für die Sammlung und Bearbeitung der Hitler’schen Aquarelle. Während Hess’ Geburtstagsfeier am 26. April 1938 war er mit Hitler über Alt, dessen Stadtansichten Hitler als Vorbild für seine eigenen Aquarelle gedient hatten, ins Gespräch gekommen.8 Der Führer habe bedauert, so Schulte-Strathaus, dass der Künstler im Altreich so gut wie unbekannt sei, und den Wunsch geäußert, deutsche Museen möchten mehr Bilder in ihren Besitz bringen. Hier muss die Entscheidung gefallen sein, nicht nur Werke Hitlers, sondern auch des für ihn vorbildlichen Aquarellisten anzukaufen.
Am 20. Mai 1938 wandte sich Gauleiter Josef Bürckel mit der Order an die Wiener Gestapo, aus den beschlagnahmten Kunstsammlungen dürfe nichts verkauft oder abgegeben werden, bevor nicht Schulte-Strathaus die Bestände geprüft und freigegeben habe. Er habe in allen Fällen das Vorkaufsrecht. Da Österreich nach dem „Anschluss“ für eine Übergangszeit zumindest formal noch als eigener Rechtsraum existierte, galten die österreichischen Gesetze weiterhin und blieben die alten Grenzen für den Transfer von Kunstwerken von Bedeutung. Und so wies der oberste Denkmalschützer des Landes, Leodegar Petrin, das Amt des Reichsstatthalters am 27. Mai 1938 darauf hin, dass das Ausfuhrverbot auch dem Altreich gegenüber Geltung habe.9
Daraufhin stattete Hitler seine Händler und Beauftragten mit Legitimationen aus, welche das österreichische Kunstschutzgesetz unterliefen. Am 11. Juni 1938 legte Maria Almas-Dietrich der Wiener Denkmalbehörde zwei Schriftstücke vor: Das eine besagte, dass sie im Auftrag des „Führers“ reise und die von ihr ausgeführten Bilder für ihn bestimmt seien, das andere, dass sie berechtigt sei, Kunstwerke aus jüdischem Besitz zu kaufen und ohne Genehmigung des Amtes auszuführen. Über sie gingen 1938 zahlreiche aus Wien kommende Werke in Hitlers Sammlung ein. Schulte-Strathaus, legitimiert von Gauleiter Bürckel, führte ungefähr sechs große Transporte von Wien nach Berchtesgaden mit circa 200 Blättern von Rudolf von Alt, 15 Gemälde des Wiener Biedermeiermalers Ferdinand Georg Waldmüller und andere Werke zur Vorlage an Hitler aus.
Ein neues Denkmalschutzgesetz kam im „Altreich“ nicht zustande, da die Denkmalpflege – anders als in Österreich – trotz Versuchen zur „Gleichschaltung“ doch Ländersache blieb. Obwohl es nicht gelang, die Grenzen per Denkmalschutz für Kunst- und Kulturgut undurchlässig zu machen, funktionierten die Erfassung und der Entzug jüdischen Kunstbesitzes ab 1938 auch hier. Dafür sorgten die Vermögensanmeldungen, mit denen der Besitz von Kunstwerken offengelegt werden musste. Zudem wurde das Umzugsgut der zur Auswanderung gezwungenen Juden durch Devisenstellen auf seinen Wert geprüft. Befanden sich Kunstwerke darunter, wurden Museumsbeamte zur Schätzung herangezogen. In Dresden war Galeriedirektor Posse als Kunstsachverständiger tätig.10 Im November 1938 stellte die Gestapo das Vermögen des Bankiers Victor von Klemperer Edler von Klemenau sicher, des Direktors des Stammhauses der Dresdner Bank. Am 1. Dezember 1938 erschien Posse zusammen mit einem Vertreter der Gestapo und seinem Kollegen Fritz Fichtner, Fachmann für Porzellan- und Kunstgewerbe, in dessen Villa in der Tiergartenstraße, um dort die Kunstsammlungen der Familie – Inkunabeln, Porzellan und Porträtminiaturen – zu begutachten. Sie wurde den Staatlichen Sammlungen in Dresden zur Verwahrung gegeben.
Nach der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941, die das Vermögen sämtlicher ins Ausland vertriebenen Juden für verfallen erklärte, gingen die Sammlungen von Klemperer in den Besitz des Deutschen Reiches über. Reichsstatthalter Martin Mutschmann stellte im November 1942 den Antrag auf Überweisung an das Land Sachsen. Unterstützt wurde dies von einem Brief Posses an Hitler, wie immer via Bormann. Hitler entschied – wie es im Schreiben Bormanns an Lammers vom 22. November 1942 ausdrücklich heißt – „entsprechend dem Antrag Dr. Posses“.11 Danach wurden die Objekte an die sächsischen Museen übergeben.