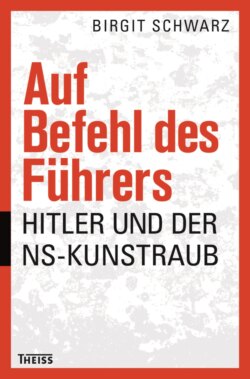Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 13
Der Sonderbeauftragte Hans Posse
ОглавлениеPosse, gebürtiger Dresdner, war 1910 im Alter von erst 31 Jahren zum Leiter der Staatlichen Gemäldegalerie in Dresden berufen worden. Nach einer Neuhängung der Alten Meister widmete er sich in den Zwanzigerjahren dem Ausbau vor allem des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.8 Er kaufte Gemälde der Dresdner Künstlergruppe „Brücke“, des österreichischen Malers Oskar Kokoschka, mit dem er befreundet war, ein abstraktes Gemälde von Kandinsky und vor allem das Kriegsbild des Schützengrabens von Otto Dix, jenes Gemälde, das ab 1933 im Zentrum verschiedener Ausstellungen „entarteter Kunst“ stehen sollte. Als Kurator des Deutschen Pavillons auf zwei Biennalen in Venedig (1922 und 1930) und mit der Internationalen Kunstausstellung 1926 in Dresden präsentierte er die Avantgarde als die gültige deutsche Kunst. Das setzte ihn dem Hass national-konservativer und nationalsozialistischer Künstler aus.
1933 wurde Posses Position prekär, doch konnte er sich dank seiner großen Reputation und weil das Kultusministerium noch nicht „gleichgeschaltet“ war, vielleicht auch wegen guter Kontakte in nationalsozialistische Kreise hinein im Amt halten. Als Glück stellte sich für ihn heraus, dass sein Ankaufsetat während der fraglichen Jahre miserabel gewesen war. Deshalb hatte er bei seinen Käufen die Unterstützung eines Galeriehilfsvereins, des Patronatsvereins, in Anspruch nehmen müssen. Der Patronatsverein kaufte die modernen Werke an und diese gingen dann erst nach einer Frist von zehn Jahren in den Besitz der Gemäldegalerie über. So konnte sich Posse 1933 zunächst damit herausreden, dass das Gros der Avantgarde-Kunst gar nicht der Galerie gehöre. Er verfasste ein vermutlich an das Ministerium gerichtetes Rechtfertigungsschreiben, in dem er nur für einige expressionistische Gemälde die Verantwortung übernahm, die er Anfang der Zwanzigerjahre erworben hatte. Als Grund für den Erwerb gab er an: „lokale Kunstpflege“.9 Selbstverständlich waren die Ankäufe des Patronatsvereins Ankäufe Posses, in die er viel Zeit und Energie gesteckt hatte. Posse nannte diesen Bestand „Vorgalerie“.10
Ein richtungsweisendes Schlüsselereignis der NS-Kulturpolitik war die Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ 1937 in München, denn mit ihr und der parallel dazu stattfindenden ersten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ schaltete sich Hitler persönlich ein und stellte klar, welche Kunst erwünscht und welche unerwünscht war. Mit den beiden Veranstaltungen legte sich die NS-Kunstpolitik nach einem Schlingerkurs in den Jahren zuvor endgültig auf „antimodern“ fest. Als unmittelbare Folge ging eine Säuberungswelle durch die deutschen Museen, die Tausende Kunstwerke mit sich riss. Auch die Dresdner Gemäldegalerie blieb vom Bildersturm nicht verschont: Im Dezember 1937 wurden mehr als 50 Gemälde beschlagnahmt.
In der Münchner „Entarteten“-Schau standen nicht nur die modernen Kunstwerke und ihre Schöpfer am Pranger, sondern explizit auch die Händler und Museumsdirektoren, die sich für die Moderne eingesetzt hatten. Am 7. März 1938 wurde Posse ins inzwischen „gleichgeschaltete“ Sächsische Ministerium für Volksbildung beordert, wo man ihm nahelegte, seine Versetzung in den dauernden Ruhestand zu beantragen, eine gebräuchliche Methode, Aufsehen um Entlassungen bei renommierten Personen zu vermeiden. Am 12. März 1938 reichte der Sechzigjährige sein Pensionierungsgesuch ein, fünf Tage darauf wurde ihm der sofortige Antritt seines Erholungsurlaubes genehmigt.
Überraschenderweise arbeitete er am 19. April jedoch wieder in der Galerie, und zwar im Auftrag des Ministeriums, das ihn kurz zuvor zur Abdankung gezwungen hatte. Grund war, dass die zweite „Dresdner Museumswoche“ kurz bevorstand, ein im Vorjahr nicht zuletzt dank einer von Posse veranstalteten Cranach-Ausstellung höchst erfolgreich initiiertes nationalsozialistisches Kulturprojekt. Auch dieses Jahr wollte und konnte man auf Posses organisatorische und kuratorische Kompetenz nicht verzichten. Da sein Pensionsantrag noch bearbeitet wurde, er also noch nicht im Ruhestand war, hatte ihn das Ministerium mit dem Aufbau der Ausstellung „Deutsche Kunst vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“ beauftragt, allerdings war er vorher von seiner Leitungsfunktion entbunden worden.
Die Ausstellung öffnete am 11. Juni 1938 ihre Tore. Eine Woche später, am 18. Juni 1938, erschien Hitler persönlich in der Dresdner Galerie, begleitet von Reichsleiter Bormann, und ließ sich von Posse durch die Sammlung führen; wir sind über den Vorgang durch Posses Diensttagebuch unterrichtet. Erst besichtigte man die Altmeister im Semperbau, wo Hitler besonderes Interesse für das große Gemälde Neptun und Amphitrite des venezianischen Malers Giovanni Battista Tiepolo zeigte. Er erkundigte sich nach Posses Erwerbungen und Erwerbungsmitteln. Posse notierte seine Antwort im Tagebuch: „7500 vor dem Krieg, nichts, Inflation, nur 1926–1928 größere Mittel, seitdem wieder nichts.“ Der Erwerb des Tiepolo-Gemäldes war 1928 durch Sondermittel des Ministeriums ermöglicht worden.
Hitler in der Dresdner Gemäldegalerie, 18. Juni 1938
War Hitlers Interesse an dem Tiepolo taktischer Natur, etwa in dem Sinne, dass er dem Dresdner Galeriedirektor Gelegenheit geben wollte, seine Leistungen herauszustreichen? Das würde voraussetzen, dass er sich sehr gut auf die Führung vorbereitet hätte. Hitlers Fragenkatalog, so wie er sich aus Posses Aufzeichnungen rekonstruieren lässt, legt dies durchaus nahe; möglicherweise hatte der mit der Dresdner Ankaufspolitik vertraute Haberstock ihn entsprechend vorinformiert. Doch wie wir von Ranuccio Bianchi Bandinelli, Hitlers italienischem „Cicerone“ wissen, hatte Hitler ein Faible für die italienische Barockmalerei. Er besaß Gemälde von Canaletto und Pannini und hatte kurz zuvor zwei Tiepolos angekauft. Als Sammler konnte er sich also von Posses Ankaufspolitik durchaus bestätigt fühlen.
Im Anschluss begab man sich in die Deutsche Abteilung, bei der es sich um die soeben von Posse aufgebaute Ausstellung handelte, die als Dauereinrichtung bestehen bleiben sollte. Deren Schwerpunkt bildete die Malerei um 1500, vor allem der hervorragende Dresdner Cranach-Bestand. Hitler ging die Abteilung sehr genau durch. Posse hatte in den Zwanzigerjahren wichtige Gemälde des sächsischen Hofmalers Lucas Cranach erwerben können. Wieder ergaben sich eklatante Übereinstimmungen mit Hitlers eigener Sammeltätigkeit, der Ende 1937 ein Bildnispaar Martin Luthers und seiner Frau Katharina von Bora, gemalt von Lucas Cranach, erworben hatte und der eine große, bedeutende Venusdarstellung des Malers in seiner Münchner Wohnung hängen hatte.11 Posse konnte sich hier von seiner im Sinne des Nationalsozialismus besten Seite zeigen, nämlich als Museumsmann, der sich besonders für die deutsche Kunst einsetzte. Selbstverständlich vergaß er nicht darauf hinzuweisen, dass der Aufbau der deutschen Abteilung ein alter Plan von ihm gewesen sei, der eigentlich einen Erweiterungsbau notwendig gemacht hätte. Damit sprach Posse Planungen für einen Galerie-Neubau in unmittelbarer Nähe zum Altbau an, der sein Lebensziel war, aber von den politischen Entscheidungsträgern seit Jahrzehnten aus finanziellen und politischen Gründen immer wieder auf Eis gelegt worden war.
Am Ende der Führung erkundigte sich Hitler nach der Galerie des 19. Jahrhunderts, die Posse 1931 auf der Brühlschen Terrasse eröffnet hatte. Dort war unter anderem die großartige, ganz überwiegend von Posse aufgebaute Romantiker-Sammlung ausgestellt. Einen Schwerpunkt bildete Caspar David Friedrich, den auch Hitler hoch schätzte, mit seinem Hauptwerk Das Kreuz im Gebirge.
Lucas Cranach d.Ä., „Der Honigdieb“, ehemals Gemäldesammlung Hitler, National Gallery, London
Posse hatte Hitler zweifellos beeindruckt: Der kunstbesessene Diktator erkannte in ihm die von Haberstock soufflierte „Führerpersönlichkeit“ unter den deutschen Museumsdirektoren, wie er sie für den Aufbau seiner Gemäldegalerie brauchte. Und da der „Führerwille“ entscheidend war, spielte es fortan auch keine Rolle mehr, dass der Dresdner Museumsdirektor kein Parteimitglied war. Immerhin hatte er ja im April 1933 – zur gleichen Zeit, als er massiven Angriffen durch lokale NS-Parteigrößen ausgesetzt war – den Antrag zur Aufnahme in die NSDAP gestellt; im Dezember 1933 – nach Klärung der gegen ihn geäußerten Vorwürfe – hatte er auch die Interimskarte erhalten. Die endgültige Aufnahme wussten seine lokalen Widersacher jedoch zu verhindern.
Die fehlende Parteimitgliedschaft ist jedoch weniger erstaunlich als der Umstand, dass Hitler über Posses Engagement für die abgrundtief gehasste Avantgarde hinwegsah. Offenbar wollte er gerade diesen Mann für sein Museumsprojekt gewinnen, vermutlich weil er hoffte, in ihm den Wilhelm von Bode des Dritten Reiches gefunden zu haben. Bode, der Generaldirektor der preußischen Kunstsammlungen, auch als der „Bismarck der Museen“ bekannt, hatte die Berliner Museen um die Jahrhundertwende zu einem repräsentativen Museumskomplex ausgebaut: Die Museumsinsel ist ganz überwiegend sein Werk. Posse galt als Lieblingsschüler Bodes, er soll seinem Lehrer äußerlich geähnelt und „seine rasch zupackende, schlagfertige, oft sarkastische Art“ mit ihm geteilt haben, wie noch der offizielle Nachruf auf Posse betonen sollte. Vermutlich hat Haberstock, der mit Bode befreundet gewesen war, Hitler auf dieses nahe Verhältnis hingewiesen.
Hitlers Besuch in der Dresdner Gemäldegalerie sollte Schlüsselfunktion für das Linzer Museumsprojekt erlangen. Die weltberühmten Altmeister im Semperbau, die neu eingerichtete deutsche Abteilung sowie das Neubauprojekt der Gemäldegalerie hatten seiner Linz-Vision Gestalt gegeben. Offenbar war er nach seinem Zusammentreffen mit Posse überzeugt davon, mit diesem den Experten gefunden zu haben, der ihm seine Linzer Gemäldegalerie zusammenstellen würde, und zwar nicht nur mit Gemälden des 19. Jahrhunderts, sondern auch mit Altmeistern.
Woher er diese Altmeister beziehen wollte, stand für ihn ebenfalls fest: aus den beschlagnahmten jüdischen Kunstsammlungen in Wien. Von Dresden flog Hitler zurück nach Berlin und gab umgehend den „Führervorbehalt“ beim Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, in Auftrag. Dieser versandte also das bereits zitierte Rundschreiben am 18. Juni 1938 im Auftrag Hitlers an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, den Reichsminister des Innern, Wilhelm Frick, den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, an den Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, Josef Bürckel, sowie den Reichsstatthalter in Österreich, Arthur Seyß-Inquart. Hitler erwähnte im „Führervorbehalt“ sein eigenes Museumsprojekt nicht, sondern kündete ein großes Verteilungsprojekt von Raubkunst auf die „kleineren“ österreichischen Museen an und meinte damit die Provinzmuseen, darunter sein Linzer Museumsprojekt!
Hitler ließ sich die Personalakten Posses auf den Obersalzberg schicken. Am 22. Juli 1938 wurde der kaltgestellte Museumsdirektor erneut ins Sächsische Ministerium für Volksbildung bestellt. Diesmal empfing ihn der Leiter Arthur Göpfert lächelnd – wie Posse in sein Tagebuch notierte – und eröffnete ihm, dass er wieder in sein Amt eingesetzt und dafür gesorgt werde, dass in Zukunft keine Angriffe mehr gegen ihn gerichtet würden – „auf Befehl des Führers“. Nachmittags erschien Göpfert sogar höchstpersönlich in der Galerie, um Posse vor der versammelten Museumsbelegschaft des Vertrauens der Regierung zu versichern. Am 2. August verfasste der wieder eingesetzte Museumsdirektor ein Dankesschreiben an Bormann:
„Sehr geehrter Herr Reichsleiter, auf Veranlassung des Führers bin ich am 22. Juli durch den Herrn Leiter des Ministeriums für Volksbildung wieder in mein Amt als Direktor der Staatlichen Gemäldegalerie eingesetzt worden. Ich bin unendlich glücklich darüber, mich auch weiterhin einem von mir als Lebensaufgabe betrachteten Werk, der Arbeit an einer der schönsten Galerien Europas und einem der bedeutendsten Monumente deutschen Kulturwillens widmen zu dürfen. Darf ich Sie, sehr geehrter Herr Reichsleiter, bitten, den Führer meines tiefsten und verehrungsvollsten Dankes versichern zu wollen. Heil Hitler!“12
Wir dürfen davon ausgehen, dass dies keine Floskeln waren. Posse war Hitler offenbar persönlich dankbar, denn dieser hatte ihn nicht nur rehabilitiert, er hatte ihm sogar einen vollkommenen Triumph über seine Nazi-Gegner verschafft. Deren langjähriger Agent Galerieinspektor Anders, der ihm das Leben schwer gemacht hatte, indem er Interna aus der Galerie an die Partei weitergegeben hatte, wurde entlassen. Nach langen Jahren war Posse wieder uneingeschränkter Herr im eigenen Haus.