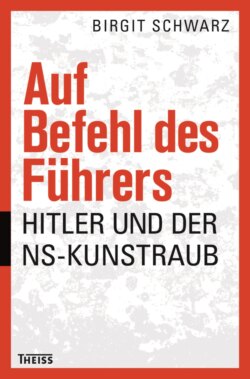Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеHitler war nicht nur die zentrale Figur des „Dritten Reiches“, sondern auch die zentrale Figur des NS-Kunstraubs, der ganz Europa erfasste und dessen Folgen bis heute die Museums- und Kunstwelt erschüttern. Anders als im Fall des Holocaust, wo ein zentraler schriftlicher Befehl Hitlers fehlt, gibt es einen solchen für den Kunstraub: den „Führervorbehalt“. In diesem Schlüsseldokument zum NS-Kunstraub räumte sich Hitler das Vorrecht ein, persönlich die Entscheidung über die Verwendung eines jeden beschlagnahmten Kunstwerkes von Museumsrang zu treffen, um es auf Museen des „Großdeutschen Reiches“ zu verteilen. Der „Führervorbehalt“ ist kein Beschlagnahmebefehl, sondern formuliert einen Verwertungsanspruch. Hitler legte ganz bewusst eine Distanz zwischen sich und den Vorgang des Raubes. Obwohl die Beschlagnahmen auf Befehlen Hitlers basieren, durfte nicht in seinem Namen beschlagnahmt werden. Er griff erst zu, nachdem die Kunstwerke im Namen des Deutschen Reiches eingezogen worden waren.
Zur operativen Durchführung seiner Kunstraubpolitik setzte Hitler 1939 einen renommierten Museumskunsthistoriker ein: Hans Posse, Direktor der Dresdner Gemäldegalerie. Er hatte die Aufgabe, den Raubzug im Sinne des Verteilungsprogramms zu steuern und Hitlers Zuweisungen an die deutschen Museen vorzubereiten. Posse beriet den „Führer“, welche Werke und Sammlungen in den besetzten Ländern sich für das Programm eigneten. Hitler sorgte daraufhin für entsprechende Beschlagnahmebefehle und ließ den „Führervorbehalt“ auf die gewünschten Bestände erweitern. Posses Einfluss ging erkennbar über das Operative hinaus. Er war Hitlers Dämon, der seinen Auftraggeber antrieb und den Kunstraub radikalisierte. In welchem Umfang Posse die Plünderung Europas gesteuert hat, war bisher unbekannt, da der Kunstraub Geheimstatus hatte und von Hitler und Posse vor allem mündlich verhandelt wurde.
Der Geheimstatus hatte zur Folge, dass Hans Posse vor allem als Einkäufer für Hitlers Lieblingsprojekt, das geplante „Führermuseum“ in Linz, in die Geschichte eingegangen ist. Als solchen hat ihn die NS-Propaganda nach seinem Tod Ende 1942 in Szene gesetzt und damit die Wahrnehmung der Historiker bis heute geprägt. Parallel dazu entwickelte sich ein entsprechendes Bild von Hitler als manischen Sammler, der für sein Linzer Museum keine Ausgaben scheute, in Angelegenheit des Kunstraubes aber nicht recht zum Zug kam. Unablässig werden Behauptungen wiederholt, Hitler sei als Kunsträuber zu spät gekommen, sein Sonderbeauftragter Posse habe die beschlagnahmten jüdischen Kunstsammlungen in Frankreich ignoriert und am beschlagnahmten Kunstbesitz Polens, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion wenig Interesse gezeigt. Im Konkurrenzkampf der diversen Kunstrauborganisationen sei der angeblich skrupulöse Posse gar eine Randfigur gewesen, Hitlers Machtsystem habe hier letztlich versagt.
Dieser Fehleinschätzung, die bis heute in der Forschung verbreitet ist, setzt das vorliegende Buch einen facettenreichen und neuen Einblick in die Struktur des NS-Kunstraubes entgegen. Dabei werden Hitlers und Posses tatsächliche Rollen im NS-Kunstraub deutlich. Die Darstellung der Ereignisse orientiert sich am Kriegsverlauf und gibt einen Überblick über die Vorgänge in den einzelnen Ländern. Sie beschreibt, nach welchen Mustern diese gestaltet und wie sie gelenkt wurden. Der Blick wendet sich vom Linzer „Führermuseum“ ab, das im Nachhinein von den am Kunstraub beteiligten Kunsthistorikern zu ihrer eigenen Entlastung instrumentalisiert wurde, und richtet sich stattdessen auf die politische Bedeutung einer regelrechten Raubpolitik. In deren Zentrum steht die Person Hitlers, denn er hat den NS-Kunstraub nicht nur erfunden, sondern auch die Plünderung des europäischen Kunstbesitzes mithilfe des „Führervorbehalts“ in seinem Sinne gelenkt. Damit schreibt das vorliegende Buch die Geschichte des NS-Kunstraubes als Geschichte von Hitlers Kunstraub neu.