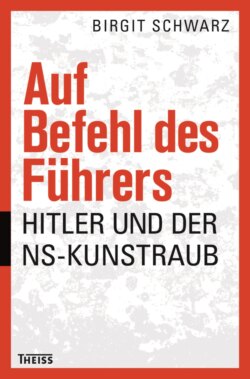Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 14
4.
Kunstraub in Österreich Vom Vermögensentzug zum Kunstraub
ОглавлениеSeit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden jüdische Mitbürger systematisch entrechtet und enteignet. Erst wurde ihnen die Staatsbürgerschaft und damit die legale Existenzgrundlage, dann durch Berufsverbote und Entlassungen die wirtschaftliche Existenzbasis entzogen. Zunehmend griff der NS-Staat auch mit Sondersteuern auf jüdische Vermögen zu. Personen, die sich zur Ausreise entschlossen, unterlagen der sogenannten „Reichsfluchtsteuer“, die bei Verlassen des Deutschen Reiches entrichtet werden musste.
Unter dem durch Berufsverbote und Zwangsabgaben erzeugten wirtschaftlichen Druck wurden jüdische Privatsammler und Kunsthändler gezwungen, sich von ihrem Kunstbesitz zu trennen. Es wurden sogenannte „Judenauktionen“ veranstaltet; ihr Zentrum war Berlin. In der jungen, dynamischen Hauptstadt des Deutschen Reiches hatten sich viele jüdische Kunsthändler etablieren können. Das Reichskulturkammergesetz vom September 1933 verpflichtete sie zur Mitgliedschaft, enthielt aber keinen „Arierparagraphen“, sodass sie zunächst aufgenommen wurden. Da sich viele von ihnen noch nicht von den Folgen der Weltwirtschaftskrise erholt hatten, trafen sie der zunehmende Antisemitismus in der Bevölkerung und die sich verschärfende judenfeindliche Gesetzgebung besonders hart. Viele lösten ihre Geschäfte auf, um auszuwandern. Ab Mai 1936 wurde von den Mitgliedern der Reichskulturkammer ein „Ariernachweis“ verlangt, im Februar 1938 den jüdischen Kunsthändlern generell die Berufsausübung untersagt. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ Österreichs an das Deutsche Reich war der jüdische Kunsthandel in Deutschland ausgeschaltet und die jüdischen Kunstsammlungen entweder ins Ausland verbracht oder „arisiert“. Jüdischen Kunstbesitz gab es nur noch wenig.
Die allgemeinen antijüdischen Maßnahmen radikalisierten sich mit dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Schon einen Monat später wurde die Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden erlassen: Alle Personen, die von den Nationalsozialisten mit dem ersten Reichsbürgergesetz von 1935 als Juden definiert waren, sowie deren Ehegatten wurden verpflichtet, ihr gesamtes in- und ausländisches Vermögen und Einkommen zu bewerten und – sofern es 5000 Reichsmark überstieg – anzumelden. Im November 1939 kam noch die sogenannte „Sühneabgabe“ hinzu: Den „Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit“ wurde nach der Ermordung des deutschen Diplomaten Ernst vom Rath durch Herschel Grynszpan in Paris die Zahlung einer Kontribution von einer Milliarde Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt. Mit der Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 wurden die Vermögen dann der Verfügungsgewalt ihrer Eigentümer praktisch entzogen.
Für Kunstwerke hatten innerhalb des Vermögensentzugs bis zum „Anschluss“ Österreichs keine Sonderregeln gegolten: Sie wurden liquidiert und „arisiert“. Ihr Kunstwert spielte dabei nur insofern eine Rolle, als er sich im Marktwert niederschlug: Ein Rembrandt war nicht als Rembrandt von Interesse, sondern als ein hoher Vermögenswert. In Österreich setzten erstmalig spezifische Regelungen ein, deren wichtigste Hitlers „Führervorbehalt“ vom 18. Juni 1938 war. Damit vollzog der „Führer“ höchstpersönlich und allein durch den „Führerwillen“ legitimiert einen grundlegenden Paradigmenwechsel bei der Verwertung jüdischen Vermögens: Ab diesem Zeitpunkt sollten hochrangige Kunstwerke nicht mehr verkauft, sondern den Museen des Großdeutschen Reiches kostenlos zugewiesen werden. Nach der Reichspogromnacht (vom 9. auf den 10. November 1938) setzten weitere spezifische Kunstverfügungen ein: Die Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 bestimmte in Artikel IV Juwelen, Schmuck und Kunstgegenstände, dass Kunstgegenstände im Wert über 1000 Reichsmark nur an staatliche Abgabestellen, die den Preis selbst festlegten, verkauft werden durften.1 Damit war jüdischen Mitbürgern der freie Verkauf ihrer Kunstwerke und Schmuckstücke verboten, der NS-Staat hatte das alleinige Ankaufsrecht. Selbst die 1000-Reichsmark-Begrenzung fiel im Mai 1941.
Für den Paradigmenwechsel von Vermögens- zu Kunstwerten waren in Österreich – anders als im Deutschen Reich – durch das Kunst-Ausfuhrverbotsgesetz von 1923 die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben.2 Dieses Gesetz bot optimale Bedingungen für den NS-Kunstraub. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie, als die junge österreichische Republik fürchten musste, finanziell und kulturell auszubluten, war das Ausfuhrverbot für Kunstgegenstände in Kraft getreten. Es wurde 1923 novelliert und gilt prinzipiell bis heute. Das Gesetz ermächtigte das staatliche Denkmalamt, Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer und kultureller Bedeutung unter Schutz zu stellen und ihre Ausfuhr zu verbieten, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.
Das Ausfuhrverbotsgesetz galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als außerordentlich fortschrittlich und als eine große Errungenschaft im Sinne des Denkmalschutzes. Es stand in einer langen historischen Entwicklungslinie, die – ausgehend von der Aufklärung – Kunstwerke als nationalen Kunstbesitz begriff. Die Französische Revolution hatte Kunstwerke aus Adels- und Kirchenbesitz in einem durchaus gewaltsamen Prozess der Nation in Museen zugänglich gemacht, Napoleon auf seinen Kriegszügen systematischen Kunstraub betreiben lassen. Damit einher ging eine wissenschaftliche Bearbeitung der Kunst. In diesem historischen Kontext entstanden sowohl die Kunstgeschichte als Wissenschaft als auch die Institution des Museums als wissenschaftliche und öffentliche Anstalt. Gleichzeitig wuchs im Kampf mit Napoleon in den europäischen Ländern das Bewusstsein um die nationale Identität. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass die von den französischen Truppen geraubten Kunstwerke Teil der „eigenen nationalen Identität waren und damit unverzichtbar die kulturelle Identität der Nation veranschaulichten“.3 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also hundert Jahre nach Beginn dieses Prozesses, schien es eine historische Gesetzlichkeit, dass der gesamte Kunstbestand als Eigentum der Nation irgendwann in Museen öffentlich zugänglich sein würde. Die Verstaatlichungen adligen Kunstbesitzes nach der russischen Oktoberrevolution wirkte alles in allem wie eine Bestätigung, auch wenn die Bolschewiki Teile davon ans Ausland verkauften.
Die als Errungenschaft noch ganz neue staatliche Denkmalpflege legitimiert sich über diese Vorstellung einer überpersönlichen, nationalen Bedeutung von Kunst und hatte dadurch per se einen gewissen Zwangscharakter. Zwei Gründerväter und Heroen der Denkmalpflege – der Österreicher Alois Riegl und der Deutsche Georg Dehio – haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts den sozialistischen Charakter des Denkmals betont. Nach dieser Auffassung kann ein Denkmal auch enteignet werden, egal ob es sich dabei um ein Gebäude oder eine Kunstsammlung handelt. Auch das österreichische Ausfuhrverbotsgesetz sah und sieht Zwangsmaßnahmen vor: Denkmalämter und staatliche Kunstinstitute wie Museen konnten und können Sicherstellungen durch die Polizei veranlassen. Mit dem „Anschluss“, als viele Juden fluchtartig das Land verließen, kam es in Österreich zu einer Situation, in der die Denkmalschützer einen unkontrollierten Abfluss von Kunst ins Ausland fürchten mussten. In der Folge wurde sozusagen flächendeckend sichergestellt.
Am 17. März 1938, also nur vier Tage nach dem „Anschluss“, ließ das Kunsthistorische Museum die Kunstsammlung des jüdischen Industriellen Oskar Bondy in Wien sicherstellen. Bondy befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Tschechoslowakei, wo er Zuckerfabriken besaß. Seine Wiener Wohnung wurde versiegelt, die Sicherstellung seiner umfangreichen Kollektion vor allem österreichischen Kunstgewerbes wurde 1938/39 in drei Etappen durchgeführt, die Sammlung vom zuständigen Denkmalamt, der Zentralstelle für Denkmalschutz, mit einer Ausfuhrsperre belegt.4
Die Zielrichtung des Ausfuhrverbotsgesetzes war ursprünglich weder politisch noch antisemitisch. Durch die antijüdische Politik des NS-Staates wurde das Gesetz in seiner Anwendung indes zu einem antijüdischen Gesetz. Denn es waren vor allem Juden, die zur Auswanderung gezwungen wurden und deshalb ihren Hausrat auf Kunstwerke hin kontrollieren lassen mussten. Allein in den Jahren 1938 und 1939, mit dem ersten großen jüdischen Exitus, gab es bei der Zentralstelle für Denkmalschutz in Wien rund 16 500 Ansuchen um Ausfuhrgenehmigungen. In sogenannten „Hausbeschauen“ stellten die Fachleute auf der Grundlage des Ausfuhrverbotsgesetztes fest, was im Haus rat tatsächlich als Kunstwerk zu gelten hatte. Da das Gros der jüdischen Einwohner Österreichs in Wien lebte, konzentrierten sich die Hausbeschauen dort. Es wurden so viele Anträge auf Ausfuhr gestellt, dass Denkmalpfleger aus den Ländern zur Unterstützung der lokalen Kräfte beordert wurden. Ein Bericht des Kärntner Denkmalpflegers Walter Frodl aus der Nachkriegszeit gibt einen Einblick in die Praxis: „So verbrachte ich nun während des Sommers und Herbstes einige Wochen in Wien, tagsüber in einem Taxi durch die Bezirke fahrend.“ Frodl gab an, angewidert von der Arbeit gewesen zu sein; er habe kein einziges Objekt zurückgehalten. Solche Aussagen lassen sich im Nachhinein nicht überprüfen. Da aber jede Wohnung besichtigt werden musste, wenn – so Frodl – „auch nur ein Fleckerlteppich, ein Stickereibild und die Fotographie der Großeltern den ‚Kunstbesitz‘ bildeten“, bestand in den meisten Fällen auch kein Grund für Sicherstellungen.5
Ein weiterer Bericht des Denkmalamtes resümiert: „Insgesamt wurden bis Ende 1938 nicht weniger als 9500 Hausbeschauen vorgenommen. Hiebei wurden viele tausende Kunstgegenstände und andere kulturell wertvolle Objekte (Musikmanuskripte, Archivalien, Autographen etc.) von der Ausfuhr zurückgestellt.“6 Der Berichterstatter führte aus, es seien darüber hinaus „Sicherstellungen vor Ort“ und „Sicherstellungen verbunden mit der Verbringung in Gewahrsam eines öffentlichen Museums“ durchgeführt worden. Eine Reihe von großen Sammlungen und Hunderte von Einzelobjekten seien so zurückgehalten, Objekte geringeren Wertes aber freigegeben worden.
Mit den Sicherstellungen war zunächst kein Vermögensentzug verbunden, nach Überprüfung konnte alles zur Ausfuhr freigegeben werden. Dies ist zum Beispiel bei Sigmund Freud geschehen, der seine an die 3000 Objekte umfassende Antikensammlung mit ins Londoner Exil nehmen durfte. Mit Händen zu greifen ist die Willkür in der Durchführung des Gesetzes, dessen Kriterien sehr offen angelegt waren, sodass Denkmalpfleger mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken entscheiden konnten. Und hier kam natürlich die eigene politische Einstellung ins Spiel. Der in diesem Zusammenhang immer wieder verwendete Begriff „Verschiebung“ kriminalisiert schon die Ausfuhrabsicht und zeigt sehr deutlich, wie schnell sich die Rechtsvorstellungen verbogen hatten.
Um die Spirale einer immer tiefer gehenden Verstrickung des Denkmalamtes und der Museen in den NS-Kunstraub verstehen zu können, muss man sich klarmachen, dass sich der „Führervorbehalt“ mit dem österreichischen Ausfuhrverbotsgesetz in einem Ziel deckt, nämlich dem Staat Kunstgut, das als national wichtig angesehen wurde, zu erhalten und der Öffentlichkeit in Museen zur Verfügung zu stellen. Zwar kam Hitler als Kunstsammler selbst – wie wir noch sehen werden – mit dem österreichischen Ausfuhrverbot in Konflikt und traf mit seinem förderalistischen Kunstverteilungsprogramm auf den Widerstand der Wiener Museen. Dennoch kam der Umstand, dass in Österreich Museen und Denkmalämter Kunstwerke sicherstellen und dann einziehen lassen konnten, seinen Plänen ganz grundsätzlich entgegen: Zum einen führten hier Experten die Selektion der „hochrangigen Kunst“ durch, der Museumskunst, auf die es ihm ankam. Zum anderen erlaubten es ihm diese Institutionen, einen scheinlegalen Mantel über seinen Raub zu breiten. Letzteres war Hitler außerordentlich wichtig, denn sein Name durfte im ganzen Kontext des Raubes nicht auftauchen, wie die diversen Ausführungen des „Führervorbehaltes“ geradezu mantraartig wiederholen.