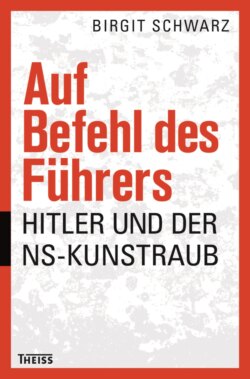Читать книгу Auf Befehl des Führers - Birgit Schwarz - Страница 16
Das Denkmalamt als Kollaborateur
ОглавлениеIm Laufe des Septembers 1938 wurde die Zentralstelle für Denkmalschutz in Wien „gleichgeschaltet“ und ihr Präsident Lodegar Petrin zwangspensioniert. Herbert Seiberl, der jüngste Mitarbeiter des Denkmalamtes, stieg zu dessen kommissarischem Leiter auf. Seiberl war Parteimitglied, beschäftigte indes Mitarbeiter, die dem NS-Regime missliebig waren und den Anforderungen der Nürnberger Gesetze nicht entsprachen; gleichwohl passte Seiberl hervorragend in das Muster, nach dem Hitler die Leitungsfunktionen seines Kunstapparates besetzen ließ. Wie weitere Hauptfiguren seines Kunstraubes, etwa Hans Posse, Heinrich Hoffmann, Alfred Rosenberg und Kajetan Mühlmann, war Seiberl ein verhinderter Maler und fühlte sich als Künstler. Er hatte eine Ausbildung als akademischer Maler absolviert, hatte diesen Berufstraum aber – wie Posse – zugunsten einer kunsthistorischen Ausbildung aufgegeben.12
Am 20. November 1938 trat in der „Ostmark“ die Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens in Kraft, der zufolge der Reichsstatthalter in Wien oder die von ihm bestimmten Stellen Vermögen von Personen oder Personenvereinigungen, die volks- oder staatsfeindliche Bestrebungen gefördert hatten, zugunsten des Landes Österreichs einziehen konnten.13 Damit gab es neben einer Gesetzesgrundlage für die Sicherstellung von Kunstwerken auch eine Gesetzesgrundlage für deren Aneignung, mithin war der staatliche Kunstraub legistisch installiert. Die meisten Sammlungen, die unter dem Ausfuhrverbotsgesetz festgehalten waren, wurden nun eingezogen, das Denkmalamt zum 1. Dezember 1938 mit der Bearbeitung der davon betroffenen Kunstwerke betraut. Die Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 ging bei der Zentralstelle mit der Bitte ein, bei der Handhabung der Denkmalschutzbestimmungen „möglichste Strenge walten zu lassen, um die Juden zum Verkauf ihres Kunstbesitzes an die zu errichtende Reichstelle zu zwingen“. Herbert Seiberl beruhigte, sein Amt beschränke sich nicht nur darauf,
Verordnung für die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 18. November 1938, Bundesdenkmalamt Wien, Archiv
„für Kunstgegenstände, an deren Erhaltung innerhalb des Deutsches Reiches ein öffentliches Interesse besteht, keine Ausfuhrfuhrbewilligung zu erteilen, sondern sie lässt auch in allen jenen Fällen, in welchen der leiseste Verdacht einer Verschleppungsgefahr besteht, die betreffenden Objekte durch den zuständigen Landeshauptmann sicherstellen. Die Zahl der auf diese Weise sichergestellten Gegenstände geht in die tausende. Von einer largen Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen kann demnach keine Rede sein.“14
Auf das Denkmalamt und die sichergestellten Kunstwerke wurde Posse im Juli 1939 während seines ersten Aufenthaltes in Wien als Sonderbeauftragter aufmerksam. Anlässlich seines Vortrags bei Hitler am 23. Juli 1939 machte er den Vorschlag, den „Führervorbehalt“ auf diese auszudehnen. Dem wurde entsprochen, der Wiener Gauleiter Josef Bürckel am folgenden Tag davon unterrichtete. Am 25. August und 18. September 1939 erließ Staatskommissar Friedrich Plattner entsprechende Verfügungen und benachrichtigte die staatlichen Museen und Bibliotheken, die Zentralstelle für Denkmalschutz und das Archivamt in Wien, die Landeshauptmänner, den Bürgermeister von Wien und die Vermögensverkehrsstelle: „Der Führer hat angeordnet, dass nicht nur die beschlagnahmten, sondern auch die im Gefolge der Machtergreifung lediglich sichergestellten Bilder und sonstigen Kunstwerte seiner Verfügung unterliegen.“ Sein Ministerium verwalte diese und Veränderungen an betreffenden Beständen dürften nur mit seiner vorherigen Zustimmung vorgenommen werden.15 Er erbat „eheste Bekanntgabe und schnellen Bericht“.
Es war nur konsequent, dass mit Erlass vom 31. Juli 1939 die Zuständigkeit des Ministeriums für innere und kulturelle Angelegenheiten auf alle in der „Ostmark“ von der Gestapo requirierten sowie auf die finanzamtlich sichergestellten beziehungsweise wegen Nichtanmeldung verfallenen Bestände ausgeweitet wurde; die Zentralstelle für Denkmalschutz sollte sie bis zur endgültigen Entscheidung Hitlers über die Zuteilung verwalten.16 Das Ministerium wies die Zentralstelle am 25. August an,
„die bisher verfügten Sicherstellungen auch über die von den hiesigen Staatsmuseen zur Erwerbung beantragten Bestände hinaus vollinhaltlich aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Aufrechterhaltung der diesbezüglich getroffenen Sperremaßnahmen bei der Sicherstellungsbehörde erforderlicherfalls zu beantragen.“17
Damit war die Zentralstelle für Denkmalschutz zum Erfüllungsorgan des „Führervorbehaltes“ geworden. Es war eine logische Konsequenz dieser Entwicklung, dass die im Zuge der fortschreitenden Umwandlung der österreichischen Länder in nationalsozialistische Gaue von der Auflösung bedrohte Zentralbehörde als Institut für Denkmalpflege ab 1940 auf Kosten des Reiches weitergeführt und dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin unterstellt wurde.18 So konnte nach Auflösung der österreichischen Übergangsregierung im Sommer 1940 die Verwaltung der unter „Führervorbehalt“ fallenden Kunstwerke im Denkmalamt verbleiben.
Die Reichweite des „Führervorbehaltes“ war umfassend: Die Landesbeziehungsweise Gaukonservatoren, die Vermögensverkehrsstelle und die Oberfinanzpräsidenten wurden beauftragt, bedeutende Kunstwerke, die sich unter den von ihnen verwalteten Beständen befanden, zu melden. So teilte der Gaukonservator der Steiermark am 7. Dezember 1943 an die Reichskanzlei mit, „der Beauftragte des Führers für Kunstangelegenheiten, Direktor Dr. Posse, Dresden“ habe Listen erhalten und daraufhin mitgeteilt, dass mit Ausnahme einer Münzensammlung keiner der dort verzeichneten Gegenstände „für die Zwecke des Führers“ infrage komme.19 Damit konnte der Gau selbst über die Objekte verfügen und sie lokalen Museen zuteilen.
Das Wiener Pfand- und Auktionshaus Dorotheum war seit Beginn des Jahres 1939 eine öffentliche Ankaufstelle für Kunstgegenstände, die unter die Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 fielen. Am 30. November 1939 wandte sich das Ministerium an das Dorotheum und teilte unter Bezug auf den Erlass vom 18. September 1939 mit, Verkäufe der unter „Führervorbehalt“ fallenden Kunstwerke ohne Zustimmung des Ministeriums seien unzulässig:
„Ich bitte Sie, die etwa im Dorotheum befindlichen und künftig noch zukommenden Kunstwerte, die unter diese Bestimmung fallen, der Zentralstelle mittels Verzeichnis anzumelden. Die Zentralstelle wird verständigt und angewiesen, gegebenenfalls wegen Übernahme solcher Bestände in das von ihr verwaltete Zentraldepot mit Ihnen ins Einvernehmen zu treten.“20
Und so geschah es: Die Mitarbeiter des Dorotheums informierten entweder das Denkmalamt oder die Dresdner Geschäftsstelle des „Sonderauftrags Linz“ mittels Fotos. Die Dresdner studierten ihrerseits die Auktionskataloge; entdeckten sie interessante Objekte, baten sie die Kunsthistoriker vor Ort um „Amtshilfe“ und Begutachtung des Originals, etwa den Leiter der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums, Ludwig von Baldass.21 Kamen die Fachgutachter zu einem positiven Ergebnis, wurden die im Katalog angekündigten Objekte aus der Versteigerungsmasse herausgenommen und ins Denkmalamt gebracht. Hier wurden kleine Ausstellungen arrangiert, die sowohl von Posse wie auch von Vertretern der zuteilungsberechtigten Museen besichtigt wurden, die ihre Zuteilungswünsche in Form von Listen hinterlegten.22 Immer wieder kam es dabei zu Interessenskollisionen und Hitler musste entscheiden. So legte er im Fall der spätgotischen Skulptur des Schmerzensmannes vom Pfenningberg, die von mehreren Museen beansprucht wurde, fest, dieses Stück solle dorthin zugeteilt werden, woher es stamme, nämlich in den Gau Oberdonau. Hitler habe diese Entscheidung getroffen, so Posse, „obwohl ihm, wie ich merkte, recht wenig an dieser wehleidigen Figur lag“.23 Die Skulptur stammte aus der Sammlung Fritz Erlachs, der mit seiner jüdischen Frau in die USA ausgereist war. Für den Schmerzensmann hatte Erlach keine Ausfuhrgenehmigung vom Denkmalamt bekommen, sodass er die Figur gegen ein anderes Kunstobjekt eintauschte, das er ausführen durfte.24
Der „Führervorbehalt“ galt auch für Umzugsgut, das bei Speditionen lagerte. Die Gestapo gründete im September 1940 dafür sogar ein eigenes Verkaufsunternehmen, die Vugesta, die ganze Wohnungseinrichtungen zur Auktion brachte. Stellte man darunter Kunstwerke fest, wurden diese beim Dorotheum eingeliefert und von dort der Zentralstelle oder dem „Sonderauftrag“ in Dresden gemeldet.
Der „Führervorbehalt“ war ursprünglich für Kunstsammlungen ausgesprochen worden, war aber mit den sichergestellten Kunstwerken automatisch auf Einzelwerke ausgedehnt. Hierdurch wurde er quasi automatisch auch zu einem Vorkaufsrecht Hitlers beziehungsweise seines Sonderbeauftragten. Ein solches Recht war Hitler schon bei den Ankäufen seines Kunstagenten Schulte-Strathaus eingeräumt worden. Eine rechtliche Legitimierung gab es dafür nicht, vielmehr basierte das Vorkaufsrecht allein auf der Autorität des „Führers“. Es wurde auch für die sichergestellten Kunstwerke eingefordert und durchgesetzt. Hier nahm Posse ganz klar das Erstzugriffsrecht in Anspruch. Am 9. Oktober 1940 fragte der leitende Direktor des Kunsthistorischen Museums Fritz Dworschak bei ihm wegen Erwerbungen aus den Sicherstellungen durch die staatlichen Museen an und erhielt die Antwort, dass solche Erwerbungen natürlich jederzeit möglich seien – unter Berücksichtigung des Vorkaufsrechts, das sich der Führer vorbehalten habe.25
Anfang 1940 wandte Posse das Vorkaufsrecht Hitlers zum ersten Mal auch auf eine Kunstsammlung an, nämlich die Handzeichnungensammlung Prinz Johann Georg von Sachsen, die beim Kunstantiquariat C. G. Boerner in Leipzig zum Verkauf anstand.26 Am 9. April 1940, dem ersten Tag der Vorbesichtigung, hielt er Hitler Vortrag über die Sammlung und zwei Tage darauf erneut. Obwohl dies der Tag war, an dem die Wehrmacht Dänemark und Norwegen besetzte, empfing Hitler seinen Sonderbeauftragten, da die Entscheidung wegen des Auktionstermins drängte. Hitler ließ sich vom Ankauf überzeugen, denn hier bot sich die einmalige Gelegenheit, mit einem Schlag etwa 1000 deutsche Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts, vor allem solche der Romantiker und Nazarener, zu erwerben. Die Sammlung wurde für 350.000 Reichsmark angekauft, die Versteigerung abgesetzt.27 Sicherlich war Boerner froh, die ganze Sammlung auf einen Schlag verkauft zu haben; andererseits dürfte die ganz kurzfristig abgesetzte Auktion zu Unruhe unter seiner Kundschaft geführt haben; die Kaufwilligen jedenfalls, die zur Vorbesichtigung angereist waren, dürfte er verprellt haben. Die Sammlung Johann Georgs wurde im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden vorläufig verwahrt und befindet sich auch heute noch dort. Da der Ankauf als rechtmäßig gilt, wurde der Freistaat Sachsen laut Bescheid des Bundesamtes zur Regelung offener Vermögensfragen 2005 zum Eigentümer erklärt.