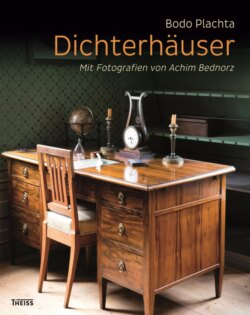Читать книгу Dichterhäuser - Bodo Plachta - Страница 8
Literarische Schreibstuben Skriptorien
ОглавлениеKlöster waren nicht nur Zentren des religiösen und spirituellen Lebens, sondern auch Orte, wo handwerkliche Fertigkeiten oder landwirtschaftliche Praktiken entwickelt und weitergegeben wurden. Klöster spielten in der abendländischen Kunst und Kultur eine herausragende Rolle, indem sie altes, teilweise vergessenes Wissen systematisch sammelten und wieder erschlossen, traditionelle Rechtspraktiken bewahrten und sich für die Verbreitung von Literatur, Musik, Medizin, Pflanzen- und Arzneikunde sowie von religiösen und philosophischen Denkweisen einsetzten. Klöster waren während des gesamten Mittelalters die wichtigsten und meistens auch größten Produzenten geschriebener Werke.
Das Beherrschen von Lesen und Schreiben war für solche Aufgaben natürlich eine unabdingbare Voraussetzung und wurde in den Klöstern sorgfältig praktiziert und umsichtig gelehrt. Die Ordensregeln der Benediktiner und der Zisterzienser erwähnen Lesen und Schreiben ausdrücklich als elementare Tätigkeiten des mönchischen Lebens, deren Pflege Ausdruck von religiöser Unterweisung, Erbauung und Besinnung ist. Auch das Studium von Texten – nicht nur religiösen Inhalts – war fester Bestandteil des Klosteralltags. Das Verfassen und Abschreiben gelehrter und religiöser Schriften sowie später auch literarischer Texte erfolgte über eine lange Zeit hinweg fast ausschließlich in Skriptorien, den Schreibstuben der Klöster. Diese Skriptorien machten Klöster zu Schreiborten par excellence. Hier arbeiteten Spezialisten, die nicht nur lesen und schreiben konnten, Latein und die Volkssprache beherrschten, sondern auch in aufwendigen und kostspieligen Vorgängen Pergament oder Papier herzustellen in der Lage waren. Sie beherrschten ebenso die Kunst des Buchbindens und viele kunsthandwerkliche Praktiken, um einen Codex zu einem prachtvollen Kunstwerk zu machen. Außerdem entwickelten die Schreibermönche und -nonnen die Schrift weiter und legten die Basis für deren Gebrauch als allgemeingültige schriftliche Verkehrsform, wie wir sie heute kennen und praktizieren. Die Überlieferung und Verbreitung mittelalterlicher Texte geschah daher bis zur Erfindung des Buchdrucks um 1450 durch Johannes Gutenberg nicht nur handschriftlich, sondern die Klöster waren auch die Orte, wo diese Handschriften in mühevoller Arbeit entstanden. Erst seit dem 12. Jahrhundert fertigte man Handschriften auch außerhalb von Klöstern an; größere ›weltliche‹ Skriptorien existierten erst im 15. Jahrhundert.
Das Skriptorium im Kloster des Mont Saint Michel
Die Bibliothek der Walburgiskerk in Zutphen, in der Bücher aus Schutz vor Diebstahl angekettet sind
Das Monopol, das Klöster bei der Bewahrung und Weitergabe von Wissen hatten, war zwar gottgefällig und damit ein frommes Werk, rief aber auch viele Neider auf den Plan und weckte unterschiedlichste Begehrlichkeiten, denn Codices waren kostbare Unikate, die oftmals mit außerordentlichen Illustrationen geschmückt sind und von prächtigen Bucheinbänden geschützt werden. Der Besitz solcher Handschriften verlieh nicht nur einem Kloster Prestige, sondern Fürsten, Bischöfe oder Adlige und bald auch vermögende Bürger betonten ihre Bildung und ihren sozialen Rang durch den Besitz von Handschriften. Oftmals gaben sie Handschriften in Auftrag und finanzierten deren kostspielige Herstellung, die für viele Klöster wiederum ein einträglicher Erwerbszweig war. Wenn ein Kloster eine Handschrift kopieren wollte, musste man das Original ausleihen und dafür sogar Leihgebühren bezahlen. Die Geschichte des handschriftlichen Buches kennt daher viele Beispiele, dass Codices nicht immer rechtmäßig ihre Besitzer wechselten. Diebstahl und Plünderung waren an der Tagesordnung und regelmäßig wurden die Bestände von Klosterbibliotheken bei kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft gezogen. Nicht selten galt das in den Handschriften aufgezeichnete und bewahrte Wissen sogar als gefährlich, rief die Inquisition auf den Plan und machte Skriptorium und Bibliothek zu Orten von Verdächtigung und Verfolgung oder Klöster zum Schauplatz von Bücherverbrennungen und Ketzerhinrichtungen.
Die Aufklärung einer Serie von Morden, die im Kloster begangen wurden, steht im Mittelpunkt von Umberto Ecos Bestsellerroman Der Name der Rose (1980). Dem ›Detektiv‹ William von Baskerville gelingt zwar die Aufklärung dieser Mordfälle und die Überführung des Mörders, doch am Ende des Romans gehen die mittelalterliche Klosterbibliothek, das Skriptorium und mit ihnen ein einzigartiger Schatz an abendländischem Wissen in Flammen auf. Ein einziger Text, das verschollen geglaubte zweite Buch der Poetik des Aristoteles, das die Komödie und das Lachen behandelt, war Auslöser der Mordserie. Dieses Buch vor der Öffentlichkeit zu verbergen und dessen ›verbotene‹ Lektüre zu einem todbringenden Akt zu machen, galt das Sinnen des eifernden Bibliothekars Jorge von Burgos. Dieser fürchtete nämlich, dass Aristoteles’ Theorie über das Lachen die weltliche und theologische Ordnung zum Einsturz bringen würde, weil nun jedermann mit Berufung auf den Philosophen die Geheimnisse des Glaubens lächerlich machen könne und damit der Apokalypse Vorschub leisten würde. Jorge von Burgos ist keineswegs davon überzeugt, dass wir alles wissen dürfen, was wir wissen können, für ihn gilt vielmehr die alte Formel, wonach Wissen Macht bedeutet. Um diese Macht zu verteidigen, vergiftet er die Seiten des Codex. Er tötet so einen seiner Mitbrüder, weil dieser sich nicht an das Lektüreverbot hält und sich beim Umblättern der Seiten mit dem Finger, den er immer wieder zum Mund geführt hatte, um ihn zu befeuchten, nach und nach vergiftet. Dass man auch in der realen Welt der mittelalterlichen Bibliothek Verbrechen ganz anderer Art – nämlich Diebstahl – befürchtete, lässt sich im niederländischen Zutphen besichtigen, wo die wertvollen Codices durch Ketten an den Lesepulten befestigt sind – man nennt sie daher Kettenbücher –, um die Leser gar nicht erst auf abwegige Gedanken kommen zu lassen.
So bedeutsam das Skriptorium für das Klosterleben auch war, Räume, die ausschließlich als Skriptorien gedient haben, waren die Ausnahme und gab es nur in großen Klöstern. Nur wenige Skriptorien sind in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben, etwa in Fontenay, Citeau oder auf dem Mont St. Michel. In den meisten Fällen ist sogar nur wenig oder gar nichts über deren Lage bekannt, obwohl in Aufzeichnungen, die das Klosterleben regeln, Räume, die man als Skriptorien nutzte, oft erwähnt wurden. Meistens handelte es sich dabei um Räume, die ruhig, gut durchlichtet, nicht zu feucht und vor allem nicht zu kalt, ja sogar beheizbar waren. Daher konnte eigentlich jeder Raum, der diese Bedingungen erfüllte, für das Schreiben genutzt werden. Häufig war dies das Kalefaktorium (Wärmeraum) oder ein Raum, der sich in dessen Nähe befand. Bei den Kartäusern war es sogar erlaubt, dass die Mönche in ihren Zellen schrieben. Das benötigte Mobiliar, etwa die Schreibpulte, war sowieso nicht an einen speziellen Raum gebunden und konnte ebenso leicht transportiert werden wie Schränke oder Truhen, in denen man Arbeitsmaterialien oder gerade in Arbeit befindliche Handschriften aufbewahrte. Die Arbeit im Skriptorium war mühsam und entbehrungsreich. In Handschriften finden sich daher verschiedentlich am Rand notierte Stoßseufzer über Kälte, feuchte Räume, klamme Finger und Rückenschmerzen; manchmal sind sie sogar geschickt in den Text eingeflochten worden.