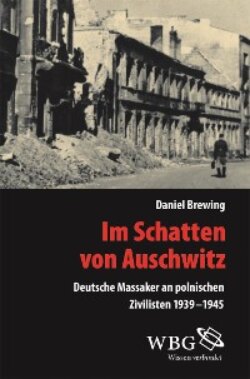Читать книгу Im Schatten von Auschwitz - Daniel Brewing - Страница 12
Historische und besatzungspolitische Rahmenbedingungen
ОглавлениеIn einem ersten Schritt ist das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Rahmenbedingungen und den Massakern an polnischen Zivilisten unter deutscher Besatzung zu untersuchen. Zu diesen Rahmenbedingungen zählt die Vorgeschichte der deutsch-polnischen Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert ebenso wie der Krieg, die konkreten Politikfelder der deutschen Besatzungsherrschaft, die Strukturen der Besatzungsgesellschaft und die ideologische Grundierung deutscher Herrschaft.
Zunächst stellen sich Fragen nach historischer Kontinuität: In welche größeren Kontexte einer Vorgeschichte ist die nationalsozialistische Gewaltgeschichte sinnvollerweise zu stellen?71 In der Forschung herrscht hier, so Dieter Pohl, „eine gewisse Beliebigkeit“72. So wurden in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Kontinuitätslinien gezogen, die – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – von der Bekämpfung französischer Franc-Tireurs 187173, über die Niederschlagung des Aufstands der Herero und Nama in den Jahren 1904 bis 190874 |21|und die Massenerschießungen belgischer Zivilisten 191475 bis hin zu den Freikorpskämpfen nach dem Ersten Weltkrieg76 reichen. Die vorliegende Studie wird bestimmte Elemente dieser Forschungsdiskussionen aufgreifen. Aber für eine Analyse deutscher Massaker an polnischen Zivilisten erscheint es zielführender, die wechselvollen deutsch-polnischen Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert selbst zu untersuchen.77 Es wird zu zeigen sein, inwiefern die Massaker der Jahre 1939 bis 1945 mit einer wirkmächtigen Vorgeschichte verwoben sind. Zugleich kann es jedoch nicht darum gehen, die Vielschichtigkeit dieser Vorgeschichte, die geprägt wurde von Brüchen, Wendungen und Ambivalenzen, auszublenden. Hier soll kein hermetisches Narrativ erzeugt werden, das um die Unterstellung kreist, diese Vorgeschichte habe im Sinne einer Kausalität zwingend in den Massakern des Zweiten Weltkriegs münden müssen. Im Kontext einer Analyse deutscher Massaker an polnischen Zivilisten stellen sich also Fragen nach Kontinuitäten und Brüchen, um die Eingebundenheit der Massaker in längerfristige Strukturen und Prozesse ebenso im Blick zu halten wie das spezifisch Neue der Konstellation der Jahre 1939 bis 1945.
|22|Die deutsche Besatzungsherrschaft in Polen während des Zweiten Weltkriegs – der zweite relevante Kontext – ist aus einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven analysiert worden.78 Hieran kann die vorliegende Studie in unterschiedlicher Weise anknüpfen. Martin Broszat, Gerhard Eisenblätter und Czesław Madajczyk haben wichtige strukturgeschichtliche Gesamtdarstellungen vorgelegt.79 Neben wichtigen Quelleneditionen80 sind darüber hinaus zahlreiche Studien zu den Strukturen des deutschen Besatzungsapparats81 sowie vor allem zu einzelnen Politikfeldern der Besatzungsherrschaft erschienen: So liegen mittlerweile beispielsweise grundlegende Arbeiten zur wirtschaftlichen Ausbeutung82, zur rassenpolitischen Neuordnung83, zur polizeilichen Sicherung84 |23|der besetzten polnischen Gebiete sowie zur nationalsozialistischen Kultur- und Erziehungspolitik85 vor. Insbesondere für die ältere polnische Forschung hat Hans-Jürgen Bömelburg86 in diesem Zusammenhang drei räumliche Schwerpunkte der Forschung identifiziert: Der Reichsgau Wartheland87 stand ebenso verstärkt im Blickpunkt der Forschung wie deutsche Politik in der Region Zamość88 und das Schicksal der Hauptstadt Warschau, insbesondere während des Warschauer Aufstandes 194489. Für eine Analyse deutscher Massaker an polnischen Zivilisten sind diese Studien von großer Relevanz: Die entscheidenden Parameter für die deutschen Massaker wurden ganz wesentlich |24|durch die Praxis der allgemeinen Besatzungspolitik bestimmt. Zur Systematisierung dieser Forschungen hat Ulrich Herbert vor einigen Jahren vorgeschlagen, die unterschiedlichen Zeit- und Handlungsperspektiven in den Vordergrund zu rücken: Demnach zielten die Besatzer langfristig auf eine „völkische Neuordnung“ der besetzten Gebiete, mittelfristig strebten sie deren maximale Ausbeutung an und kurzfristig reagierten sie ad hoc auf wechselnde Fälle militärischer, kriegswirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Zwänge.90 Diese Überlegung kann für die vorliegende Arbeit fruchtbar gemacht werden. Tempo und Ausmaß, Gelegenheiten und Bedingungen der Massaker wurden ganz wesentlich durch die Ziele der allgemeinen Besatzungspolitik bestimmt. Hier stellen sich Fragen nach der konkreten Verflechtung unterschiedlicher Politikfelder mit der Praxis der Massaker in bestimmten Konstellationen: Wie und warum verschob sich das Geflecht aus lang-, mittel- und kurzfristigen Zielen im Zeitablauf und welche Konsequenzen hatte dies für die Praxis der Massaker? Auf welche Weise leisteten bestimmte Politikfelder den Massakern Vorschub, wie legitimierten sie die Massaker? Aber auch gegenläufige Tendenzen sind von großer Bedeutung: In welchen Situationen und Kontexten wirkten bestimmte Politikfelder de-eskalierend und entschleunigten das Tempo der Gewalt? Schließlich kann die vorliegende Untersuchung auch Rückkopplungen in die andere Richtung beleuchten: Welchen Einfluss hatten die Massaker auf die Praxis der allgemeinen Besatzungspolitik?
Darüber hinaus kann die vorliegende Studie auch auf Studien zur Besatzungsgesellschaft unter deutscher Herrschaft zurückgreifen. Neben Untersuchungen zum Alltag der deutschen Besatzung91 sind hierbei insbesondere neuere Studien von Interesse, die die starre Dichotomie von Besatzern und Besetzten produktiv überwinden, indem sie Zonen der Zusammenarbeit ausloten. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Studien von Barbara Engelking92 und Jan Grabowski93 zu nennen, die kontrovers diskutiert wurden94. |25|Beide widmen sich dem Schicksal untergetauchter polnischer Juden: Dabei werfen sie nicht nur Fragen nach den Bedingungen des Versteckens auf, sondern verweisen darüber hinaus darauf, dass das Aufspüren der Untergetauchten durch SS- und Polizeitruppen nicht ohne die tätige Mithilfe polnischer Denunzianten möglich gewesen wäre. Gemeinsam ist beiden Studien, dass sie, in den Worten Ingo Looses, ein Bild der Besatzungsalltags zeichnen, das „ganz augenscheinlich komplexer war als gerne angenommen“95. Sichtbar wird hier ein Bild der Besatzungsgesellschaft, das nicht mehr ausschließlich um den starren Gegensatz von Besatzern und Besetzen kreist. Vielmehr wird eine differenziertere Besatzungswirklichkeit sichtbar, in der es zumindest punktuell Interaktionen zwischen Deutschen und Polen in bestimmten Handlungsfeldern gab. In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle der vormaligen deutschen Minderheit von größerer Bedeutung.96 Die Volksdeutschen waren jene Gruppe der polnischen Vorkriegsbevölkerung, die mit Beginn der deutschen Besatzung über diverse Beteiligungsangebote zu einem zentralen Element der deutschen Gewaltordnung wurde. Die Forschung hat hier auf unterschiedliche Formen der Beteiligung hingewiesen, die zwischen institutioneller Einbindung in paramilitärische Formationen und individuellem Mit-Machen als Dolmetscher, Übersetzer, Kundschafter, Informant und Denunziant changierten.97
Diese Befunde werfen Fragen – gerade auch im Kontext der deutschen Massaker an polnischen Zivilisten – nach einer flexiblen Ordnung der Gewalt unter deutscher Besatzung auf, nach Beteiligungsangeboten an bestimmte Gruppen |26|der polnischen Bevölkerung. Inwiefern lassen sich ähnliche Interaktionsstrukturen auch bei der Planung und Durchführung von Massakern an polnischen Zivilisten nachweisen? Wie verschoben sich im Zeitablauf die Parameter der deutschen Gewaltordnung? Welche Gruppen wurden in wechselnden Konstellationen mit Gewaltlizenzen ausgestattet? Worin liegen die Ursachen für diese Integration bestimmter Gruppen der polnischen Bevölkerung in die deutschen Gewaltmaßnahmen?
Schließlich kann die vorliegende Studie auch an Forschungen zur ideologischen Grundierung und zu spezifischen Feindbildstrukturen anknüpfen. In diesem Zusammenhang haben ganz unterschiedliche Historiker auf die Bedeutung eines nationalsozialistischen Antislawismus hingewiesen, der sowohl die Beziehungen des „Dritten Reiches“ zu seinem östlichen Nachbarn geprägt habe als auch für die Akteure der deutschen Besatzungsherrschaft handlungsleitend gewesen sei.98 John Connelly hat jedoch herausgearbeitet, dass der Container-Begriff des Antislawismus eine akademische Nebelkerze ist, die den Blick auf die komplexen, vielfach gebrochenen und widersprüchlichen Beziehungen des Nationalsozialismus zu den Staaten Osteuropas verstellt.99 Vielversprechender erscheinen im Kontext dieser Studie Untersuchungen, die Ansätze zur Konturierung eines spezifisch antipolnischen Feindbildes liefern. Eine entscheidende Rolle spielten in diesem Zusammenhang offenkundig die Volksdeutschen: Doris Bergen und Miriam Arani haben erste wichtige Untersuchungen vorgelegt, die die „Greuelpropaganda“ der Nationalsozialisten im Vorfeld des deutschen Überfalls und im Kontext des „Bromberger Blutsonntags“ analysieren.100 Die vorliegende Studie knüpft an diese Studien an und |27|stellt Fragen nach den Entstehungsbedingungen eines antipolnischen Feindbildes, nach seiner konkreten Ausgestaltung und Wirkmächtigkeit in spezifischen Konstellationen: An welche Traditionsbestände konnten die Nationalsozialisten anschließen, welche Elemente fügten sie dem Bestehenden hinzu, auf welche Weise wurde das Feindbild vermittelt und wie war es verknüpft mit der Praxis der Massaker an polnischen Zivilisten?