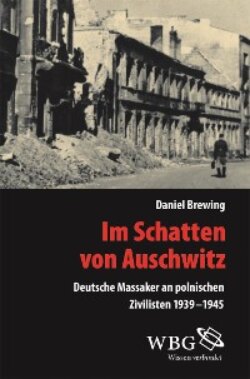Читать книгу Im Schatten von Auschwitz - Daniel Brewing - Страница 16
|42|II. Kontinuitäten und Brüche: Deutsche und Polen vor 1939 1. Ethnisierung der Diskurse: Nationalismus und Exklusion 1848–1918
ОглавлениеKein Ereignis hat die deutsch-polnischen Beziehungen so geprägt wie die Aufteilung Polens zwischen Österreich-Ungarn, Russland und Preußen in den Jahren 1772 bis 1795.1 Während sich das Zarenreich die zentralpolnischen Gebiete einverleibte und Galizien Österreich-Ungarn zugeschlagen wurde, unterstanden das Großherzogtum Posen sowie Westpreußen fortan der preußischen Krone.2 Über einen Zeitraum von 123 Jahren sollte diese politische Ordnung stabil bleiben: Erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde ein unabhängiger polnischer Staat wieder in die europäische Landkarte eingezeichnet. Diese Konstellation schuf im Zeitalter des aufkommenden Nationalismus zunächst Zonen sich überschneidender Interessen zwischen der polnischen und der deutschen Nationalbewegung, die beide auf die Überwindung der nicht-nationalen Ordnungsmacht Preußen zur Errichtung unabhängiger Nationalstaaten zielten.3 Hier sind die Wurzeln jener „Polenbegeisterung“ des national gesinnten deutschen Bürgertums zu verorten, die insbesondere nach dem polnischen Aufstand von 1830 um sich griff.4 Die Sympathien und Unterstützung für die polnischen Aufständischen speisten sich dabei auch aus einem strategischen Kalkül: Der polnische Unabhängigkeitskampf erschien in dieser Perspektive als Chance, um das restaurative Mächtesystem zu überwinden. Dies wiederum galt als notwendige Voraussetzung zur Errichtung eines deutschen Nationalstaats.5
Das Jahr 1848 markiert vor diesem Hintergrund eine tiefe Zäsur in den modernen |43|deutsch-polnischen Beziehungen. Es waren insbesondere die Debatten in der Frankfurter Paulskirche, die das Ende der „Polenbegeisterung“ symbolisierten und ein feindliches, von Konkurrenz geprägtes Verhältnis der beiden Nationalbewegungen zueinander etablierte.6 Die entscheidende Frage war hierbei, wo die Grenzen eines zukünftigen deutschen Nationalstaats liegen sollten, genauer: wie man mit jenen Gebieten umgehen sollte, die Preußen infolge der Teilungen Polens in seinen Herrschaftsverband integriert hatte und in denen eine polnische Bevölkerungsmehrheit lebte. Dabei zeigte sich im Verlauf der Debatte unter den Abgeordneten ein instrumentelles Verständnis des Nationalitätenprinzips: So reklamierte man die Errichtung eines deutschen Nationalstaates, wies jedoch die polnischen Ansprüche auf die Teilungsgebiete entschieden zurück. Damit sollte an den Teilungen Polens festgehalten werden, die nun zu einem Garanten deutscher Nationalstaatsbildung erklärt wurden.7 „Die schwachsinnige Sentimentalität“ für die polnische Nationalbewegung, so formulierte es der Abgeordnete Wilhelm Jordan, müsse einem „gesunden Volksegoismus“ weichen: Die Teilungen Polens erklärte er zu einer „Naturnotwendigkeit“, an der nur „Volksverräter“ rütteln würden.8 Dadurch begab sich die deutsche Nationalbewegung – wie Philipp Ther einmal formuliert hat – in eine „strukturelle Abhängigkeit“9 zu Preußen: Nur der preußische Staat, so schien es, konnte die deutschen Ansprüche auf polnische Gebiete zementieren. Diese machtpolitische Wende verband sich in der Paulskirche mit weiterreichenden imperialen Ambitionen: Gregor Thum hat gezeigt, dass sich im Rahmen der Debatte der semantische Gehalt des Begriffs der Grenze zunehmend auflöste.10 Insbesondere im multiethnischen Raum Ostmitteleuropas, so der Konsens unter den Abgeordneten, sei ein zukünftiges deutsches Herrschaftsgebiet nicht zu fixieren. Deutschland wurde dabei als ein „jugendlicher, forttreibender Baum“ begriffen, „wurzelnd im Westen auf der breiten Grundlage des Rheins“, dessen „Wachstum der Sonne entgegen gen Osten gerichtet“ ist.11 Thum hat diese Vorstellung auf den Begriff der „dynamischen deutschen Ostgrenze“ gebracht, die die Möglichkeit implizierte, das Herrschaftsgebiet jederzeit |44|nach Osten auszudehnen. Die deutsche Ostgrenze, so Thum, zielte somit nicht auf Begrenzung und Fixierung des Nationalstaates, sondern implizierte stets ihre eigene Überwindung durch territoriales Ausgreifen nach Osten.12
Diese Entwicklungen gingen einher mit bestimmten Denkfiguren, Bildern und Diskursen, die zur Legitimierung deutscher Herrschaftsansprüche verwendet wurden und die deutsche Wahnehmung der Polen bis weit in das 20. Jahrhundert hinein prägen sollten. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich zunächst die Denkfigur der „polnischen Wirtschaft“, die auf Chaotisierungstendenzen in sämtlichen Lebensbereichen, fatale Ineffizienz und generelle Unfähigkeit zielte.13 Die Polen wurden damit zu „wilden Barbaren“ erklärt, als „unzivilisierte Horden“ stigmatisiert, die zu eigenständigen kulturellen Leistungen prinzipiell nicht in der Lage seien. Diese Denkfigur implizierte zugleich die Vorstellung eines Zivilisationsgefälles, also einer grundsätzlichen Überlegenheit der Deutschen. Popularisiert wurden solche Vorstellungen insbesondere durch die Belletristik, die – wie zum Beispiel Gustav Freytags Bestseller „Soll und Haben“14 – die Bilder eines vermeintlichen Kulturgefälles zwischen wilden Polen und zivilisierten Deutschen fest im kollektiven Gedächtnis verankerten. Solche Texte erzeugten die Vorstellung einer spezifischen deutschen Zivilisierungsmission, die um die Vorstellung kreiste, nur durch erzieherische Tätigkeit „deutscher Kulturträger“ könnten die verwilderten Polen zu zivilisierten Menschen werden. Darüber hinaus verzahnte sich dieses Bild mit einer bestimmten Rezeption der mittelalterlichen Ostsiedlung, die nun als ein intendiertes, großangelegtes Projekt deutscher Siedler begriffen wurde.15 Diese Deutung der mittelalterlichen Ostsiedlung erlaubte es ihren Protagonisten, Polen als ein im Kern deutsches Gebiet zu bezeichnen: So konnte man zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein „Recht auf Rückkehr“ legitimieren, also den Einbezug der polnischen Gebiete in den deutschen Herrschaftsbereich.16
Vor diesem Hintergrund lassen sich einige Kontinuitätselemente herausstreichen, die langfristig prägend wirken sollten. Hierzu zählen neben den Stereotypen und Klischees eines pejorativen Polenbildes, die sich um die Kategorien der „polnischen Wirtschaft“ und des „unzivilisierten Polen“ zentrieren, |45|insbesondere zwei Aspekte: Die Auffassung, dass polnisches Territorium „urdeutsches“ Gebiet und deutsche Herrschaft über diese Gebiete deshalb legitim sei, spielte auch unter nationalsozialistischer Besatzung eine große Rolle zur Rechtfertigung deutscher Herrschaftsansprüche. Aus nationalsozialistischer Perspektive galt die Germanisierung weiter Räume des besetzten Polens und Osteuropas lediglich als Wiederaneignung historisch deutschen Bodens.17 Auch die Vorstellung einer dynamischen Ostgrenze verweist auf Zeit des Nationalsozialismus: Ein Blick auf die Dynamik räumlich immer ausgreifenderer Siedlungspläne, die schließlich im Generalplan Ost kulminieren sollten, zeigt, dass die Begrenzung des deutschen Herrschaftsraums im Osten keine Rolle mehr spielte. Sichtbar wird hier ein permanentes Voranschreiten, eine grenzenlose Dynamik, ein permanentes Ausgreifen bis an den Ural. Allerdings sollten diese Überlegungen zu Kontinuitäten nicht dazu verleiten, entscheidende Brüche aus dem Blick zu verlieren. Es bestehen große Differenzen zwischen den Revolutionären von 1848 und den Nationalsozialisten: Vorstellungen einer deutschen Zivilisierungsmission zur Erziehung der Polen spielten ab 1939 ebensowenig eine Rolle wie die kulturchauvinistische Vorstellung von der überlegenen Assimiliationskraft der deutschen Kultur. Für die Nationalsozialisten waren die polnischen Einwohner der besetzten Gebiete im Grunde irrelevant. Ihre Überlegungen bezogen sich ausschließlich auf den Raum: „Doch eine Germanisierung der Bevölkerung des annektierten bezw. eroberten Landes ist nicht möglich. Man kann nur den Boden germanisieren.“18 Die Polen galten in der rassistischen Perspektive der Nationalsozialisten nurmehr als quantité négligeable.
Die Ausrufung des deutschen Kaiserreiches und die Gründung eines deutschen Nationalstaats unter preußischer Führung im Jahre 1871 formten eine neue Konstellation der deutsch-polnischen Beziehungen. Dieser deutsche Nationalstaat beruhte auf der Kontinuität der Teilungen Polens, so dass die Polen eine vergleichsweise große Minderheit im jungen Nationalstaat bildeten.19 Die |46|nun einsetzenden Entwicklungen entfalteten sich im Kontext von zwei unterschiedlichen Spannungsfeldern, die sich in der konkreten politischen Praxis verknüpften. Zunächst ist hierbei auf konfessionelle Unterschiede zwischen einem borussischen Protestantismus und dem polnischen Katholizismus hinzuweisen. Aus der Perspektive der deutschen Regierung barg diese konfessionelle Differenz die Gefahr von Loyalitätskonflikten, die als eine Bedrohung für die ohnehin als instabil und fragil geltende innere Einheit des jungen Nationalstaates gedeutet wurde. Deshalb zählte die polnische Minderheit insbesondere unter der Kanzlerschaft Otto von Bismarcks zu jenen „Reichsfeinden“, die zur Festigung des Kaiserreichs bekämpft werden sollten.20 Darüber hinaus stand die Wahrnehmung der polnischen Minderheit in einem engen Zusammenhang mit bestimmten Migrationsprozessen in den Ostprovinzen des Kaiserreiches, die von der einsetzenden Industrialiserung und Urbanisierung kaum berührt wurden: Sie blieben im Kern landwirtschaftlich geprägte Regionen, während der Westen des Kaiserreiches von den rasanten Modernisierungsprozessen erfasst wurde. Dadurch entfalteten sich nach 1871 verschiedene Migrationswellen aus den ostdeutschen Provinzen in die urbanen und industriellen Zentren des Westens. Zunächst verließen zahlreiche Polen die Region, um sich insbesondere im Ruhrgebiet anzusiedeln.21 Für die folgende Entwicklung war jedoch entscheidender, dass auch die deutschsprachige Bevölkerung die vergleichsweise armen Ostprovinzen gen Westen verließ, während sich gleichzeitig Polen vor allem aus dem Zarenreich dort niederließen. Zwar waren die demographischen Effekte dieser Migrationsbewegungen keineswegs gravierend, doch die Perzeption dieser Entwicklung war eine andere: „Es entstand das Bild der deutschen Ostgrenze als eines gefährdeten Damms“, so formulierte es Benno Nietzel eindrücklich, „der angesichts der anbrandenden Flut slawischer Menschen zu brechen und überspült zu werden drohte.“22 Dieses Bedrohungsszenario, die Angst vor einer Polonisierung der Ostprovinzen, mobilisierte radikale Akteure wie den Ostmarkenverein, erfasste aber auch liberale Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie beispielsweise Max Weber, der die Entwicklung in den Ostprovinzen als „ökonomischen |47|Kampf ums Dasein“23 interpretierte. Die Polen seien dabei, so Weber in seiner Freiburger Antrittsvorlesung im Jahre 1895, aufgrund ihrer „physischen und psychischen Rassenqualitäten“ im Vorteil: „Der polnische Kleinbauer gewinnt an Boden, weil er gewissermaßen das Gras vom Boden frißt, nicht trotz, sondern wegen seiner tiefstehenden physischen und geistigen Lebensgewohnheiten.“24 Diese von Hysterie und Ängsten geprägte Perzeption stilisierte den Umgang mit den demographischen Entwicklungen in den ostdeutschen Provinzen zu einer Existenzfrage für das Kaiserreich, das diesen „Volkstumskampf“ entschlossen führen müsse.25
Im Kontext dieser beiden Spannungsfelder ist eine deutliche Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen zu verzeichnen. Diese beruhten in erster Linie auf den Strategien der Reichsregierung, die auf die Beseitigung dieser „polnischen Gefahr“ zielten. Es lassen sich hierbei im Kern zwei Phasen unterscheiden, in denen die Reichsregierung mit unterschiedlichen, immer radikaleren Maßnahmen versuchte, den „Volkstumskampf“ gegen die polnische Minderheit zu gewinnen. Zunächst zielte sie in den 1870er Jahren mit dem „Kulturkampf“ insbesondere auf die Stellung des polnischen Klerus, dessen Einfluss durch die Erteilung des Schulunterrichts in ausschließlich deutscher Sprache26 und die Einführung einer staatlichen Kontrolle der Ausbildung von Geistlichen27 eingeschränkt werden sollte. Dieser massive Eingriff in die kirchliche Verwaltung löste Protest und Widerstand unter polnischen Priestern aus, die daraufhin vielfach zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sind.28 Jedoch erwies sich der „Kulturkampf“ als fulminanter Fehlschlag, der eine Solidarisierungswelle mit den polnischen Geistlichen unter den Angehörigen der polnischen Minderheit auslöste und damit ihre führende Rolle innerhalb der polnischen Gesellschaft zementierte.29
In den folgenden Jahren versuchte die Reichsregierung, die ethnischen Verschiebungen in den ostdeutschen Provinzen mit unterschiedlichen Maßnahmen umzukehren. Das Handlungsspektrum reichte dabei von der Deportation von 48.000 polnischen Einwanderern ohne preußische Staatsbürgerschaft30 über den staatlichen Aufkauf polnischen Grundbesitzes und die gleichzeitige subventionierte Ansiedlung von 150.000 deutschen Siedlern aus dem Innern |48|des Reichs31 bis hin zur Einführung eines Enteignungsrechts32, mit dem polnischer Grundbesitz entschädigungslos zugunsten von deutschen Siedlern umverteilt werden sollte. All diese Maßnahmen scheiterten: Sie waren erfolglos in dem Versuch, die Polonisierungsängste durch eine Umkehrung des demographischen Trends zu bannen. Im Gegenteil: Sie stärkten die polnische Nationalbewegung, wirkten als ein Katalysator und verschafften ihr immer größeren Zulauf. In diesem Sinne ist Bismarck „das unbeabsichtigte Verdienst zuzuschreiben, die polnische Nationalbewegung […] gleichsam in einer Art Rückkopplungseffekt erweckt zu haben“33. Innerhalb der Reichsregierung breitete sich angesichts der polnischen Hartnäckigkeit zunehmend ein Gefühl von Machtlosigkeit aus. Diese Ohnmachtserfahrung stand dabei in scharfem Kontrast zum Selbstbild einer großen Nation, die im Osten eine „historische Mission“ zu erfüllen habe. Das Scheitern der Germanisierungspolitik wurde vor diesem Hintergrund als demütigende Schande empfunden. Gregor Thum hat gezeigt, dass diese Wahrnehmungsmuster tiefgreifende Ängste evozierten und Panik auslösten, die zu einer spezifischen Radikalisierung des Vorgehens führten, denn der „Volkstumskampf“ wurde zur Prestigefrage erklärt und musste unter allen Umständen gewonnen werden.34 Die Schmach des Scheiterns, das Debakel der Germanisierungspolitik sollten deshalb durch immer schärfere Maßnahmen überwunden werden, die schließlich mit dem Enteignungsrecht den verfassungsrechtlich geschützten Gleichheitsgrundsatz zumindest punktuell suspendierten.35 Gleichwohl waren dem politischen Handeln im Kaiserreich bestimmte Grenzen gesetzt: Obwohl sie verfemt, angefeindet und verachtet wurden, so waren die polnischen Einwohner der ostdeutschen Provinzen doch Bürger des Reiches, die durch ihre verfassungsrechtlich garantierten Rechte geschützt waren. Das Enteignungsrecht, das insgesamt in vier Fällen zur Anwendung kam, deutet zwar eine Bereitschaft zur „Erosion des […] Gleichheitsgrundsatzes“36 an, doch insgesamt zog die Verfassung des Kaiserreiches Grenzen des Erlaubten und Möglichen ein. Es waren diese Grenzen, die einen deutlichen Unterschied zur Konstellation der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg markierten: Hier waren fast alle gewaltbegrenzenden Schranken eingerissen worden.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der Verlauf der Kampfhandlungen formten einen neuen Wahrnehmungs- und Handlungskontext, der die in den Vorkriegsjahren angelegten Tendenzen der deutschen Polenpolitik auf |49|entscheidende Weise katalysierte. Im Hinblick auf die Frage nach Kontinuitäten und Brüchen sind hierbei vor allem Fragen nach den spezifischen Wahrnehmungsmustern, den Kriegszielen und der konkreten Besatzungspolitik von Bedeutung. Zunächst stellte sich aus der Perspektive der deutschen Regierung die Frage nach der Loyalität der polnischen Minderheit in verschärfter Weise. Insbesondere die Rekrutierung polnischer Soldaten für die kaiserliche Armee wurde mit großen Bedenken betrachtet. Allerdings erwiesen sich diese Sorgen als unbegründet: Desertionen polnischer Soldaten waren anscheinend kaum zu verzeichnen.37 Doch begrenzte sich das deutsche Misstrauen nicht auf die polnischen Soldaten, sondern bezog sich auch auf die führenden Persönlichkeiten der polnischen Minderheit, die vielfach präventiv verhaftet wurden.38
Für die meisten der eingesetzten deutschen Soldaten bedeutete der Einmarsch in Kongresspolen, das ehemalige russische Teilungsgebiet, den ersten Kontakt mit einer ihnen unbekannten Welt. Gabriel Liulevicius hat herausgearbeitet, dass dies für viele Soldaten eine verstörende Erfahrung war. Die raue, unwirtliche, aber auch unberührte Natur, die zuweilen extreme Kälte, matschige Straßen und allgegenwärtiger Schmutz – diese Eindrücke gewannen deutsche Soldaten unmittelbar nach dem Einmarsch.39 Die Einheimischen erschienen den deutschen Soldaten, so Liulevicius, ganz im Sinne der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts popularisierten Denkfigur eines vermeintlichen „Kulturgefälles“: Sie nahmen die polnischen Einwohner Kongresspolens als verlaust, rückständig, schmutzig, stumpfsinnig, im Grunde vorzivilisatorisch, auf jeden Fall aber als in vielfacher Hinsicht besserungsbedürftig wahr. Die Zerstörungen, die die russische Armee auf ihrem Rückzug hinterlassen hatte, intensivierten diese Wahrnehmungen nochmals und zementierten die Überzeugung, in ein unzivilisiertes Land ohne jegliche Kultur einmarschiert zu sein. All das wirkte wie eine Bestätigung der vielfach vermittelten „barbarischen Zustände“ im Osten. Diese Wahrnehmung schuf zugleich eine Handlungsanweisung: die mittelalterliche Ostkolonisation wiederaufzunehmen, Elend, Schmutz und Dreck zu beseitigen und die Region im Sinne einer deutschen Zivilisierungsmission auf eine höhere Kulturstufe zu heben. Exemplarisch für diese Vorstellungen steht der Roman „Der Wanderer zwischen den Welten“ von Walter Flex, der den Osten als „Sehnsuchtsraum einer heilen, von der Industrialisierung noch unberührten Natur“40 zeichnete, der zugleich eine immerwährende Zivilisationsaufgabe für das Deutsche Volk sei.
Diese Wahrnehmungsmuster verbanden sich dabei mit Diskussionen um |50|mögliche Kriegsziele im Osten, die als radikalisierende Fortführung der Polenpolitik des Kaiserreiches zu begreifen sind. Relevant sind hierbei in erster Linie jene Planspiele, die auf die Eingliederung und Germanisierung eines „polnischen Grenzstreifens“41 zielten, der von Łódź im Süden bis nach Suwałki im Norden reichen und entlang der Flüsse Warthe, Narew und Weichsel führen sollte. Die deutsche Ostgrenze wäre nach diesem Plan weit nach Osten verschoben worden und hätte große Räume Kongresspolens eingeschlossen. Die dort lebenden Polen sollten zu hunderttausenden aus dem Gebiet vertrieben werden, während gleichzeitig deutsche Bauern angesiedelt werden sollten, um einen „Schutzwall“ vor dem Bedrohungsszenario einer „slawischen Flut“ zu bilden.42 Diese Vorstellung wurde unter anderem von Sven Hedin, dem „privilegierten ‚Schlachtenbummler‘ auf deutscher Seite“43, popularisiert: In seinem Buch „Nach Osten“ forderte er dazu auf, „eine germanische Mauer gegen die slawischen Sturmwogen zu errichten“44. Gerhard Wolf hat diese Planungen zu Recht als einen Schritt hin zu einer „Politik der ethnischen Säuberungen“45 bezeichnet. Es war lediglich der spezifische Verlauf des Krieges, der die Umsetzung dieser Planungen verhinderte: Erst die endgültige deutsche Niederlage machte aus diesen radikalen Plänen Makulatur.46 Allerdings gab es gegenläufige Planungen: So versuchte die politische Führungsebene des Reiches, die Polen durch Ausrufung eines polnischen Königreiches für eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Reich zu gewinnen.47 Doch auch diese Planung scheiterte aufgrund ihres für die Polen offensichtlich strategischen Charakters.
Durch das Vorrücken der deutschen Armee entstanden ab 1915 jenseits dieser Planungsebene zwei Besatzungszonen, die sich in ihrer politischen Praxis scharf voneinander unterschieden. Das Besatzungsgebiet Oberost galt als ein „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“48, als ein gestaltungsoffener Raum, in dem ohne irgendwelche Rücksichten gehandelt werden konnte. Unter Erich Ludendorff49 zielte die Besatzungspolitik sowohl auf die wirtschaftliche Ausbeutung der Region und auf die Vermittlung deutscher Hygiene- und Ordnungsvorstellungen. Mit Gabriel Liulevicius handelte es sich bei der Besatzungspolitik |51|in Oberost um „eine[n] desaströsen Versuch, Kultur durch Gewalt zu vermitteln“50. Zugleich tauchte im Besatzungsgebiet Oberost auch jene Vorstellung einer nicht fixierbaren, dynamischen deutschen Ostgrenze wieder auf: „Das vorherrschende Bild in den Köpfen der Besatzer war das einer aggressiv voranschreitenden Grenze, eines in Bewegung befindlichen Kriegsstaates. Immer wenn eine neue Grenze gezogen wurde, drängte er schon darüber hinaus, weiter nach Osten.“51 Diese Vorstellungen verzahnten sich mit siedlungspolitischen Ambitionen in Oberost. Die Pläne für eine deutsche Siedlungspolitik wurden räumlich dabei stets ausgreifender: Immer weitere Regionen wurden als potentielles Ziel deutscher Siedlungen anvisiert. Auch hier setzte erst die Kriegsniederlage 1918/19 diesen umfassenden Planspielen ein Ende. Im Generalgouvernement Warschau hingegen, dem zweiten Besatzungsgebiet, standen kooperative Elemente stärker im Vordergrund. Unter dem Generalgouverneur Hans Hartwig von Beseler wurde eine Politik verfolgt, die auf Stärkung der polnischen Selbstverwaltung setzte und unter anderem in der Eröffnung der Warschauer Universität mündete.52 Ziel war es dabei, die gemeinsame Frontstellung gegenüber dem russischen Zarenreich stärken. Allerdings beruhte auch diese Politik nicht auf den Prinzipien politischer Gleichheit, sondern war geprägt kolonialen Mustern: Beseler visierte eine kulturelle Hebung der Polen an, um sie zu zivilisierten Menschen zu erziehen.53
Der Erste Weltkrieg bedeutete eine wichtige Zäsur in der deutschen Polenpolitik, die gleichsam ihre Schatten auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs wirft. Es zeigen sich sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Konstellationen der beiden Weltkriege. Zu den bedeutsamen Kontinuitäten zählt hierbei zum einen die spezifische Wahrnehmung der polnischen Bevölkerung als unkultiviert, schmutzig und verarmt. Ganz ähnliche Wahrnehmungsmuster lassen sich während des Krieges 1939 auch finden. Zum anderen verweisen auch die gewalttätigen Germanisierungspläne auf Kontinuitätselemente, die beide Weltkriege miteinander verbinden. Doch auch die Unterschiede in den Konstellationen der Jahre 1915/18 und 1939/45 treten deutlich hervor. Zunächst ist die Abwesenheit einer spezifischen Erwartungshaltung zu nennen, die 1939 zu einer Explosion der Gewalt führen sollte: die Erwartung, dass sich die polnische Zivilbevölkerung auf „hinterhältige“ Weise an der Kriegführung beteiligen würde. Der rücksichtlose Umgang mit vermeintlichen Freischärlern, der insbesondere den Krieg im September 1939, aber auch die folgenden Besatzungsjahre prägen sollte, war während des Ersten Weltkriegs |52|an der Ostfront deutlich weniger ausgeprägt als in Belgien und Nordfrankreich.54 Allerdings haben neuere Forschungen gezeigt, dass sich beispielsweise in Kalisz im August 1914 vergleichbare Massenerschießungen auf Grundlage ähnlicher Eskalationsmuster ereignet haben wie zeitgleich in Belgien.55 Darüber hinaus sind deutliche Differenzen in der jeweiligen politischen Agenda zu verzeichnen: Ab 1939 ging es im Kern nur um die Zerstörung der polnischen Nation durch den massenhaften Einsatz von Gewalt. Während des Ersten Weltkriegs war die politische Planung und besatzungspolitische Praxis deutlich inkohärenter und reichte von einer Zivilisierungsmission zur „Hebung“ der Polen und der strategischen Errichtung eines polnischen Königreiches bis hin zu einer Politik der ethnischen Säuberung. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass gewaltsame Pläne nicht blutig umgesetzt wurden: Zwischen Plan und Praxis klaffte in den Jahren 1914 bis 1918 ein Graben, der von den Nationalsozialisten ab 1939 durch die rücksichtslose Anwendung massenhafter Gewalt überbrückt worden ist.