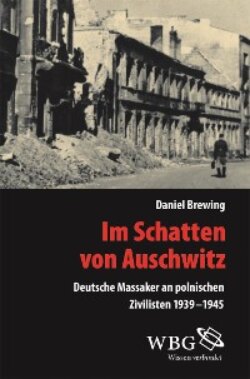Читать книгу Im Schatten von Auschwitz - Daniel Brewing - Страница 9
|9|I. Einleitung 1. Thema
ОглавлениеIm Frühjahr 2008 erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Artikel über ein dunkles, vermeintlich längst vergangenes Kapitel der deutsch-polnischen Vergangenheit.1 Darin erzählte Konrad Schuller, der Osteuropa-Korrespondent der Zeitung, die Geschichte von Winicjusz Natoniewski, eines 72-jährigen polnischen Rentners, der kurz zuvor am Danziger Bezirksgericht eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht hatte. Natoniewski forderte eine Million Zloty als Entschädigung für ein lebenslanges Leiden, für die schweren Entstellungen und Verstümmelungen seines Körpers. „Als ich Winicjusz Natoniewski zum ersten Mal sah“, notierte Schuller, „blieben meine Augen an seinem verbrannten Gesicht haften, nur um gleich wieder […] abzugleiten […] zum zerstörten Ohr, zu den sorgfältig über die Brandflächen des Schädels gekämmten Haarresten, zu den feuerrot geblähten Ballons der Hände mit den knolligen Fingerresten daran.“2 Diese Verwundungen wurden Natoniewski zugefügt, als er ein fünfjähriger Junge war, der in dem Dorf Szczecyn, südöstlich von Lublin, lebte. Am 2. Februar 1944 hatten deutsche Truppen unter der Leitung des Kommandeurs der Ordnungspolizei (KdO) Lublin, Konrad Rheindorf, ein Massaker an den Einwohnern des Dorfes verübt. Dieses Massaker ereignete sich im Kontext der nationalsozialistischen „Bandenbekämpfung“: In der waldreichen Umgebung Szczecyns hatte Rheindorf den Schlupfwinkel einer „600 Mann starken bolschew. Bande“3 vermutet, die er mit einer „Großaktion“ unter Beteiligung „starke[r] Kräfte der Truppenpolizei, Wehrmacht und Sicherheitspolizei“4 bekämpfen wollte. Es war die räumliche Nähe zwischen dem Dorf und dem vermuteten Aufenthaltsort einer vermeintlich bolschewistischen Partisaneneinheit, die aus der Perspektive Rheindorfs einen begründeten Verdacht erzeugte: dass nämlich die Einwohner Szczecyns mit den Partisanen auf vielfältige Weise zum Nachteil der deutschen Besatzungsmacht kooperieren würden. Diese Zuschreibung machte aus dem |10|Dorf ein „Widerstandsnest“5, das damit zu einem vermeintlich legitimen Ziel einer „Säuberungsaktion“6 wurde. Vor diesem Hintergrund kreisten die deutschen Truppen Szczecyn in den frühen Morgenstunden des 2. Februar 1944 ein und beschossen das Dorf mit Granatwerfern.7 Die strohbedeckten Dächer der Häuser brannten schnell, das ganze Dorf stand in kürzester Zeit in Flammen.8 Es brach Panik aus: Während weiterhin Granaten einschlugen, versuchten die Einwohner aus dem brennenden Dorf zu fliehen, wurden jedoch am Absperring erschossen. Nachdem der Granatbeschuss eingestellt worden war, drangen die Einheiten des KdO Lublin in das Dorf ein und töteten wahllos Männer, Frauen und Kinder. Dabei entfaltete sich ein Szenario, das geprägt wurde von überschießender Gewalt: Die deutschen Truppen prügelten die Menschen mit Ochsenziemern nieder, erschossen sie von Angesicht zu Angesicht mit Karabinern und Maschinengewehren, sperrten Alte, Kinder und Verletzte in Häuser und verbrannten sie bei lebendigem Leib.9 Der KdO Lublin hielt in seiner Lagemeldung fest, dass an diesem Tag in Szczecyn und den umliegenden Ortschaften „rund 480 Banditen und Verdächtige im Feuerkampf bzw. auf der Flucht“10 getötet wurden. „Eigene Verluste“, so Rheindorf, hatten die deutschen Einheiten dabei nicht zu verzeichnen.11 Nach dieser Phase entgrenzter Gewalt entschleunigte sich das Geschehen. Die Überlebenden wurden zusammengetrieben und entlang des Kriteriums der Arbeitsfähigkeit selektiert: Die Jüngeren und Kräftigeren wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet,12 alle anderen, die Frauen, die Alten und die Kinder, wurden in dem Dorf zurückgelassen, das bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Winiczjusz Natoniewski, der Fünfjährige, war einer von ihnen: Als die ersten Granaten einschlugen hatte er versucht, aus dem brennenden Haus seiner Eltern zu rennen und sich zu verstecken, in seiner Angst jedoch nicht bemerkt, dass sein ganzer Körper bereits Feuer gefangen hatte. In Flammen stehend irrte er durch das Dorf, bevor sein Vater ihn entdeckte und das Feuer an seinem Körper im kalten Schlamm einer Pfütze löschen konnte.13 Er überlebte das Massaker als verbranntes Kind, das ein Leben lang gezeichnet bleiben sollte. Seine Entschädigungsklage gegen die Bundesrepblik Deutschland wurde letztinstanzlich im Jahre 2010 vom Obersten |11|Gerichtshof in Warschau unter Hinweis auf die Staatenimmunität abgewiesen.14
Diese Geschichte von Winicjusz Natoniewski, der Zerstörung des Dorfes Szczecyn und der Ermordung seiner Einwohner führt hinein in die komplexe Geschichte deutscher Massaker an polnischen Zivilisten im Kontext nationalsozialistischer Partisanenbekämpfung. Schlaglichtartig verdeutlicht sie die Vielschichtigkeit eines Gewaltgeschehens, das bis in unsere Gegenwart nachhallt. Dabei unterstreicht sie unterschiedliche Aspekte, die für eine Analyse der Massaker von Relevanz sind: Sie illustriert die vielfältigen Akteurskonstellationen und die breite Streuung der Verantwortlichkeit für die Konzipierung und Durchführung von Massakern; sie verweist auf die Einbindung der Massaker in die Ziele und Praxis der allgemeinen Besatzungspolitik, die einen Handlungsrahmen formten, der Tempo und Ausmaß, Gelegenheiten und Bedingungen bestimmte und dabei jene „guten Gründe“ lieferte, mit denen Massaker legitimiert werden konnten; sie veranschaulicht die Grausamkeit, Exzessivität und überschießende Gewalt in der Praxis des Massakers und signalisiert damit, dass die Massaker in ihrer Zweckgebundenheit nicht aufgehen; und schließlich zeigt sie sowohl die katastrophalen Folgen der Massaker für die Überlebenden als auch den Umgang des postnationalsozialistischen Deutschland mit diesem spezifischen Gewalterbe.
All diese Aspekte und Dimensionen sind Gegenstand der vorliegenden Studie, die sich den deutschen Massakern an polnischen Zivilisten während des Zweiten Weltkriegs widmet. Sie geht dabei von der Annahme aus, dass die Anwendung von Gewalt im besetzten Polen grundsätzlich keine deviante Handlungsform war.15 Mit Norbert Elias beruhte die deutsche Besatzungsherrschaft auf einer massiven Erhöhung des „Gewaltniveau[s] von Mensch zu Mensch“16. Die Zone erlaubter und gebotener Gewaltanwendung wurde im besetzten Polen massiv ausgedehnt: Hier war erlaubt, was im „Altreich“ verboten war. Pointiert fomuliert, öffneten sich im besetzten Polen neue Räume zum Ausagieren von Gewalt, die von den Akteuren vor Ort genutzt werden konnten. Vor diesem Hintergrund gilt ihr Kerninteresse den Fragen, welche Bedingungen, Umstände und Konstellationen den Massakern Vorschub geleistet haben, wie und warum sich bestimmte Akteure in spezifischen Konstellationen zur Durchführung von Massakern entschieden haben, welche Legitimierungsmuster ihren Entscheidungen zugrunde lagen, inwiefern die |12|Massaker die jeweiligen Konstellationen und Kontexte veränderten, warum die Praxis der Massaker stets einen Überschuß an Gewalt produzierte, was dies über die jeweiligen Akteure aussagt und welche Faktoren den gesellschaftlichen und politischen Umgang mit den Massakern nach 1945 prägten. Die Studie greift damit eine Anregung von Richard J. Evans auf, der kürzlich gefordert hatte: „What we need is to understand why the murder of Poles took place and how people could carry it out.“17