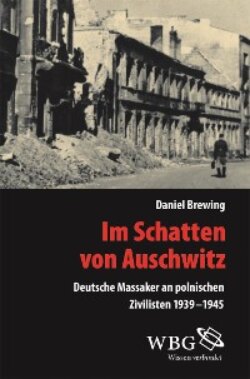Читать книгу Im Schatten von Auschwitz - Daniel Brewing - Страница 14
4. Zuschnitt, Gliederung und Quellen
ОглавлениеDies ist keine Gesamtdarstellung nationalsozialistischer Gewalt an polnischen Zivilisten. Mit der Fokussierung auf die Kategorie des Massakers blendet sie viele Gewaltformen aus, die für eine umfassende Geschichte der Gewalt- und Leidenswelt des besetzten Polen unverzichtbar wären. Hier liegen ihre Grenzen, aber auch ihre Chancen.
Polnische Zivilisten wurden unter deutscher Herrschaft zu Opfern ganz unterschiedlicher Gewalthandlungen: Ihnen wurden verschiedenen Formen alltäglicher Gewalt zugefügt, sie wurden geschlagen, getreten, gedemütigt, zur Zwangsarbeit verpflichtet und sexueller Gewalt ausgesetzt, polnische Zivilisten wurden gewaltsam vertrieben und in Viehwaggons deportiert, sie wurden in zahllose Haftstätten verschleppt, in „Vernehmungsräumen“ des SS- und Polizeiapparates massenhaft gefoltert und insbesondere als Angehörige der staatstragenden Schichten137 dort und an anderen Orten standrechtlich erschossen. All diese Erscheinungsformen deutscher Gewalt in Polen sind in dieser Studie nur dann von Interesse, wenn sie in analytischem Zusammenhang mit den Massakern stehen: zur Ausleuchtung des spezifischen Kontextes oder als integriertes Gewaltphänomen eines Massakers. Eine eigenständige Analyse dieser unterschiedlichen Gewaltpraktiken wird hingegen nicht vorgenommen. Dies gilt auch für die Gewalt in den Konzentrationslagern: Vor allem Auschwitz, jenes „größte Schlachthaus in der Geschichte der Menschheit“138, ist nicht Gegenstand der vorliegenden Studie. Insbesondere im Westen wird häufig |35|übersehen, dass Auschwitz innerhalb des Lagersystems eine Doppelfunktion einnahm: Es war nicht nur ein Vernichtungslager für über eine Million Juden aus ganz Europa, sondern zugleich ein Konzentrationslager, in dem unter anderem etwa 140.000 polnischen Zivilisten inhaftiert waren, von denen 70.000 nicht überlebt haben: Sie wurden erschossen oder gingen an den elenden Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager zugrunde.139 Als Institution der Gewalt ist Auschwitz jedoch von Massakern eindeutig zu unterscheiden: in einem mit Stacheldraht umzäunten Raum verübte eine spezifische Tätergruppe ohne zeitliche Begrenzung unterschiedliche Gewaltpraktiken, die im Zeitablauf den Tod zahlloser Menschen forderte.
Vielmehr ist diese Studie eine Untersuchung der spezifischen Gewaltform des Massakers. Sie strebt dabei keine lexikalische Vollständigkeit an, sondern versteht sich als qualitative Analyse. Ihr empirischer Schwerpunkt sind die Massaker im Kontext der deutschen Partisanenbekämpfung. Mark Levene hat betont, dass die spezifische Gewaltform des Massakers nur selten in Konstellationen unangefochtener Macht und gesicherter Herrschaftsverhältnisse durchgeführt wird. Vielmehr würden Massaker in der Regel von Staaten durchgeführt, „whose power is diffused, or fragmented, or unsure of itself, or frightened of the fact the power it thinks it ought to have is illusory or slipping out of its control“140. Massaker werden also von Staaten in der Regel im Kontext von Bedrohungsszenarien begangen, die die eigene Verwundbarkeit ebenso entblößt wie die Fragilität von Herrschaftsansprüchen.141 Die vorliegende Studie greift diese Beobachtungen auf und widmet sich insbesondere der deutschen Partisanenbekämpfung. Es war das Auftreten polnischer Partisanen, das unter den deutschen Besatzern jene Angst- und Bedrohungsgefühle auslöste, die sukzessive in Vorstellungen einer umfassenden Krise mündeten, Handlungsdruck erzeugten und zahllosen Massakern Vorschub leisteten.
Diese Entscheidung eröffnet zwei Möglichkeiten: Zum einen kann die vorliegende Studie unmittelbar an aktuelle Forschungen zur ersten Phase der deutschen Besatzungsherrschaft anknüpfen. Hier wurde die Gewaltbereitschaft |36|deutscher Soldaten und Polizisten unter anderem auf die „hinterhältige“ Kampfesweise vermeintlich allgegenwärtiger polnischer Partisanen zurückgeführt. Jochen Böhler konnte jedoch zeigen, dass es ein virtueller Krieg war, der hier geführt wurde: Eine organisierte polnische Partisanenbewegung, so Böhler, habe es im September 1939 nicht gegeben. Gleichwohl habe die illusionäre Vorstellung eines ubiquitären Feindes verhaltenssteuernde Wirkung entfaltet und Massakern an polnischen Zivilisten Vorschub geleistet.142 Eine Untersuchung der Massaker im Kontext der Partisanenbekämpfung kann diese und weitere Studien fortschreiben und analysieren, wie die deutschen Besatzer auf eine real exisitierende Partisanenbewegung reagiert haben. Damit können die Befunde der wichtigen Forschungen der letzten Jahre für den gesamten Zeitraum der deutschen Herrschaft fruchtbar gemacht werden.
Zum anderen bietet sich die Chance, ein vielfach angemahntes Forschungsdesiderat aufzugreifen: „Ein wirklich erschöpfendes Werk über die ‚Pazifizierung‘ der polnischen Dörfer“, so hat es Wlodzimierz Borodziej einmal formuliert, „liegt nicht vor, [dieser Gewaltkomplex, D. B.] ist eine ungeschriebene Geschichte.“143 Dabei verdient die deutsche Partisanenbekämpfung im besetzten Polen aus unterschiedlichen Gründen besondere Beachtung: Zunächst war das besetzte Polen aufgrund seiner geographischen Lage das wichtigste Transitland für den Krieg gegen die Sowjetunion, die überwiegende Mehrheit des rollenden Materials musste auf dem Weg zur Ostfront das Gebiet passieren und war dabei potentiellen Anschlägen ausgesetzt. Außerdem diente das das besetzte Polen Truppen der deutschen Wehrmacht als bedeutsamer „Ruheraum“, in den sie zur Auffrischung und Erholung von den Kriegsschauplätzen der Ostfront zurückgezogen wurden.144 Ferner nahm das Gebiet als riesiges Reservoir an Zwangsarbeitern und bedeutsamer Lieferant landwirtschaftlicher Produkte eine zunehmend exponierte Position auch im kriegswirtschaftlichen Gesamtgefüge ein. Schließlich lag besetzte Polen an der Schnittstelle verschiedener, vielfach verflochtener Stränge der Verfolgung und Vernichtung im deutsch besetzten Osteuropa, die das Gebiet zu einem Schauplatz des Massenmords an den Juden und sowjetischen Kriegsgefangenen machte. Diese verschiedenen Faktoren konstituierten das besetzte Polen als ein militärstrategisch und kriegswirtschaftlich bedeutendes Gebiet, dessen Stabilität um jeden Preis gewährleistet sein musste.
Vor dem Hintergrund dieser empirischen Schwerpunktsetzung lässt sich auch der konkrete Untersuchungsraum der vorliegenden Studie präzisieren: Im Zentrum der Analyse steht das zentralpolnische Gebiet des Generalgouvernements, denn hier operierte die große Mehrheit der polnischen Partisanenverbände. Insbesondere die Distrikte Radom und Lublin boten den Partisanen |37|vergleichsweise günstige topographische Bedingungen und waren zentrale Schauplätze deutscher Partisanenbekämpfung.145 In den eingegliederten Gebieten hingegen sind während des gesamten Besatzungszeitraums kaum Aktivitäten von polnischen Partisanenverbänden zu verzeichnen.146 Dennoch werden bestimmte Entwicklungen in den neuen Reichsgauen in die Analyse einbezogen, um die Massaker möglichst breit zu kontextualisieren. Die ostpolnischen Kresy wiederum mit ihren komplexen, nur schwer zu dechiffrierenden Bürgerkriegen werden nicht thematisiert. Dies ist bedauerlich, aber unvermeidbar, da die Konstellation deutscher Herrschaft ab 1941 in dieser multiethnischen Konfliktregion eine gänzlich andere war. Die in vieler Hinsicht spezifischen Probleme deutscher Herrschaft in Ostpolen erfordern eine eigenständige Forschungsarbeit.
Das Konzept des Massakers liefert den Leitfaden der Untersuchung. Die Analyse entfaltet sich dabei in drei Schritten, die zugleich die Gliederungsebenen dieser Studie bilden. In einem ersten Teil wird das „Setting der Massaker“ untersucht. Hier wird zunächst die Vorgeschichte der deutsch-polnischen Beziehungen auf Kontinuitäten und Brüche hin befragt. Anschließend werden die unterschiedlichen Zeit- und Handlungsperspektiven der allgemeinen deutschen Besatzungspolitik als grundlegende Kontexte der Massaker im Zusammenhang analysiert. Daraufhin widmet sich dieses Kapitel den Feindbildstrukturen, die eng verknüpft sind mit der Viktimiserung der Volksdeutschen und der Zuschreibung einer spezifischen polnischen Gewaltaffinität. Schließlich |38|richtet sich der Fokus auf die Installierung einer Ordnung der Gewalt im besetzten Polen. Diese war eng mit der Austeilung von Gewaltlizenzen an die Volksdeutschen verbunden und begleitet von zahllosen Massakern an polnischen Zivilisten.
Im zweiten Teil der Studie wird dann die Praxis der Massaker und der Nexus von Widerstand, Krieg und Massakern analysiert. Vor dem Hintergrund einer Analyse der Frühphase deutscher Besatzungsherrschaft untersucht die Studie anschließend die Massaker in der Konstellation der Stabilisierung und Aufrechterhaltung deutscher Herrschaft. Hierbei wird die Entwicklung von Massakern im Kontext der Partisanenbekämpfung von 1940 bis 1945 beleuchtet. Beleuchtet werden dabei die Akteure, Funktionen, Praktiken und Legitimierung der Massaker. Dabei wendet sich die Studie mit der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 auch dem Transfer der Partisanenbekämpfung vom ländlichen Raum in ein urbanes Zentrum zu. Darüber hinaus greift sie auch die Frage nach der Involvierung bestimmter Gruppen der polnischen Bevölkerung in die Massaker auf. Diese Untersuchungsebene läßt sich über die Austeilung von Gewaltlizenzen an polnische Zivilisten zurückbinden an die zuvor bereits ausgeführten Strukturen der Gewaltordnung im besetzten Polen, die sich damit als flexibel erweisen. Außerdem wird in diesem Kapitel der Zusammenhang der Massaker an polnischen Zivilisten sowohl mit parallelen Gewaltkomplexen als auch mit besatzungspolitischen Zielen untersucht.
Im dritten Teil der Studie wird der Umgang des postnationalsozialistischen Deutschland und des kommunistischen Polen mit diesen Massakern analysiert.
Die Untersuchung stützt sich auf unterschiedliche Quellenmaterialien aus deutschen, polnischen und amerikanischen Archiven. Sie zieht dabei die zeitgenössische deutsche Quellenüberlieferung, Berichte und Aussagen von Überlebenden sowie Akten der justitiellen Aufarbeitung von NS-Verbrechen heran, um die Massaker von unterschiedlichen Perspektiven möglichst umfassend zu analysieren. Im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde konnten zeitgenössische Quellen des deutschen Besatzungsapparates ausgewertet werden. Hier lagern die zentralen Bestände der deutschen Zivilverwaltung, insbesondere das vollständige Diensttagebuch des Generalgouverneurs Hans Frank, das eine zentrale Quelle für diese Untersuchung darstellt. Daneben finden sich hier ferner die Bestände der nachgeordneten Dienststellen der Zivilverwaltung, die Einblicke in die regionalen Kontexte der Massaker bieten. Außerdem befinden sich dort zentrale Bestände des SS- und Polizeiapparates, die von höchster Relevanz für diese Studie waren: die Akten des Persönlichen Stabes Reichsführer-SS, diverser Polizeidienststellen, des Hauptamtes Ordnungspolizei sowie der Truppen und Schulen der Ordnungspolizei. Ähnliche Bedeutung können die Bestände des Bundesarchivs Ludwigsburg beanspruchen, welche die gesamte justitielle Aufarbeitung von NS-Verbrechen umfassen, also Ermittlungsverfahren, Anklageschriften und Urteile. Eine Fülle von Vorermittlungsverfahren beschäftigt sich auch mit Massakern an polnischen Zivilisten. Erwähnenswert |39|ist auch die höchst umfangreiche Dokumentensammlung, die eine wertvolle Auswahl wichtiger Quellen osteuropäischer Provenienz enthält. Daneben kam insbesondere das Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau in Betracht. In Gänze konnten die für den militärischen Besatzungsapparat zentralen Bestände – Militärbefehlshaber im Generalgouvernement und Rüstungsinspektion und Rüstungskommandos – gesichtet werden. Von höchster Relevanz sind ebenfalls die Kriegstagebücher der unterstellten Reserveeinheiten: Infanteriedivision 154 und Infanteriedivision 174. Schließlich bieten die Bestände des Archivs eine wertvolle Parallel- und gelegentliche Ersatzüberlieferung zu den SS- und Polizeiakten, die spezifische Überlieferungslücken schließen konnten. Wichtig für die vorliegende Studie war ferner das Archiv des Instytut Pamięci Narodowej, dessen höchst umfangreiche Bestände für die Erforschung der deutschen Besatzungspolitik insgesamt einzigartig sind. Hier konnten zentrale Sammlungen zeitgenössischen Quellenmaterials überwiegend aus dem SS- und Polizeiapparat eingesehen werden: insbesondere die Bestände zu den Kommandeuren der Gendarmerie erlauben wichtige Einblicke in die Praxis der Massaker. Daneben konnten einige Splitterbestände der Zivilverwaltung und der Wehrmacht eingesehen werden. Im Archiwum Akt Nowych lagern die Aktenbestände der Landwirtschaftlichen Zentralstelle, der Hauptabteilung Ernährung und Landwirtschaft sowie der Sammelbestand Niemieckie władze okupacyjne, der eine Vielzahl unterschiedlicher Überlieferungen insbesondere aus dem Bereich der Zivilverwaltung enthält. Ergänzend konnten schließlich noch die Bestände des United Holocaust Memorial Museum ausgewertet werden, in dem sich Mikrofilmkopien aus allen größeren und kleineren Archiven Osteuropas befinden. Hier konnten Aktenbestände aus regionalen polnischen Archiven ausgewertet werden sowie zentrale, in Polen jedoch nur schwer zugängliche Quellen aus dem SS- und Polizeiapparat.
Die Analyse dieser unterschiedlichen Quellenmaterialen wirft jeweils spezifische Probleme auf. Die zeitgenössische deutsche Quellenüberlieferung kann in besonderer Weise als authentisch gelten und gibt wertvolle Einblicke in die Praxis deutscher Herrschaft in Polen. Allerdings gilt es immer zu berücksichtigen, dass zwischen den überlieferten Anordnungen und Befehlen sowie der tatsächlichen Praxis eine Lücke klaffen kann: nicht immer spiegeln sie das tatsächliche Geschehen, das unter Umständen eine ganz andere Verlaufskurve hatte als vorgesehen. Die zeitgenössische Überlieferung bietet deshalb häufig nur ungenauen Aufschluss über die tatsächliche Praxis der Gewalt. Eine wertvolle Ergänzung bieten in diesem Zusammenhang die Aussagen von polnischen Überlebenden oder Zeugen der Massaker. Doch auch diese Quellengattung ist nicht unproblematisch: eine Identifizierung der beteiligten deutschen Einheiten war den Überlebenden und Zeugen aus verständlichen Gründen in aller Regel nicht möglich. Für sie handelte es sich um eine nicht zu differenzierende Masse von „Hitleristen“, die ihnen und ihren Familien massiv Gewalt angetan haben. Und trotzdem können die Zeugenaussagen als |40|wichtige Ergänzungsüberlieferung gelten, die gemeinsam mit anderen Quellen wertvolle Einblicke in die Dynamik der Gewalt bieten. Schließlich bieten die Akten der justitiellen Aufarbeitung von NS-Verbrechen zwar die Möglichkeit, Fragen zu beantworten, denen mit Hilfe des zeitgenössischen Quellenmaterials kaum nachgegangen werden kann: insbesondere die kulturhistorische Kernfrage nach der Bedeutung lässt sich an das Quellenmaterial stellen. Allerdings gilt es dabei zu beachten, dass die Aussagen im Kontext justitieller Ermittlungen entstanden sind. Das juristische Strafverfolgungsinteresse differiert deutlich von einem historiographischen Zugang, der die Ereignisse im Zuge ihrer Entwicklung verstehen will.147 Die juristischen Ermittlungsverfahren konzentrierten sich hingegen notwendigerweise lediglich auf die strafrechtlich relevanten Aspekte und legten den Fokus auf isolierte, einzelnen Tätern zuzuordnende Tatkomplexe. Darüber hinaus ist das Aussageverhalten der Täter im Kontext eines justitiellen Ermittlungsverfahrens zu beachten. Als Zeugen oder Angeklagte waren ihre Aussagen zumeist von dem Interesse geleitet, den Behörden keine möglicherweise gerichtlich verwertbaren Beweise für die Ausübung von Massakern an der Zivilbevölkerung zu liefern. Deshalb schwiegen sie, leugneten eine Beteiligung oder stellten Schutzbehauptungen auf. Nur sehr selten finden sich Aussagen, in denen offen und ausführlich über die Gewaltpraxis im besetzten Polen gesprochen wird. All diesen Problemen zum Trotz bietet das Quellenmaterial in der Zusammenschau die Möglichkeit, die deutschen Massaker umfassend und aus unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren.
Zum Schluss sei noch auf eine terminologische Entscheidung hingewiesen: Im Mittelpunkt der Studie steht der Begriff „polnische Zivilisten“. Damit sind die christlichen bzw. ethnischen Polen gemeint. Diese Entscheidung erfolgte ausschließlich aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung. Da selbstverständlich auch Juden polnische Staatsbürger waren, müsste die Studie eigentlich korrekterweise den Begriff „ethnische/christliche Polen“ verwenden. Dies erscheint jedoch umständlich. Die Entscheidung impliziert keinesfalls eine semantische Ausklammerung der Juden aus der polnischen Gesellschaft.
1 Konrad Schuller: Als Winicjusz Natoniewski um sein Leben lief, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.2.2008, S. 3; Schuller hat diesen Artikel zu einem eindringlichen Buch ausgearbeitet, das ein Jahr später erschienen ist, siehe: ders.: Der letzte Tag von Borów. Polnische Bauern, deutsche Soldaten und ein unvergangener Krieg, Freiburg/B. 2009; siehe auch: ders.: Kein Haus blieb verschont, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.9.2009, S. 11.
2 Ders., Tag, S. 75f.
3 KdO Lublin, Tägliche Lagemeldung v. 3.2.1944, AIPN, GK 104/51, Bl. 6.
4 Ebd.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Siehe hierzu die Schilderung bei: Schuller, Tag, S. 42–48.
8 KdO Lublin, Tägliche Lagemeldung v. 3.2.1944, AIPN, GK 104/51, Bl. 6.
9 Siehe hierzu die Erinnerungen der Überlebenden bei: Schuller, Tag, S. 51.
10 KdO Lublin, Tägliche Lagemeldung v. 3.2.1944, AIPN, GK 104/51, Bl. 6.
11 Ebd.
12 In der Meldung hieß es, dass „[ü]ber 300 Familienangehörige […] zur Weiterleitung an das Arbeitsamt abtransportiert“ worden seien: Ebd.
13 Schuller, Tag, S. 46.
14 Nina Schulz: Die eine Sache noch, in: Analyse & Kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr. 604, 21. April 2015, S. 30f.
15 Herbert Jäger: Verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Studien zur nationalsozialistischen Makrokriminalität, Olten/Freiburg 1967; ders.: Makrokriminalität. Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt, Frankfurt/M. 1989; Michaela Christ: Die Soziologie und das „Dritte Reich“. Weshalb Holocaust und Nationalsozialismus in der Soziologie ein Schattendasein führen, in: Zeitschrift für Soziologie 40 (2011), S. 407–431, hier: S. 424.
16 Norbert Elias: Studien über die Deutschen, Frankfurt/M. 1989, S. 227.
17 Richard J. Evans: Who remembers the Poles?, in: London Review of Books, Vol. 32, Nr. 21, 4. November 2010.
18 Dieter Pohl: Nationalsozialistische und stalinistische Massenverbrechen. Überlegungen zum wissenschaftlichen Vergleich, in: Jürgen Zarusky (Hrsg.): Stalin und die Deutschen. Neue Beiträge der Forschung, München 2006, S. 253–264.
19 Birthe Kundrus/Henning Strotbek: „Genozid“. Grenzen und Möglichkeiten eines Forschungsbegriffs – ein Literaturbericht, in: Neue Politische Literatur 51 (2006), S. 397–423; Boris Barth: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen, München 2006; Robert Gellately/Ben Kiernan (Hrsg.): The Specter of Genocide. Mass Murder in Historical Perspective, Cambridge 2003; Norman Naimark: Flammender Hass. Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, München 2004; Peter Imbusch: Probleme der deutschen Genozidforschung. Eine Übersicht, in: Mittelweg 36, 2 (2001), S. 49–53.
20 Birthe Kundrus: Entscheidung für den Völkermord? Einleitende Überlegungen zu einem historiographischen Problem, in: Mittelweg 36, 6 (2006), S. 4–17, hier: S. 6.
21 Ebd.
22 Peter Imbusch: Der Gewaltbegriff, in: Wilhelm Heitmeyer/John Hagan (Hrsg.): Internationales Handbuch der Gewaltforschung, Wiesbaden 2002, S. 26–57.
23 Jacques Sémélin: Säubern und Vernichten. Die politische Dimension von Massakern und Völkermorden, Hamburg 2007, S. 353ff.
24 Peter Burschel: Massaker, in: Friedrich Jaeger (Hrsg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 8, S. 110–112, hier: S. 110.
25 Mark Levene: Introduction, in: Ders./Penny Roberts (Hrsg.): The Massacre in History, New York 1999, S. 1–38, hier: S. 2.
26 Hans Medick: Massaker in der Frühen Neuzeit, in: Claudia Ulbrich/Claudia Jarzebowski/Michaela Hohkamp (Hrsg.): Gewalt in der Frühen Neuzeit, Berlin 2005, S. 14–19, hier: S. 15.
27 Sémélin, Säubern, S. 353ff.
28 Medick, Massaker, S. 15.
29 Ebd.
30 Siehe beispielsweise die entsprechenden Definitionen bei: Sémélin, Säubern, S. 353; Levene, Introduction, S. 5; Burschel, Massaker, S. 110; Wolfgang Sofsky: Traktat über die Gewalt, Frankfurt/M. 1996, S. 175f.
31 Trutz von Trotha: Genozidaler Pazifizierungskrieg. Soziologische Anmerkungen zum Konzept des Genozids am Beispiel des Kolonialkrieges in Deutsch-Südwestafrika, 1904–1907, in: Zeitschrift für Genozidforschung 4 (2003), S. 30–57, hier: S. 49f.
32 Sofsky, Traktat, S. 178.
33 Trutz von Trotha/Michael Schwab-Trapp: Logiken der Gewalt, in: Mittelweg 36, 6 (1996), S. 56–64, hier: S. 60.
34 von Trotha, Genozidaler Pazifizierungskrieg, S. 49f.
35 von Trotha/Schwab-Trapp, Logiken, S. 60.
36 Sofsky, Traktat, S. 180.
37 Ebd.
38 Ebd., S. 181.
39 Imbusch, Gewaltbegriff, S. 48; Jäger, Makrokriminalität, S. 11f.
40 Siehe beispielsweise: Klaus-Michael Mallmann: „Mensch, ich feiere heut’ den tausendsten Genickschuß.“ Die Sicherheitspolizei und die Shoah in Westgalizien, in: Bogdan Musial (Hrsg.): „Aktion Reinhardt“. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941–1944, Osnabrück 2004, S. 353–379.
41 Stefan Wiese: Pogrom, in: Christian Gudehus/Michaela Christ (Hrsg.): Gewalt. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar 2013, S. 152–158, hier: S. 157.
42 Trutz von Trotha.: Formen des Krieges. Zur Typologie kriegerischer Aktionsmacht, in: Sighard Neckel/Michael Schwab-Trapp (Hrsg.): Ordnungen der Gewalt. Beiträge zur politischen Soziologie der Gewalt und des Krieges, Opladen 1999, S. 71–96, hier: S. 86.
43 Ders.: Gewaltforschung auf Popitzschen Abwegen. Antireduktionismus, Zweckhaftigkeit und Körperlichkeit der Gewalt, in: Mittelweg 36, 6 (2000), S. 26–36, hier: S. 35f.
44 Wolfgang Knöbl: Imperiale Herrschaft und Gewalt, in: Mittelweg 36, 3 (2012), S. 1944, hier: S. 36.
45 Sofsky, Traktat, S. 175ff.
46 Ebd., S. 176.
47 Medick, Massaker, S. 15.
48 Sofsky, Traktat, S. 181.
49 Wolfram Pyta: Selbstmobilisierung der Endkämpfer. Kriegerische Gewalteskalation im 20. Jahrhundert und deren kulturhistorische Durchleuchtung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.5.2006, S. 10.
50 Ebd.
51 Ebd.; Harald Welzer hat einmal davon gesprochen, dass eine solche Perspektive „dumm“ sei, da sie „distanzlos in dem Grauen verweilt, die es zu beschreiben vorgibt“. Siehe: Harald Welzer: „Verweilen beim Grauen“. Bücher über den Holocaust, in: Merkur 48 (1994), S. 67–72, hier: S. 72.
52 Sémélin, Säubern, S. 355.
53 Ebd., S. 356.
54 Ders.: Elemente einer Grammatik des Massakers, in: Mittelweg 36, 6 (2006), S. 18–40, hier: S. 27.
55 Sven Reichardt: Feindbild und Fremdheit – Bemerkungen zu ihrer Wirkung, Bedeutung und Handlungsmacht, in: Benjamin Ziemann (Hrsg.): Perspektiven der Historischen Friedensforschung, Essen 2002, S. 250–271, hier: S. 250.
56 Ebd., S. 255.
57 Sémélin, Elemente, S. 22.
58 Mark Roseman: Ideas, Contexts, and the Pursuit of Genocide, in: Bulletin of the German Historical Institute London 25 (2003), S. 65–83.
59 Sémélin, Elemente, S. 27.
60 Ebd.
61 Ebd., S. 24.
62 Anregend in diesem Zusammenhang: Peter Fritzsche: Life and Death in the Third Reich, Cambridge 2008, S. 2–7.
63 Siehe beispielsweise: Dieter Pohl: Von der „Judenpolitik“ zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 1939–1944, Frankfurt/M. 1993; Thomas Sandkühler: „Endlösung“ in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsintiativen von Berthold Beitz, 1941–1944, Bonn 1996; Christian Gerlach: Krieg, Ernährung, Völkermord. Forschungen zur deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg, Hamburg 1998; Bogdan Musial: Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939–1944, Wiesbaden 1999; Jacek Andrzej Mlynarczyk: Judenmord in Zentralpolen. Der Distrikt Radom des Generalgouvernements 1939–1945, Darmstadt 2007; Michael Alberti: Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945, Wiesbaden 2006; zusammenfassend: Peter Longerich: Tendenzen und Perspektiven der Täterforschung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 14–15 (2007), S. 3–7; Klaus-Michael Mallmann: Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Der Täterdiskurs in Wissenschaft und Gesellschaft, in: ders./Andrej Angrick (Hrsg.): Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen, Darmstadt 2009, S. 292–318.
64 Eine brillante Synthese bietet: Dan Stone: Histories of the Holocaust, New York 2010; siehe auch: Donald Bloxham: The Final Solution. A Genocide, Oxford 2009.
65 Jan Philipp Reemtsma: Freiheit, Macht, Gewalt, in: ders.: Mord am Strand. Allianzen von Zivilisation und Barbarei, München 1998, S. 125–145.
66 Wolfgang Sofsky: Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager, Frankfurt/M. 1993, S. 265ff.
67 Alf Lüdtke/Michael Wildt: Einleitung. Staats-Gewalt: Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes, in: dies. (Hrsg.): Staats-Gewalt: Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes. Historische Perspektiven, Göttingen 2008, S. 7–38, hier: S. 22.
68 Klaus-Michael Mallmann: Die Türöffner der „Endlösung“. Zur Genesis des Genozids, in: Gerhard Paul/ders. (Hrsg.): Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 437–463.
69 Sémélin, Elemente, S. 30; Kundrus, Entscheidung, S. 15.
70 Matthias Häußler/Trutz von Trotha: Brutalisierung „von unten“. Kleiner Krieg, Entgrenzung der Gewalt und Genozid im kolonialen Deutsch-Südwestafrika, in: Mittelweg 36, 3 (2012), S. 57–89, hier: S. 58.
71 Birthe Kundrus/Sybille Steinbacher (Hrsg.): Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Der Nationalsozialismus in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, Göttingen 2013.
72 Dieter Pohl: Massengewalt und der Mord an den Juden im „Dritten Reich“, in: Sybille Steinbacher (Hrsg.): Holocaust und Völkermorde. Die Reichweite des Vergleichs, Frankfurt/M. 2012, S. 107–123, hier: 110.
73 Isabel V. Hull: Absolute Destruction. Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Ithaca 2005; siehe auch: Susanne Kuss: Vernichtungskrieg in Polen 1939: Vernichtung als Kontinuität in der deutschen Militärgeschichte, in: Bernd Martin/Arkadiusz Stempin (Hrsg.): Deutschland und Polen in schweren Zeiten. Alte Konflikte – neue Sichtweisen, Poznań 2004, S. 69–86.
74 Siehe insbesondere die Sammlung der wichtigsten Aufsätze eines der Protagonisten dieser Debatte: Jürgen Zimmerer: Von Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verständnis von Kolonialismus und Holocaust, Berlin 2011; siehe vor allem die überzeugende Entgegnung von: Stefan Malinowski/Robert Gerwarth: Der Holocaust als ‚kolonialer Genozid‘? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg, in: Geschichte und Gesellschaft 33 (2007), S. 439–466; Birthe Kundrus: Kontinuitäten, Parallelen, Rezeptionen. Überlegungen zur „Kolonialisierung“ des Nationalsozialismus, in: WerkstattGeschichte 43 (2006), S. 45–62; dies.: Von den Herero zum Holocaust? Einige Bemerkungen zur aktuellen Debatte, in: Mittelweg 36, 2 (2005), S. 82–91; zuletzt: Sybille Steinbacher: Sonderweg, Kolonialismus, Genozide: Der Holocaust im Spannungsfeld von Kontinuitäten und Diskontinuitäten der deutschen Geschichte, in: Frank Bajohr/Andrea Löw (Hrsg.): Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, Frankfurt/M. 2015, 83–101.
75 John Horne/Alan Kramer: Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene Wahrheit, Hamburg 2004.
76 Dieter Pohl: Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944, München 2008, S. 34–40; ders., Massengewalt, S. 111–112; Boris Barth: Dolchstoßlegenden und politische Desintegration. Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 1914–1933, Düsseldorf 2003, S. 229–290; Hans-Heinrich Wilhelm: Personelle Kontinuitäten in baltischen Angelegenheiten auf deutscher Seite von 1917/19 bis zum Zweiten Weltkrieg?, in: John Hiden (Hrsg.): The Baltic in International Relations Between the Two World Wars, Stockholm 1988, S. 157–170.
77 Siehe jetzt: Jörg Hackmann/Marta Kopij-Weiß: Nationen in Kontakt und Konflikt. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen 1806–1918, Darmstadt 2014; außerdem u.a.: Martin Broszat: Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, Frankfurt/M. 1972; Dietrich Beyrau (Hrsg.): Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 1999; Robert L. Nelson (Hrsg.): Germans, Poles, and Colonial Expansion to the East: 1850 through the Present, New York 2009; Hubert Orlowski: „Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 1996; Karoline Gil/Christian Pletzing (Hrsg.): Granica. Die deutsch-polnische Grenze vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, München 2010; Vejas Gabriel Liulevicius: The German Myth of the East. 1800 to the Present, Oxford 2009; Gregor Thum (Hrsg.): Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006; Wolfgang Wippermann: Die Deutschen und der Osten. Feindbild und Traumland, Darmstadt 2007; Wlodzimierz Borodziej: Deutschland und das östliche Europa, in: Joachim von Puttkamer/ders. (Hrsg.): Europa und sein Osten. Geschichtskulturelle Herausforderungen, München 2012, S. 131–146; Günther Stökl: Osteuropa und die Deutschen. Geschichte und Gegenwart einer spannungsreichen Nachbarschaft, Oldenburg/Hamburg 1967.
78 Etwa 4000 Einträge finden sich bei: Andreas Lawaty/Wiesław Mincer (Hrsg.): Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie, Wiesbaden 2000, Bd. 1, S. 735–950; siehe auch: Walter Okonski: Wartime Poland, 1939–1945: A Select Annotated Bibliography of Books in English, Westport 1997.
79 Czesław Madajczyk: Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, 2 Bde., Warszawa 1970; ders.: Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945, Berlin/Ost 1987; Martin Broszat: Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961; Gerhard Eisenblätter: Grundlinien der Politik des Reiches gegenüber dem Generalgouvernement 1939–1944, Diss. Phil., Frankfurt/M. 1969.
80 Vgl. Documenta Occupationis, Poznań 1945–1990; Werner Präg/Wolfgang Jacobmeyer (Hrsg.): Das Diensttagebuch des Generalgouverneurs in Polen 1939–1945, Stuttgart 1975; Czesław Madajczyk (Hrsg.): Zamojszczyzna. Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu hitlerowskiej, 2 Bde., Warszawa 1977; ders. (Hrsg.): Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, München 1994; Werner Röhr (Hrsg.): Die faschistische Okkupationspolitik in Polen 1939–1945, Berlin (Ost) 1989.
81 Siehe jetzt: Markus Roth: Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen – Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göttingen 2009; Peter Klein: Behördenbeamte oder Gefolgschaftsmitglieder? Arthur Greisers Personalpolitik in Posen, in: Jochen Böhler/Stephan Lehnstaedt (Hrsg.): Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, Osnabrück 2012, S. 187–204; Ralf Meindl: Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch – eine politische Biographie, Osnabrück 2007; Musial, Zivilverwaltung; siehe ferner: Edward Jędrzejewski: Administracja i NSDAP w systemie okupacyjnym ziem polskich włączonych do Trzeciej Rzeszy (1939–1945), in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerwoskich w Polsce 27 (1977), S. 131–147; Stanislaw Nawrocki: Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939–1945, Poznań 1970; Ryszard Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władze w rejencji w latach 1939–1945, Katowice 1998; Kazimierz Radziwończyk: Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce, 22.6.1941 – wiosną 1944 r., in: Wojskowy Przegląd Historyczny 7, 3 (1962), S. 103–159 und 7, 4 (1962), S. 31–96; Leon Herzog: Die verbrecherische Tätigkeit der Wehrmacht im Generalgouvernement in den Jahren 1939 bis 1945, in: Zeitschrift für Militärgeschichte 6 (1967), S. 445–458.
82 Czesław Łuczak: Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1993; Czesław Rajca: Walka o chleb 1939–1945. Eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin 1991; Sonja Schwaneberg: Die wirtschaftliche Ausbeutung des Generalgouvernements durch das Deutsche Reich 1939–1945, in: Jacek Mlynarczyk (Hrsg.): Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939–1945, Osnabrück 2009, S. 103–129; Tadeusz Janicki: Die deutsche Wirtschaftspolitik in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939–1945, in: ebd., S. 79–102; Bogdan Musial: Recht und Wirtschaft im besetzten Polen 1939–1945, in: Johannes Bähr/Ralph Banken (Hrsg.): Das Europa des „Dritten Reichs“. Recht, Wirtschaft, Besatzung, Frankfurt/M. 2005, S. 31–57; Roth, Herrenmenschen, S. 119–174.
83 Siehe vor allem: Gerhard Wolf: Ideologie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012; Philip T. Rutherford: Prelude to the Final Solution. The Nazi Program for Deporting Ethnic Poles, 1939–1941, Lawrence 2007; Isabel Heinemann: Rasse, Siedlung, „deutsches Blut“. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen 2003; Michael G. Esch: „Gesunde Verhältnisse“. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in Ostmitteleuropa 1939–1950, Marburg 1998; Mechthild Rössler/Sabine Schleiermacher (Hrsg.): Der „Generalplan Ost“. Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, Berlin 1993.
84 Siehe insbesondere: Wlodzimierz Borodziej: Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1944, Warszawa 1985; deutsche Fassung: Terror und Politk. Die deutsche Polizei und die polnische Widerstandsbewegung 1939–1944, Mainz 1999.
85 Christoph Kleßmann: Die Selbstbehauptung einer Nation. Nationalsozialistische Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung im Generalgouvernement 1939–1945, Düsseldorf 1971; Hans-Christian Harten: De-Kulturation und Germanisierung. Die nationalsozialistische Rassen- und Erziehungspolitik in Polen 1939–1945, Frankfurt/M. 1996.
86 Hans-Jürgen Bömelburg: Die Erinnerung an die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs in Polen – Transformationen und Kontinuitäten der polnischen Erinnerungskultur, in: Bernd Faulenbach/Franz-Josef Jelich (Hrsg.): „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen 2006, S. 55–78.
87 Jerzy Marczewski: The Aims and Character of the Nazi Deportation Policy as Shown by the Example of the „Warta Region“, in: Polish Western Affairs 2 (1969), S. 235–262; ders.: Hitlerowska koncepcja polityki kolonizacyjno-wysiedleńczej i jej realizacja w „Okręgu Warty“, Poznań 1979; eine neuere Studie mit ähnlichem Schwerpunkt: Czesław Łuczak: Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty), Poznań 1996.
88 Siehe beispielsweise: Zygmunt Klukowski: Pacyfikacje i egzekucje masowe w powiecie zamojskim w latach 1939–1945, in: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 5 (1949), S. 171–205; Jerzy Markiewicz: Nie dali ziemi skąd ich ród. Zamojszczyzna 27 XI 1942–31 XII 1943, Lublin 1967; Madajczyk, Zamojczyzna.
89 Allein mehrere Tausend Studien beschäftigen sich mit dem Warschauer Aufstand: Władysław Henzel: Powstanie warszawskie 1944 r. Bibliografia selektywna, Warschau 1994–2004; siehe außerdem: Tomasz Szarota: Warschau unter dem Hakenkreuz. Leben und Alltag im besetzten Warschau 1.10.1939 bis 31.7.1944, Paderborn 1985.
90 Ulrich Herbert: Arbeit und Vernichtung. Über Konvergenzen und Widersprüche nationalsozialistischer Politik, Vortrag in der Arbeitskammer Wien am 27.7.2007 im Rahmen der Tagung „Arbeit und Vernichtung“ des Wiener Wiesenthal Centers für Holocaust-Studien: http://www.vwi.ac.at/aktagung/starttagung_ak.htm.
91 Siehe insbesondere: Stephan Lehnstaedt: Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939–1944, München 2010; sowie die einzelnen Beiträge in: Jochen Böhler/Stephan Lehnstaedt (Hrsg.): Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, Osnabrück 2012.
92 Barbara Engelking: „Sehr geehrter Herr Gestapo“. Denunziationen im deutsch besetzten Polen 1940/41, in: Klaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial (Hrsg.): Genesis des Genozids. Polen 1939–1941, Darmstadt 2004, S. 206–220; dies.: Jest taki piękny słoneczny dzierń Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.
93 Jan Grabowski: Judenjagd. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.
94 Stephan Lehnstaedt/Ruth Leiserowitz: Polen und Juden unter deutscher Besatzung. Einführung in eine aktuelle Debatte über nachbarschaftliche Verhältnisse, in: sehepunkte 7/8 (2011) [15.07.2011], URL: http://www.sehepunkte.de/2011/07/forum/polen-und-juden-unter-deutscher-besatzung-einfuehrung-in-eine-aktuelle-debatte-ueber-nachbarschaftliche-verhaeltnisse-149/ [letzter Zugriff: 6.6.2014].
95 Ingo Loose: Judenmord im nationalsozialistisch besetzten Polen. Neue Forschungen zu den Beziehungen zwischen Polen und Juden im Generalgouvernement 1939–1945 (Rezension), in: sehepunkte 7/8 (2011) [15.07.2011], URL: http://www.sehepunkte.de/2011/07/20322.html.
96 Zur Vorkriegszeit siehe jetzt: Winson Chu: The German Minority in Interwar Poland, Cambridge 2012; außerdem: Rudolf Jaworski u.a. (Hrsg.): Deutsche und Polen zwischen den Kriegen. Minderheitenstatus und „Volkstumskampf“ im Grenzgebiet. Amtliche Berichterstattung aus beiden Ländern, 2 Bde., München 1997; Richard Blanke: Orphans of Versailles. The Germans in Western Poland 1918–1939, Lexington 1993.
97 Siehe beispielsweise: Christian Jansen/Arno Weckbecker: Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40, München 1992; Doris Bergen: The Nazi Concept of „Volksdeutsche“ and the Exacerbation of Anti-Semitism in Eastern Europe 1939–1945, in: Journal of Contemporary History 29 (1994), S. 569–582; dies.: The „Volksdeutschen“ of Eastern Europe, World War II, and the Holocaust: Constructed Ethnicity, Real Genocide, in: Yearbook of European Studies 13 (1999), S. 70–93; dies.: The Volksdeutsche of Eastern Europe and the Collapse of the Nazi Empire, 1944–1945, in: dies./Alan E. Steinweis/Daniel E. Rogers (Hrsg.): The Impact of Nazism: New Perspectives on the Third Reich and its Legacy, Lincoln 2003, S. 101–128; für einen anderen räumlichen Zusammenhang siehe außerdem: Eric C. Steinhart: Creating Killers: The Nazification of the Black Sea Germans and the Holocaust in Southern Ukraine, 1941–1944, in: Bulletin of the German Historical Institute Washington, D.C. 50 (2012), S. 57–74.
98 Siehe hierzu die Studien so unterschiedlicher Historiker wie Eugeniusz Duraczyński, Jan Tomasz Gross, Jerzy Borejsza, und Wolfgang Jacobmeyer: Eugeniusz Duraczyński: Wojna i okupacja. Wrzesień 1939 – Kwiecień 1943, Warszawa 1974, S. 92; Jan Tomasz Gross: Polish Society under German Occupation. The General Government 1939–1944, Princeton 1979, S. XI; Jerzy W. Borejsza: Antyslawizm Adolfa Hitlera, Warszawa 1988; Wolfgang Jacobmeyer: Der Überfall auf Polen und der neue Charakter des Krieges, in: Christoph Kleßmann (Hrsg.): September 1939. Krieg, Besatzung, Widerstand in Polen, Göttingen 1989, S. 16–37, hier: S. 23–26; Jochen Böhler: Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt/M. 2006, S. 24ff.
99 John Connelly: Nazis and Slavs. From Racial Theory to Racist Practice, in: Central European History 32 (1999), S. 1–33; ders.: Why the Poles Collaborated so Little. And Why That Is No Reason for Nationalist Hubris, in: Slavic Review 64 (2005), S. 771–781; siehe auch: Dieter Pohl: Der Holocaust und die anderen NS-Verbrechen: Wechselwirkungen und Zusammenhänge, in: Frank Bajohr/Andrea Löw (Hrsg.): Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, Frankfurt/M. 2015, S. 124–140, hier: S. 128.
100 Doris L. Bergen: Instrumentalization of Volksdeutschen in German Propaganda in 1939. Replacing/Erasing Poles, Jews, and Other Victims, in: German Studies Review 31 (2008). S. 447–470; Miriam Arani: Fotografische Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen im Reichsgau Wartheland 1939–1945. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wiekopolska, Hamburg 2008; dies.: Wie Feindbilder gemacht wurden. Zur visuellen Konstruktion von „Feinden“ am Beispiel der Fotografien der Propagandakompanien aus Bromberg 1939 und Warschau 1941, in: Rainer Rother/Judith Prokasky (Hrsg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkriegs, München 2010, S. 150–163.
101 Dieter Pohl: War, Occupation and the Holocaust in Poland, in: Dan Stone (Hrsg.): The Historiography of the Holocaust, London 2004, S. 88–119, hier: S. 88; siehe beispielsweise: The Polish Ministry of Information (Hrsg.): The German Invasion of Poland. Polish Black Book containing documents, authentical reports, and photographs, London (o. J.) [1940]; dass. (Hrsg.): The German New Order in Poland, London 1941; dass. (Hrsg.): The Black Book of Poland, New York 1942; dass. (Hrsg.): The Quest for German Blood, London 1943.
102 Neben den Akademien der Wissenschaften und den Universitäten entwickelten sich insbesondere die Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (Hauptkommission zur Untersuchung deutscher Verbrechen in Polen) und das Instytut Zachodni (Westinstitut) in Posen zu prägenden Institutionen. Mit ihren Quelleneditionen und Publikationsreihen lieferten beide Institutionen die Fundamente jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der deutschen Besatzung. Von herausragender Bedeutung sind die Reihe Documenta Occupationis Teutonicae des Westinstituts sowie das Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce der Hauptkommission. Wichtig waren ferner auch die Zeitschriften Przegląd Zachodni des Westinstituts und Dzieje Najnowsze.
103 Hans-Jürgen Bömelburg: Die deutsche Besatzungspolitik in Polen 1939 bis 1945, in: Bernhard Chiari (Hrsg.): Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, München 2003, S. 51–86, hier: S. 52.
104 Zu den Opferzahlen siehe: Mateusz Gniazdowski: „Ustalić liczbę zabitych na 6 milionów ludzi“. Dyrektywy Jakuba Bermana dla Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, in: Polski Przegląd Dyplomatyczny 41 (2008), S. 99–113; ders.: Zu den Menschenverlusten, die Polen während des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen zugefügt wurden. Eine Geschichte von Forschungen und Schätzungen, in: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 1 (2008), S. 65–92; Klaus-Peter Friedrich: Erinnerungspolitische Legitimierungen des Opferstatus. Zur Instrumentalisierung fragwürdiger Opferzahlen in Geschichtsbildern vom Zweiten Weltkrieg in Polen und Deutschland, in: Dieter Bingen/Peter Oliver Loew/Kazimierz Wójcicki (Hrsg.): Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich 1900–2005, Wiesbaden 2007, S. 176–188.
105 Bömelburg, Besatzungspolitik, S. 52.
106 Zygmunt Mańkowski: Działalność eksterminacyjna niemców wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej. Zarys koncepcji syntezy, in: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce/Instytut Pamięci Narodowej: Stan i Perspektywy Badań Historycznych Lat Wojny i Okupacji 1939 1945. Sesja 14–15 listopoada 1985 r., Warszawa 1988, S. 106–132, hier: S. 106.
107 Klaus-Michael Mallmann/Volker Rieß/Wolfram Pyta (Hrsg.): Deutscher Osten 1939–1945. Der Weltanschauungskrieg in Photos und Texten, Darmstadt 2003.
108 Siehe beispielsweise: Pohl, „Judenpolitik“; Mlynarczyk, Judenmord; Sandkühler, „Endlösung“; Michael Alberti: Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945, Wiesbaden 2006.
109 Richard C. Lukas: The Forgotten Holocaust: The Poles under German Occupation 1939–1944, Lexington 1986.
110 Bei einem Gesamtumfang von 345 Seiten schildert Lukas unterschiedliche deutsche Gewalthandlungen auf 30 Seiten. Siehe: Ebd., S. 1–30.
111 So formuliert Lukas beispielsweise: „Thus the conclusion is inescapable that had the war continuied, Poles would have been ultimately obliterated either by outright slaughter in gas chambers, as most Jews had perished, or by a continuation of the policies the Nazis had inaugurated in ocupied Poland during the war – genocide by execution, forced labor, starvation, reduction of biological propagation, and Germanization.“, zitiert nach: Ebd., S. 5; siehe auch: David Engel: Poles, Jews, and Historical Objectivity, in: Slavic Review 46 (1987), S. 568–580; die Stoßrichtung des Buches klingt bereits im Titel an. Auch wenn man konzediert, dass der Begriff „Holocaust“ im amerikanischen Sprachraum deutlich umfassender verstanden wird, als in Deutschland und Europa, so signalisiert die Rede vom „vergessenen Holocaust“ doch eine Einebnung gravierender Differenzen zwischen unterschiedlichen Verfolgungszusammenhängen.
112 Werner Röhr: Terror und Politik. Über die Funktion des Terrors für die faschistische Okkupationspolitik in Polen 1939–1945, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 43 (1995), S. 27–54.
113 Robert Seidel: Die deutsche Besatzungspolitik in Polen. Der Distrikt Radom 1939–1945, Paderborn 2006, S. 180–213; siehe hierzu die vorzügliche Rezension von Klaus-Peter Friedrich: Rezension zu: Robert Seidel, Deutsche Besatzungspolitik in Polen, in: Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 23 (2007), S. 216–218.
114 Timothy Snyder: Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, München 2011.
115 Zur Diskussion von Snyders Buch siehe insbesondere: Thomas Kühne: Great Men and Large Numbers. Undertheorising a History of Mass Killing, in: Contemporary European History 21 (2012), S. 133–143; Evans, Who remembers the Poles; Johannes Hürter: Gewalt, nichts als Gewalt. Zu Timothy Snyders Bloodlands, in: Journal of Modern European History 10 (2012), S. 446–451; Jürgen Zarusky: Timothy Snyders „Bloodlands“. Kritische Anmerkungen zur Konstruktion einer Geschichtslandschaft, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), S. 1–31.
116 Christopher R. Browning: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen, Hamburg 1993.
117 Zum Forschungsprogramm der neueren Täterforschung siehe: Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul: Sozialisation, Milieu und Gewalt. Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung, in: dies. (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004, S. 1–32; ferner: Thomas Sandkühler: Die Täter des Holocaust. Neuere Überlegungen und Kontroversen, in: Karl Heinrich Pohl (Hrsg.): Wehrmacht und Vernichtungspolitik. Militär im nationalsozialistischen System, Göttingen 1999, S. 39–65; Gerhard Paul: Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und „ganz gewöhnlichen“ Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: ders. (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, Göttingen 2003, S. 13–90; Christopher R. Browning: Die Vollstrecker des Judenmords. Verhalten und Motivation im Lichte neuer Erkenntnisse, in: ders.: Judenmord. NS-Politik, Zwangsarbeit und das Verhalten der Täter, Frankfurt/M. 2001, S. 219–257.
118 Siehe vor allem: Musial, Zivilverwaltung; Roth, Herrenmenschen.
119 Siehe beispielsweise: Ruth Bettina Birn: Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Düsseldorf 1986; Andreas Mix: Organisatoren und Praktiker der Gewalt. Die SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau, in: Timm C. Richter (Hrsg.): Krieg und Verbrechen. Situation und Intention: Fallbeispiele, München 2006, S. 123–134; Martin Cüppers: Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die Judenvernichtung 1939–1945, Darmstadt 2005.
120 Siehe insbesondere: Johannes Hürter: Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42, München 2006.
121 Zum Beispiel: Michael Wildt: Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamts, Hamburg 2002; Andrej Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943, Hamburg 2003.
122 Siehe die entsprechende Forderung bei: Jürgen Matthäus: Holocaust als angewandter Antisemitismus? Potential und Grenzen eines Erklärungsfaktors, in: Frank Bajohr/Andrea Löw (Hrsg.): Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, Frankfurt/M. 2015, S. 102–123, hier: S. 117.
123 Alexander B. Rossino: Hitler strikes Poland. Blitzkrieg, Ideology, and Atrocity, Kansas City 2003; Klaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial (Hrsg.): Genesis des Genozids. Polen 1939–1941, Darmstadt 2004; Böhler, Auftakt; ders.: Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Frankfurt/M. 2009; Klaus-Michael Mallmann/Jochen Böhler/Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008; Stephan Lehnstaedt/Jochen Böhler (Hrsg.): Die Berichte der Einsatzgruppen in Polen 1939. Vollständige Edition, Berlin 2013.
124 Rossino, Hitler, S. 191–226.
125 Böhler, Auftakt, S. 241–248.
126 Hürter, Hitlers Heerführer, S. 180.
127 Pohl, Herrschaft, S. 51.
128 Zum Folgenden: Daniel Brewing: „Wir müssen um uns schlagen“. Die Alltagspraxis der Partisanenbekämpfung im Generalgouvernement 1942, in: Jochen Böhler/Stephan Lehnstaedt (Hrsg.) Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, Osnabrück 2012, S. 497–520, hier: S. 500–502.
129 Siehe für die Forschungsdiskussion der letzten Jahre u.a.: Walter Manoschek: „Serbien ist judenfrei“. Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42, München 1993; Klaus Naumann/Hannes Heer (Hrsg.): Vernichtungskrieg. Die Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944, Hamburg 1995; Timm C. Richter.: „Herrenmensch“ und „Bandit“. Deutsche Kriegsführung und Besatzungspolitik als Kontext des sowjetischen Partisanenkrieges (1941–1944), Münster 1998; Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944, Hamburg 1999; Ben Shepherd: War in the Wild East: the German Army and Soviet Partisans, Cambridge 2004; Philip W. Blood: Hitler’s Bandit Hunters. The SS and the Nazi Occupation of Europe, Washington, D.C. 2006; die sowjetische Seite wurde jetzt ebenfalls in den Blick genommen, vgl. v.a.: Alexander Brakel: Unter Rotem Stern und Hakenkreuz: Baranowicze 1939–1944. Das westliche Weißrussland unter sowjetischer und deutscher Besatzung, Paderborn 2009; siehe auch: Bogdan Musial: Sowjetische Partisanen 1941–1944. Mythos und Wirklichkeit, Paderborn 2009.
130 Hannes Heer: Die Logik des Vernichtungskrieges. Wehrmacht und Partisanenkampf, in: ders./Klaus Naumann: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944, Hamburg 1995, S. 104–138, hier: S. 107.
131 Siehe die Forschungsberichte: Lutz Klinkhammer: Der Partisanenkrieg der Wehrmacht 1941–1944, in: Rolf-Dieter Müller/Hans-Erich Volkmann (Hrsg.): Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999, S. 815–836; Ben Shepherd: The Clean Wehrmacht, the War of Extermination, and Beyond, in: The Historical Journal 52 (2009), S. 455–473; zuweilen dienen Studien zur deutschen Partisanenbekämpfung der Stillung von tagesaktuellen Deutungs- und Orientierungsbedürfnissen, insbesondere im anglo-amerikanischen Raum: Ben Shepherd/Juliette Pattinson: Partisan and Anti-Partisan Warfare in German-Occupied Europe, 1939–1945: Views from Above and Lessons for the Present, in: The Journal of Strategic Studies 31 (2008), S. 675–693.
132 Hierzu zählen nach Klaus Jochen Arnold etwa Angst, Rachegefühle, Opportunismus, Karrierestreben und Solidarisierungsmechanismen. Vgl.: Klaus Jochen Arnold: Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“, Berlin 2005, S. 26ff.
133 Siehe hierzu insbesondere: Gerlach, Morde, S. 859–1055.
134 Vgl. Peter Lieb: Konventioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg? Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München 2007; ders.: Repercussions of Eastern Front Experiences on Anti-Partisan Warfare in France 1943–44, in: The Journal of Strategic Studies 31 (2008), S. 797–823; Carlo Gentile: Wehrmacht und Waffen-SS im Partisanenkrieg. Italien 1943–1945, Paderborn 2012.
135 Czesław Madajczyk: Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939–1945. Zestawienie większych akcji represyjnych, Warszawa 1965.
136 Józef Fajkowski: Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, Warszawa 1972; ders./Jan Religa: Zbrodnie hitlerowskiej na wsi polskiej 1939–1945, Warszawa 1981.
137 Siehe zur Intelligenzaktion vor allem: Barbara Bojarska: Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień – grudzień 1939), Poznań 1979; Paweł Dubiel: Wrzesień na Śląsku, Katowice 1963; Dieter Schenk: Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreußen, Bonn 2000; Maria Wardzyńska: Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce Intelligenzaktion, Warzawa 2009.
138 Wolfgang Sofsky: Auschwitz, in: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hrsg.): 200 Tage und 1 Jahrhundert. Gewalt und Destruktivität im Spiegel des Jahres 1945, Hamburg 1995, S. 83–97, hier: S. 84.
139 Franciszek Piper: Die Rolle des Lagers Auschwitz bei der Verwirklichung der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik. Die doppelte Funktion von Auschwitz als Konzentrationslager und als Zentrum der Judenvernichtung, in: Ulrich Herbert/Karin Orth/Christoph Dieckmann (Hrsg.): Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Bd. 2, Frankfurt/M. 2002, S. 390–414; Sybille Steinbacher: Auschwitz. Geschichte und Nachgeschichte, München 2004.
140 Levene, Introduction, S. 11.
141 Jacques Sémélin hat in diesem Sinne darauf aufmerksam gemacht, „dass Massaker vor allem […] von Staaten [begangen werden, D. B.], die sich für verwundbar halten oder glauben, einen Krieg nicht gewinnen zu können, wenn sie nicht bis zur Vernichtung von Teilen der Zivilbevölkerung gehen“. Siehe: Sémélin, Elemente, S. 20.
142 Böhler, Auftakt.
143 Zitiert nach: Schuller, Als Winicjusz Natoniewski um sein Leben lief.
144 Siehe hierzu: Lehnstaedt, Okkupation, S. 36.
145 Im Generalgouvernement hingegen waren die Bedingungen für die Formierung von Widerstandsgruppen aus zwei Gründen besser: zum einen fehlten – zumindest in den ersten Jahren der deutschen Besatzung – jene übergriffigen Zwangsmaßnahmen, die zum Kern einer völkischen Neuordnung zählten und in den eingegliederten Gebieten schwere Verwüstungen hinterließen. Zum anderen waren die nationalsozialistischen Besatzungsbehörden auf die partielle Zusammenarbeit mit Teilen der polnischen Bevölkerung angewiesen: so wurden örtliche Funktionsträger auf regionaler Ebene in die Verwaltung der besetzten Gebiete eingebunden. Diese spezifische Konstellation förderte dabei zwar durchaus gelegentlich regelrechte Kollaboration, öffnete aber auch Handlungsspielräume für die polnische Gesellschaft, die in den eingegliederten Gebieten in dieser Form nicht existierten. Siehe: Wlodzimierz Borodziej: Politische und soziale Konturen des polnischen Widerstands, in: Christoph Klessmann (Hrsg.): September 1939. Krieg, Besatzung und Widerstand in Polen, Göttingen 1989, S. 95–116; Grzegorz Mazur: Der Widerstand im Generalgouvernement, in: Jacek Mlynarczyk (Hrsg.): Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939–1945, Osnabrück 2009, S. 405–426.
146 Hier waren die Bedingungen durch die flächendeckende Ermordung der polnischen Intelligenz, die massenhaften Vertreibungen und den permanenten Germanisierungsdruck insgesamt ungünstig. Dennoch gelang es vereinzelten Widerstandsgruppen, Spionage- und Sabotageaktionen vor allem in Oberschlesien durchzuführen, doch zu bewaffneten Formen des Widerstands kam es erst Ende 1944 und auch nur in einzelnen Regionen. Siehe z.B.: Aleksandra Pietrowicz: Die Widerstandsbewegung in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939–1945, in: Jacek Mlynarczyk (Hrsg.): Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939–1945, Osnabrück 2009, S. 427–452.
147 Michael Wildt: Differierende Wahrheiten. Historiker und Staatsanwälte als Ermittler von NS-Verbrechen, in: Norbert Frei/Dirk van Laak/Michael Stolleis (Hrsg.): Geschichte vor Gericht. Historiker, Richter und die Suche nach Gerechtigkeit, München 2000, S. 46–57.