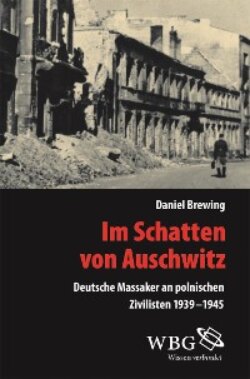Читать книгу Im Schatten von Auschwitz - Daniel Brewing - Страница 13
Akteurskonstellationen, Eskalationsmechanismen und Praxis der Massaker
ОглавлениеIn einem zweiten Schritt stellen sich Fragen nach den Akteuren, den Eskalationsmechanismen und der Praxis der Massaker. Dazu kann die vorliegende Studie zunächst an wichtige Untersuchungen der polnischen Forschung anknüpfen: Nachdem eine erste Beschäftigung mit unterschiedlichen Gewaltphänomenen der Besatzungsherrschaft noch während des Krieges eingesetzt hatte,101 erstellten polnische Historiker nach 1945 fortlaufend akribische Beschreibungen zahlreicher Massaker in einzelnen Dörfern, Städten und Regionen.102 Es sind diese zahllosen Einzelstudien, wie Hans-Jürgen Bömelburg zu Recht betont hat, die nach wie vor die Grundlage jeder Beschäftigung mit den Gewaltphänomenen unter deutscher Besatzung liefern.103 Ist die Lektüre dieser frühen Studien mit ihren langen Aufzählungen von Tatorten, Tätern und den Namenslisten der Opfer zuweilen auch ermüdend, so sind ihre großen Verdienste doch nicht zu übersehen: Durch diese reichhaltige Detailarbeit gelang es, jene Welt der Gewalt unter deutscher Herrschaft überhaupt zu rekonstruieren. |28|Aus mehreren Gründen sind diese Studien jedoch revisionsbedürftig. Zum einen präsentierten sie lediglich Ausschnitte, lieferten Beschreibungen des Geschehens und verzichteten in der Regel auf eine Analyse. So handelt es sich hierbei in erster Linie um deskriptive Studien: Entscheidungsabläufe, Akteurskonstellationen und Eskalationsmechanismen, Gewaltpraktiken und besatzungspolitische Einbindung der Massaker wurden weitgehend ausgeblendet. Zum anderen sind diese Studien auch als Kinder ihrer Zeit anzusehen: Sie entstanden in der spezifischen Konstellation des Kalten Krieges und unter den Vorgaben der kommunistischen Machthaber, die im Zeitablauf zu eigentümlichen Verzerrungen geführt haben. So zeichneten sie sich durch eine Einebnung der fundamentalen Unterschiede zwischen der polnischen und jüdischen Besatzungserfahrung aus und suggerierten dabei, dass Polen und Juden auf gleiche Weise von deutscher Gewalt betroffen worden wären. In diesem Zusammenhang verwiesen polnische Historiker stets auf die vermeintliche Parität der Opferzahlen: Den drei Millionen ermordeter polnischen Juden stellten sie die fiktive, vom kommunistischen Sicherheitsapparat festgelegte Zahl von drei Millionen ermordeter Polen gegenüber.104 Mit einer ideologischen Schere im Kopf zeichneten polnische Historiker vielfach darüber hinaus ein dichotomisch verzerrtes Bild nationalsozialistischer Herrschaft, das frei von Grautönen und Ambivalenzen war und insbesondere die Einbindung bestimmter Gruppen der polnischen Bevölkerung weitgehend ausblendete.105 So zog Zygmunt Mańkowski ein ernüchterndes Fazit unter die Erträge der polnischen Forschung: „Dieses Problem ist nämlich bis heute noch nicht kohärent, umfassend […] und mit den neuesten geschichtswissenschaftlichen Methoden bearbeitet worden.“106
|29|In der westlichen Forschung hingegen hat die Konzentration auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden andere Verfolgungskontexte zweifellos überschattet. Zwar ist es in den letzten Jahren gelungen, das Bild des „Deutschen Ostens“107 durch Illustrierung seines spezifischen antisemitischen Gewaltniveaus schärfer zu konturieren.108 Allerdings führte diese Fokussierung zur Ausblendung anderer Verfolgungskontexte. Vor diesem Hintergrund ist die westliche Forschungslandschaft zu deutschen Massakern an polnischen Zivilisten überschaubar. Richard C. Lukas gebührt das Verdienst, das polnische Leiden erstmals für ein westliches Publikum aufbereitet zu haben.109 Grundsätzlich zielte Lukas jedoch weniger auf eine Analyse der Strukturen, Praktiken und Akteure massenhafter Gewalt gegen polnische Zivilisten, die den geringsten Teil seines Buches einnimmt.110 Vielmehr handelt es sich hierbei um einen polemischen Beitrag zur Diskussion um die polnisch-jüdische Opferkonkurrenz.111 Darüber hinaus ist lediglich auf einen schlanken Aufsatz Werner Röhrs112 und eine räumliche begrenzte Studie Robert Seidels113 zum Distrikt Radom zu verweisen, der die ältere polnische Literatur zum deutschen „Terror“ auswertet, dabei jedoch die Unschärfen der polnischen Historiographie zum Teil reproduziert. Erst in jüngster Zeit ist es Timothy Snyder mit narrativer |30|Wucht gelungen, im Kontext einer umfassenden Gewaltgeschichte Ostmitteleuropas dem polnischen Leiden gebührenden Raum einzuräumen.114 Seine Leistung liegt aber in erster Linie in der eindringlichen Schilderung und Präsentation ausgewählter Ereignisse; für die Analyse greift Snyder im Kern auf die Intentionen der deutschen Führungsebene zurück.115 An all diese Forschungen kann die vorliegende Studie anknüpfen und sie durch Analyse der Dynamik und Prozesshaftigkeit nationalsozialistischer Gewaltentfaltung, durch eine Untersuchung der unterschiedlichen Interessenlagen verschiedener Gewaltakteure, eine Beleuchtung der Legitimationsstrategien und Kontexte sowie durch eine Nahsicht auf die konkrete Umsetzung der Massaker erweitern. Sie steht dabei jedoch nicht isoliert im Raum, sondern kann an drei Forschungsrichtungen anknüpfen, die wichtige Befunde zur nationalsozialistischen Gewaltgeschichte geliefert haben.
(1) Die neuere Täterforschung hat sich den Motiven und Biographien „ganz normaler Männer“116 aus den mittleren und unteren Hierarchieebenen der militärischen, zivilien und polizeilichen Apparate gewidmet.117 Für die vorliegende Studie sind insbesondere Studien zur Zivilverwaltung118, zum SS- und Polizeiapparat119 und zur Wehrmacht120 von besonderer Bedeutung. Die Forschung |31|konnte dabei eindrücklich zeigen, dass ganz verschiedene Akteure mit unterschiedlichem biographischen Hintergrund und institutioneller Zugehörigkeit für die Ingangsetzung und Implementierung der „Endlösung“ verantwortlich zeichneten: keine generationelle Kohorte, kein soziales oder ethnisches Herkunftsmilieu, keine Konfession, keine Bildungsschicht, kein Geschlecht zeigte sich resistent gegenüber einer Einbindung in die Gewaltmaßnahmen. Außerdem konnte die Täterforschung herausarbeiten, dass die Täter keineswegs willenlos handelnde, von abstrakten Strukturen gesteuerte Akteure waren. Vielmehr zeigten die Täter ein hohes Maß an Eigeninitiative, besaßen durchaus Handlungsfreiheiten und verfolgten eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen, Wünsche und Ziele.121 Allerdings bezogen sich die Befunde der neueren Täterforschung in erster Linie auf den Verfolgungskontext der „Endlösung“. Andere nationalsozialistische Verfolgungszusammenhänge sind bislang kaum mit den Methoden der Täterforschung beleuchtet worden. Hier kann die vorliegende Studie wichtige Ergänzungen liefern, indem sie Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in der Praxis der Gewalt herausarbeitet.122
(2) Wichtige Anknüpfungspunkte bieten sich ferner zu neueren Studien, die sich mit dem Krieg und den ersten beiden Jahren der deutschen Besatzungsherrschaft beschäftigen. Zu dieser formativen Phase nationalsozialistischer Gewaltgeschichte liegt mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen vor, deren gemeinsamer Befund die zunehmende Einebnung der Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten ist.123 Die Forschung zeichnete dabei ein Bild eines Krieges, der auch und vor allem geprägt wurde von zahlreichen Massakern an polnischen und jüdischen Zivilisten durch Soldaten der Wehrmacht und Angehörige der Einsatzgruppen. Die Erklärungsansätze divergieren dabei |32|erheblich und reichen von einem weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus124, über die Angst- und Stressreflexe einer unerfahrenen Truppe125 und einem entgrenzten militärischen Sicherheitsbedürfnis126 bis hin zum „Fehlen jeglicher äußerer Kontrolle“127. Mit diesen Studien liegen umfassende Ergebnisse zur Frühphase der deutschen Besatzungsherrschaft vor. Zugleich ist ihr Untersuchungszeitraum jedoch begrenzt, so dass vier Jahre der deutschen Besatzungsherrschaft weiter im Dunkeln liegen. Die vorliegende Studie kann an diese Studien daher unmittelbar aufbauen und die Massaker an polnischen Zivilisten über den gesamten Zeitraum der deutschen Besatzung analysieren.
(3) Dabei kann sie schließlich auch an Studien zur Partisanenbekämpfung anschließen. In den letzten Jahren wurde die deutsche Partisanenbekämpfung als ein zentrales Handlungsfeld identifiziert, in dessen Kontext massenhafte Gewalt gegen Zivilisten ausgeübt worden ist.128 Auf breiter empirischer Grundlage wurde ein neues, differenziertes Gesamtbild der Partisanenbekämpfung gezeichnet, das jahrzehntelang kolportierte Vorstellungen von einer vermeintlich legitimen Notwehr gegen „hinterhältige Banden“, „heimtückische Saboteure“ und „feige Heckenschützen“ revisionsbedürftig machte.129 Analytische Aufmerksamkeit fand nun die zunehmend ausweglose Situation der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten, die zwischen die Mühlsteine der militärischen Auseinandersetzung von Partisanen und deutscher Besatzungsmacht geriet und so zu wehrlosen Opfern einer sich stetig radikalisierenden und brutalisierenden Praxis der deutschen Partisanenbekämpfung wurde. Ohne Rekurs auf die simplifizierende Denkfigur eines „Partisanenkampfes |33|ohne Partisanen“130, deren Protagonisten die schiere Existenz einer Partisanenbewegung in Abrede stellten und die deutsche Partisanenbekämpfung als reinen Vorwand zur Durchsetzung rassenideologischer Zielsetzungen interpretierten, wird von der Forschung fast einhellig die unverhältnismäßige Gewaltanwendung im Rahmen von „Bandenkampfaktionen“ betont, die auch und vor allem die lokale Zivilbevölkerung traf.131 Ist dieser Befund weithin unstrittig, so sind doch zum Teil erhebliche Divergenzen in den jeweiligen Erklärungsansätzen für diese spezifische Form rücksichtsloser Gewalt gegen Zivilisten zu verzeichnen. Im Kern dreht sich die Debatte um die Gewichtung kultureller, intentionaler und situativer Faktoren, um die Auslotung des Verhältnisses von „anthropologischen Konstanten“132, rassenbiologischen Weltbildern, besatzungspolitischen Strategien und „militärischen Notwendigkeiten“. Dabei wurden auch Zusammenhänge mit analogen Gewaltkomplexen und Verflechtungen mit kriegswirtschaftlichen Politikfeldern im Kontext eines andauernden Krieges analysiert, die in der Summe eine grundsätzliche Multifunktionalität der Partisanenbekämpfung andeuteten, die über die reine Herstellung von Sicherheit hinausging.133
Diesem Forschungsschub steht allerdings eine räumliche Verengung einschlägiger Studien auf die besetzten Gebiete der Sowjetunion und den Balkan gegenüber, eine Begrenzung, die angesichts der Dimensionen des Partisanenkrieges in diesen Regionen sicherlich legitim ist, aber weite Landstriche des besetzten Europas kaum erfasst. Zwar haben diese Ansätze zuletzt durch einzelne Arbeiten eine räumliche Perspektiverweiterung erhalten, indem Transfer- und Adaptionsprozesse von Methoden der Bandenbekämpfung aus dem besetzten Osteuropa in westeuropäischen Regionen analysiert wurden.134 |34|Doch insbesondere das besetzte Polen hat unter diesem Aspekt kaum Interesse der Forschung auf sich gezogen. Hier liegen lediglich die überwiegend deskriptiven Studien Czesław Madajczyks135 und Józef Fajkowskis136 vor, die bislang nicht weitergeführt worden sind. Fragen nach den Akteuren, Funktionen und Formen der Massaker im Kontext der Auseinandersetzung mit der polnischen Partisanenbewegung sind bislang unbeantwortet.