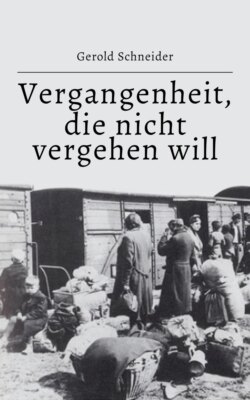Читать книгу Vergangenheit, die nicht vergehen will - Gerold Schneider - Страница 12
Der lange Marsch
ОглавлениеDie vom Herrn Erschlagenen liegen an jenem Tag von einem Ende der Erde bis zum andern. Man beklagt sie nicht, man sammelt sie nicht und begräbt sie nicht; sie werden zum Dünger auf dem Acker. (Jer 25,33)
Am Straßenrand in Zyrus, dort wo am 13. Februar die Panzer- und Fahrzeugkolonne der Russen stand, sahen wir die ersten toten deutschen Soldaten liegen. Niemand konnte sie begraben. Bald erfuhren wir, daß das Begraben deutscher Soldaten aus - drücklich untersagt war, während man die russischen Gefallenen schon bestattet hatte. Überall Schrott, weggeworfene Waffen und Zeichen des Kampfes. Zwischen - durch mußten wir immer wieder in den Straßengraben, weil uns russische Nach - schubkolonnen entgegen kamen. Als wir endlich in Zolling eintrafen, war es schon dunkel. In einem Bauernhof - unterhalb der uralten Wallfahrtskirche, rechts von der ansteigenden Straße - wurden wir zum Nachtquartier eingesperrt. Auf der Kopfstein - pflasterstraße sah ich noch verstreut herumliegende, zertretene Meßgewänder und Kirchengerät aus der nahen Wallfahrtskirche, deren Bau vor über 750 Jahren von der heiligen Hedwig veranlaßt wurde.
Das Dorf - ein wohlhabendes Bauerndorf - schien völlig leer. Wenn sich jemand von den Bewohnern dort noch aufhielt, so hatte er sich gut versteckt. Einer unserer Ka -
meraden, ein Bauer aus Herwigsdorf, machte sich auf die Suche nach etwas Eßba - rem. Denn im Wohnhaus war - wie in den Freystädter Häusern - ein schreckliches Durcheinander. Wir mußten erst Platz schaffen, um uns auf den Fußboden legen zu können. Unser Kamerad wurde tatsächlich fündig: Kartoffeln, die sogleich in einem herumliegenden Topf aufgesetzt wurden, und - er fand sogar die Räucherkammer unter dem Dachboden, die die Russen beim Plündern nicht entdeckt hatten. Wir ver - sorgten uns mit Speck, Schinken und Wurst, und das war für den langen Marsch, von dem wir allerdings noch nichts wußten, unsere Rettung.
Am nächsten Morgen ging es sehr zeitig weiter. Nach einigen Kilometern erreichten wir die Reichsstraße 5 (Berlin- Breslau) und marschierten in Richtung Polkwitz wei - ter; denn in Glogau wurde noch geschossen. Auf dieser Fernstraße sah man schreck - liche Dinge. Auch hier gefallene deutsche Soldaten am Straßenrand. Einer - ich erin - nere mich genau - lag mitten auf der Straße, von den schweren LKW’s völlig platt - gewalzt, mindestens 1 Meter breit und 2,5 Meter lang. Menschenfleisch mit Uni - formfetzen vermischt, und ein von Panzerketten plattgedrückter Stahlhelm. Die rus - sischen Wachsoldaten hatten wieder einmal eine sadistische Anwandlung und erlaub - ten nicht, daß wir auswichen. Wir mußten über den Toten laufen - einige versuchten zu springen, andere gingen auf Zehenspitzen. Wochen später - so habe ich es gehört, aber nicht selbst erlebt - sollen die Russen zurückgebliebene Frauen gezwungen haben, große Gruben zu schaufeln, wo die toten Soldaten hineingeworfen wurden. Nach zwanzig Kilometern begannen die Russenbewacher uns anzutreiben. Das Wort
„Dawai“ und danach immer einer der russischen Mutterflüche sollten uns von da an viele Monate begleiten. Endlich in Polkwitz angekommen, wurden wir wieder in einen verlassenen Bauernhof getrieben. An dieser Hauptstraße, die schon früher Heerstraße hieß und von Friedrich II. gebaut wurde, müssen schwere Kämpfe getobt haben. Fürchterliche Trümmer und Spuren sahen wir. Aus dem Wohnhaus des Bau - ernhauses sollten wir die letzten Möbel herausräumen, damit wir auf dem Fußboden Platz hatten. Ich rannte unter dem Dawai des Postens vom Wohn- in das Schlafzim - mer: Erschrocken sah ich im Ehebett eine Tote liegen, eine ganz junge Frau in wei - ßer Bettwäsche und geronnenem Blut. Das totenbleiche Gesicht unterstrich sogar ihre Schönheit. Das Bett mit der Toten mußte stehenbleiben, alle anderen Möbel raus, so befahl fluchend der Russe. Es gab keine Möglichkeit, ihren Namen festzu - stellen, keine Möglichkeit, sie zu begraben, so verbrachten wir dort mit ihr die Nacht.
Als ich Jahrzehnte später den Bericht von Robert Jungk las, „Schlesien - ein Toten - land“, er hatte ihn im November 1945 in der Schweiz und in USA veröffentlicht, standen mir diese - bereits verdrängten - Bilder der Vernichtung erneut vor Augen. Robert Jungk, während der siebziger Jahre bekannt als Futurologe, war während der
dreißiger Jahre als junger Jude dem Morden in Hitlers Konzentrationslagern nur knapp entkommen. Er unternahm im Sommer 1945, kurz nach der ersten wilden Vertreibung, eine Reise durch Schlesien. Er schrieb über die Zustände in Schlesien, wie er sie wenige Monate nach dem Einmarsch der roten Armee erlebte:
„ Wer die polnische Zone (d. i. Schlesien) verlassen hat and in russisch okkupiertes Gebiet gelangt, atmet geradezu auf. Hinter ihm liegen leer geplünderte Städte, Pest - dörfer, Konzentrationslager, öde, unbestellte Felder, leichenbesäte Straßen, an denen Wegelagerer lauern und Flüchtlingen die letzte Habe rauben... Hinter der Oder- Neiße-Linie beginnt das Land ohne Sicherheit, das Land ohne Gesetz, das Land der Vogelfreien, das Totenland... Es geht hier um noch viel mehr als „nur“ um das Leben einiger Millionen Deutscher, es geht um die moralische Reinheit und Stärke der anti - faschistischen Bewegung in der Welt. Wenn alle diejenigen, die Hitler und Mussolini unter großen Opfern bekämpften, um eine bessere Welt aufzubauen, es zulassen, daß ihr Kampf jetzt von Rowdies und Chauvinisten ausgenutzt und beschmutzt wird, dann sehen wir keine große Hoffnung für die Zukunft. Man hat mit Recht den Deutschen vorgeworfen, daß sie ... so lange die Augen vor den Greueltaten des Nazismus ver - schlossen hätten. Sollen die Vorkämpfer der Demokratie später einmal den gleichen Vorwurf auf sich sitzen lassen müssen? Auch wir werden „Mitschuldige“ sein, wenn wir nicht täglich und stündlich die Schandtaten, die heute im Namen der Demokratie und der Freiheit begangen werden, enthüllen“. 6
Robert Jungk mußte doch in der westlichen Welt, weil er dem Konzentrationslager gerade so entkommen war, als glaubwürdiger Zeuge gelten. Dennoch bewirkte seine Veröffentlichung wenig. Viele Amerikaner schenkten ihm keinen Glauben, viele - auch Westdeutsche - warfen ihm Übertreibungen vor, vermutlich weil solch wahn - sinniger Terror die Vorstellungskraft zivilisierter Menschen um Größenordnungen überstieg. Im 26. Juni 1945 beschlossen sogar die Vereinten Nationen, den deutschen Vertriebenen einen „Flüchtlingsstatus“ im Sinne der Charta der UN nicht zuzuerken - nen.
Am nächsten Morgen ging es weiter auf der Heerstraße in Richtung Steinau an der Oder. Hier hatten die Russen schon um den 24. Januar 1945 einen Brückenkopf westlich der Oder gebildet. Hier hatte die deutsche Wehrmachtsführung alle verfüg - baren Reserven hingeworfen, um die russischen Truppen zurückzudrängen. Die Res - te des Kampfes wurden immer dichter. Viele abgeschossene und ausgebrannte Pan - zer, darunter - wenn auch wenige deutsche - zerschossene Autos, stehengebliebene Kanonen und dazwischen überall tote deutsche Soldaten in ihren Winteruniformen, aber alle ohne Stiefel. Kurz vor dem Oderübergang blieben wir in einer verlassenen Gärtnerei. Im Vorgarten lagen zwei tote Soldaten hinter ihrem Maschinengewehr, der eine hatte noch die Patronengurte in der Hand, als ob sie gerade noch geschossen
6 Zitiert nach Ekkehard Kuhn, „Schlesien Brücke in Europa“, Ullsteinverlag 1996 S. 9.
hätten. Ein Stück weiter stand ein deutsches Sturmgeschütz, aus der offenen Ein - stiegsluke ragten Füße mit zerlöcherten Socken heraus, ein trostlosgroteskes Bild, das sich mir fest einprägte. - Es waren Temperaturen von etwa 7° über Null; trotz - dem lag überall Verwesungsgeruch spürbar in der Luft.
In der Gärtnerei hatten die Russen vergrabene Wertgegenstände gefunden und aus - gebuddelt. Es sah schlimm aus. Eine Kassette voller Reichsmarkscheine lag noch herum, Hundert- und Fünfzigmarkscheine überall verstreut. Dort benutzten wir Hun - dertmarkscheine als Klopapier, weil wir keins hatten und glaubten, daß deutsches Geld von den Russen als ungültig erklärt worden wäre. Tatsächlich brachten sie ja nicht nur ihre Rubel, sondern auch das sogenannte „Besatzungsgeld“ mit, das wir aber erst viel später kennenlernten. -
Wieder übernachteten wir in einem Bauernhaus, das erst ausgeräumt werden mußte. Ein Erlebnis aus diesem Hof, an den die Gärtnerei anschloß, ist noch ganz lebendig: Die Ställe waren leer, die Wohnungseinrichtung verwüstet, im Vorgarten lagen zwei tote deutsche Soldaten. Auf dem Hof sahen wir unter toten Hühnern ein Schwein, nur die Hinterbeine mit den Schinken waren herausgeschnitten; das alles mit unbe - schreiblichem Dreck umgeben. Hinter dem Hof stand eine noch lebende Kuh, abge - magert und heruntergekommen. Möglicherweise war es das einzige lebende Stück Vieh in diesem Ort. Die erschlugen und schlachteten wir; doch das mußte sehr schnell gehen, damit die Russen uns nicht erwischten. Denn unsere Wachsoldaten hielten sich im Haus auf und suchten sich dort ein Quartier zurechtzumachen. Als wir uns einige gute Stücke herausgeschnitten hatten, verschwanden wir schnell in den Hof. Ich sagte einem der Kameraden: „Das Beste haben wir vergessen - die Rin - derzunge“. Verrückt wie wir waren, gingen wir beide zurück. Und während wir viel zu langsam, weil ohne Sachkenntnis, die Zunge herausschneiden wollten, kam plötz - lich ein russischer Soldat - sichtlich angetrunken - stellte uns an die hintere Scheu - nenwand und warf uns vor, „Wehrwölfe“ (russischer Ausdruck für deutsche Partisa - nen) zu sein oder fliehen zu wollen. Er entsicherte gerade seine Waffe und lud sie durch, als ein russischer Sergeant dazukam und ihn zurückbrüllte. Der übergab uns dann unseren Wachsoldaten. Das ging haarscharf am Tod durch Erschießen vorbei, denn damit waren die Russen ganz schnell. Natürlich gab es nun dafür Schläge. Das war bei den Russen so üblich. Die meisten Bewacher führten ja außer der Maschi - nenpistole stets ihren Gummiknüppel mit sich, meistens nur ein kurzes und dickes Stück Elektrokabel. - Übrigens benutzten wir, weil auch die meisten Hausbrunnen verseucht waren, als Trinkwasser die braune Brühe aus den überschwemmten Bä - chen. Jeder wußte, daß da auch irgendwo tote Menschen und Tiere drinlagen.
Die Oder, die an dieser Stelle ziemlich breit ist, überquerten wir auf einer russischen Pontonbrücke. Einige unter uns konnten sich gar nicht genug wundern, mit welch einfachen, ja primitiven Mitteln die Russen eine Behelfsbrücke über die Oder gebaut hatten, die sogar Panzer tragen konnte. Auf der Ostseite, besser auf der rechten Seite
der Oder, erlebten wir wiederum den Greuel der Verwüstung; streckenweise erschien er uns noch schlimmer als auf der linken Seite. Wir marschierten nun in Richtung Militzsch, Trachenberg. Zivilbevölkerung schien es kaum noch zu geben, obwohl man hier außer toten Soldaten auch tote Frauen, sogar Kinder herumliegen sah.
Das Gebiet östlich der Oder eroberten die russischen Truppen schon wenige Tage nach ihrem großen Durchbruch an der Weichsel um den 20. Januar. Da war, wie viele Augenzeugen bestätigten, ihr Rachedurst noch größer. Die Überlebenden hatten sich jedenfalls versteckt. An einem halb zerstörten Bauernhof vorbeigehend, trafen wir eine Frau, die uns mit vollen Händen Lebensmittel schenkte: „Wer weiß, ob ich morgen noch etwas brauche“ - so ähnlich sagte sie.
Unterwegs in einem verwüsteten Dorf, in dem nur wenig Kampfschäden oder ver - brannte Höfe zu sehen waren, dafür aber um so mehr plündernde und marodierende Rotarmisten, die wie üblich vieles aus den Häusern räumten und auf die Straße war - fen, trafen wir einen schwarzen amerikanischen Soldaten, einen hünenhaften Kerl in der typisch amerikanischen Feldbluse. Aus einem deutschen Gefangenenlager be - freit, befand er sich nun auf dem Weg nach dem Westen. Er sprach uns auf englisch an, begleitete uns ein ganzes Stück, und unsere Wachsoldaten ließen ihn schweigend gewähren. Schließlich war er ein von ihnen hochgeachteter Bundesgenosse. Mißtrau - isch liefen sie neben dem Amerikaner und uns her, sie spitzten ihre Ohren, aber sie verstanden nichts von dem, was wir redeten. Der Amerikaner rang nach Worten, um seine Abscheu vor dieser plündernden Soldateska auszudrücken. Er suchte nach Vergleichen und fand keine. Er sei schon jahrelang im Krieg, so sagte er, nicht nur in Europa. Doch so Entsetzliches habe er noch niemals gesehen. So etwas übersteigt das Vorstellungsvermögen und die Phantasie auch des härtesten Soldaten. - Als er sich verabschiedete, bekundete er uns sein Mitleid und seine Sympathie. Den russi - schen Soldaten sagte er nicht einmal einen Abschiedsgruß. - Ein gutes Rezept hat er uns hinterlassen: Gegen Zahnschmerzen hilft folgendes: Einen Porzellanteller um - drehen, auf dieser Fläche Zeitungspapier verbrennen, die Asche wegspülen und den nassen, bräunlichen Rückstand auf Zahn und Zahnhals streichen. Gelegentlich soll’s geholfen haben.
Es wurde damals oft die Auffassung geäußert, daß Menschen, die ständig Tod, Folter und Vernichtung erleben müssen, stumpf gegen das Leid und gefühllos werden oder sogar verrohen. Ich würde es nicht so negativ sagen, weil ich es anders erlebt habe: Es scheint mir eher so, daß Menschen einen Schutzschild um ihre Seele bauen, sonst würden sie das Elend nicht ertragen können. Bei den meisten von uns aber versagte diese seelische Barriere, als wir im Straßengraben und auf dem Feldrand die zerstör - ten Reste eines Flüchtlingstrecks sahen, den die russischen Panzerspitzen bei ihrem Vormarsch im Januar überrollt hatten. Es war unfaßbar für uns, daß zwischen den Wagentrümmern, den Tierkadavern, mitten unter den Habseligkeiten tote Frauen, schrecklich verstümmelte, nackte Mädchen und Kinder lagen. Und niemandem kam
es, während all der Wochen, die seitdem vergangen waren, in den Sinn, die Leichen wenigstens zuzudecken. Ich kann diese entsetzlichen Erlebnisse auch heute nur knapp andeuten. - Wegen einer entgegenkommenden Truppenkolonne mußten wir ganz eng am Straßenrand gehen und auf herumliegende Habseligkeiten treten. Da lag unter vielen Dingen ein Fotoapparat in einer Ledertasche. Es war mehr eine sinn - lose Reflexbewegung, daß ich ihn aufhob. Ein russischer Offizier sah das sofort, kam herbeigerannt, schlug mir fluchend den Apparat an den Kopf, und nahm ihn dann an sich. Ein lächerliches Gerät erregte sofort seine Aufmerksamkeit, die nackten Lei - chen am Feldrand nicht. - An diesem Tage beklagten wir unsere ersten Verwundeten. Unsere Kolonne marschierte auf einer Straße, die durch einen Wald führte, in dem besonders viel zerstörtes Kriegsmaterial herumlag. Wir mußten an den Rändern der Straße gehen. Plötzlich gab es eine Detonation und Schreie. Der Mann vor mir war auf einen Sprengkörper getreten, vielleicht handelte es sich um eine kleine Tretmine. Ich, unmittelbar hinter ihm, fiel unter dem Druck und vor Schreck in den Graben. Der Kamerad trug schwere Verletzungen davon; nicht nur sein Unterkiefer und das Gesicht waren aufgerissen, sondern er hatte auch viele Splitter am ganzen Körper abbekommen. Sein Vordermann bekam viele Splitter im Rücken ab, ich - sein Hin - termann - blieb völlig unversehrt. Doch mein Hintermann erlitt einige Verletzungen durch Splitter. In solchen Situationen fällt es nicht schwer, sich bei seinem Schutz - engel zu bedanken. Einer von uns hatte noch etwas Verbandsmaterial. Alle drei konnten noch zur Not laufen - also weiter. Doch lange lebte der Verletzte nicht mehr. Abends erreichten wir Trachenberg, ein ganzes Stück nördlich von Breslau, das wir ja umgehen mußten. Denn in Breslau wurde noch hart gekämpft. Inzwischen waren andere Kolonnen von internierten Deutschen, wie auch von Kriegsgefangenen zu uns gestoßen. In Trachenberg mußten wir vor einer großen Schule, die inzwischen mit Stacheldraht eingezäunt war, antreten, und wir erlebten den ersten Appell auf russi - sche Art. Sie verfügten tatsächlich über Namenslisten, doch mit entstellten Namen und ganz unvollständig. Es dauerte Stunden, bis alle aufgerufen und die fehlenden notiert waren. Wir konnten einfach nicht glauben, daß die Russen uns alle, eine schwer zu schätzende Zahl von vielen Hunderten, vielleicht auch über tausend, in dieser Schule unterbringen wollten. Wir wußten noch nichts von der Ausstattung sowjetischer „Gulags“: Ein Klassenzimmer von ca. 50 bis maximal 60 m 2 war außer einem ganz schmalen Mittelgang mit Holzbohlen in drei Etagen mit etwa 80 cm
„Deckenhöhe“ voneinander aufgeteilt. In einem solchen Raum konnte man auf diese Weise einige hundert Mann unterbringen. Die provisorischen Etagen aber blockier - ten die Fenster, so daß sie sich nicht mehr öffnen ließen. Deshalb haben dann einige Kameraden nachts die Fenster eingeschlagen, damit wir in dieser Enge nicht erstick - ten. Wir Jungen mußten auf dem Fußboden übernachten - die erste Deckenlage keine
60 cm über unseren Köpfen. Einige Tage blieben wir in dieser Schule; zu essen gab es kaum etwas. - Hier beklagten wir unseren ersten Toten, einen Schneidermeister
aus Freystadt. Zum Sterben trugen ihn irgendwelche Leute in den Kohlenkeller die - ser Schule und setzten ihn dort in einen alten Korbsessel. Ich ging hinunter und blieb längere Zeit bei ihm, bis er gestorben war. Eine Beerdigung wurde uns rundweg abgeschlagen. Ich weiß bis heute nicht, ob ihm Irgendwer diesen letzten Dienst er - weisen konnte. Denn bald, etwa drei oder vier Tage später, wurden wir in Eisen - bahnwaggons verladen. Dort starb neben uns, Reinhard und mir, der Nächste. Die Bewacher hatten ihm die Zuckerkrankheit nicht geglaubt. Von nun an war der Tod unser ständiger Begleiter. Wie viele Tage die Bahnfahrt dauerte, weiß ich nicht mehr. Die Zeit verlor langsam an Bedeutung für uns. Auch orientieren konnten wir uns kaum noch. Nur selten hörte man Ortsnamen, von nun an nur noch polnische. Die einzige Erinnerung ist: Wir legten den nächsten Toten bei einem Halt auf den Bahn - damm, weil es der Posten so anordnete. Das geschah irgendwo in der Nähe von Lodz. Zu essen gab es nur sehr selten, ein kleines Stück Brot und kaum Wasser. Die meisten waren seelisch völlig am Boden und dämmerten nur noch vor sich hin, weil keiner mehr daran zweifelte, daß unser Zug nach Rußland fuhr. Doch eines Tages bog der Zug ab in Richtung Süden. Deutsche Ortsnamen kehrten wieder. Schließlich hielt der Zug auf einem Güterbahnhof in der Nähe von Gleiwitz. Nun ging es wieder rund auf russische Art und Weise. Mit ständigem Dawai-Gebrüll wurden wir ausge - laden, formiert und in Marsch gesetzt. Wir marschierten über die ziemlich neue Au - tobahn, das östliche Ende der A 4, die 1939 durch das dicht besiedelte Industriege - biet gebaut worden war, und die heute übrigens in keiner deutschen Karte mehr ver - zeichnet ist, nicht einmal im sonst so genauen ADAC-Atlas.
Der Marsch endete in einem großen Wohngebiet, das weiträumig mit hohen Stachel - drahtzäunen und Wachtürmen von anderen Stadtteilen hermetisch abgetrennt war. Offenbar hatte man alle Bewohner ausgewiesen und so aus den Familienhäusern ein riesiges Durchgangslager gemacht. Als wir dort nach stundenlangem Zählappell die Quartiere bezogen, nahmen wir erste Kontakte auf. Zivilisten und Soldaten jeder Prägung aus ganz Schlesien und darüberhinaus waren hier bunt zusammengewürfelt. Die Wohnungen der Mehrfamilienhäuser, in die uns ein Wachposten einwies, fanden wir völlig leergeräumt und unerträglich dicht mit Männern belegt. Ein Kamerad, der ein bißchen russisch sprechen konnte, sagte dem Wachsoldaten, daß in dieses Haus keiner mehr hineinginge. Der Soldat lachte nur und trieb uns dennoch in das Haus hinein. Sogar auf den Dachböden lagen sie nachts Mann an Mann. Entsprechend chaotisch erwiesen sich die sanitären Verhältnisse, und Läuse begannen sich rasant zu vermehren. Bei Tage hielt man sich deshalb meist draußen auf.
Ich kann mich sehr genau an einen evangelischen Pfarrer erinnern, der uns auf einem der Dachböden Wortgottesdienste und Bibelstunden hielt; der Andrang war so groß, daß niemals alle daran teilnehmen konnten. Etwa zwanzig bis dreißigtausend Män - ner sollten bereits in diesem Lager zusammengepfercht sein. Ständig kamen neue hinzu. Ständig aber gingen auch Eisenbahntransporte ab: Wohin, wußte niemand.
Natürlich nach Rußland, lauteten die Gerüchte, „Latrinenparolen“ war damals der Fachausdruck dafür. Doch da die Russen schon damals die Eisenbahnstrecken bis ins oberschlesische Industriegebiet, sogar bis auf diesen Güterbahnhof bei Gleiwitz auf die breitere russische Spurweite umgebaut hatten, gab es kaum einen Zweifel, wo die Transporte hinfuhren. Es war ungefähr Mitte März 1945. Gar nicht so weit von uns, in Leobschütz, Neustadt und Neiße tobten noch schwere Kämpfe, denn die Front hatte sich dort stabilisiert. Doch wir hegten nicht die geringste Hoffnung auf Befrei - ung, weil wir die ungeheure Übermacht der Roten Armee an Soldaten und an Kampfmitteln täglich erlebten.
Zwischendurch wurden wir auch zu Sonderkommandos zusammengestellt: Munition sammeln und sortieren; in einem eingezäunten Gebiet wurden am Straßenrand und in Gebäuden Granaten gestapelt, so wie in Wäldern Holzstapel liegen. Bauleute waren unter uns, die in die mit Granaten vollgestapelten Häuser nicht mehr hineingehen wollten, weil sie meinten, daß die Geschoßdecken unter dem Gewicht der Muniti - onsstapel einstürzen müßten. - Wir staunten, über welch riesige Munitionsvorräte die Russen verfügten. Glücklicherweise ist dort nichts passiert, außer der täglichen Angst, daß eine losgehen könnte. -
Noch mehr aber fürchteten wir, zu einer Sonderabteilung gesteckt zu werden, die gefallene russische Soldaten umbetten mußte. Nach den Kampfhandlungen waren sie an verschiedenen Stellen schnell begraben worden und sollten nun auf einem zentra - len Ehrenfriedhof bestattet werden. Viele tausend sowjetische Soldaten, eine für uns unschätzbare Zahl, hatten im Kampf um das oberschlesische Industriegebiet ihr Le - ben gelassen. Seitdem aber war schon über ein Monat vergangen, und der Verwe - sungszustand der Leichen entsprechend fortgeschritten. Unsere Kameraden, die die - se schlimme Arbeit machen mußten, bekamen nicht einmal Handschuhe, geschweige denn irgendwelche anderen Schutzmittel vor Infektionen. Wir beklagten ihr brutales Schicksal und lebten in ständiger Angst, zu diesem gefürchteten Arbeitskommando eingeteilt zu werden. Bald aber isolierten die Russen die Leichenbrigade von uns, und brachten sie in einem abgesperrten Block unter, wahrscheinlich wegen Seuchen - gefahr. Wir hörten deshalb auch nichts mehr von ihnen. Was mit den deutschen Ge - fallenen geschah, erfuhren wir nur durch Gerüchte; natürlich waren Massengräber ihr Schicksal.
Wiederum eine andere Gefangenengruppe mußte Schützengräben ausheben. Wir wunderten uns darüber, daß die russische Führung offenbar noch immer eine deut - sche Gegenoffensive nicht für ausgeschlossen hielt. Der größere Teil der Gefangenen aber verbrachte die Tage in der Enge des Lagers und wartete auf den Abtransport. Viele tausend sind von dort in die Sowjetunion transportiert worden. -
Auch der älteste Sohn der Familie Kijora, Wolfgang, war unter ihnen. Frau Kijora war Jüdin; deshalb schlossen die Nazibehörden ihr kleines Geschäft auf der Saga- ner Straße und entzogen damit der Familie die Existenzgrundlage. Seitdem lebten
die Eltern arm und völlig zurückgezogen. Noch schlimmer aber erging es ihrem etwa achtzehnjährigen Sohn Wolfgang, der als Halbjude diskriminiert, deshalb öffentlich als „wehrunwürdig“ erklärt und sogar von jeder Art Berufsausbildung ausgeschlos - sen wurde. Mutter und Sohn hatten, wie man in unseren Kreisen sagte, einen guten Schutzengel, daß sie vor dem Konzentrationslager bewahrt blieben. Nun aber nach der „Befreiung“ - wir konnten es einfach nicht fassen - verschleppten die Kommu - nisten den jungen Kijora in einen sowjetischen Gulag. Alle Proteste erwiesen sich als völlig sinnlos. Aus der Sowjetunion ist er nicht zurückgekehrt, gilt immer noch als vermißt, ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem sowjeti - schen Lager umgekommen.