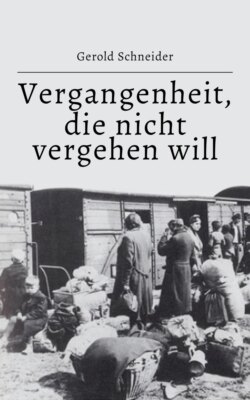Читать книгу Vergangenheit, die nicht vergehen will - Gerold Schneider - Страница 3
Zur Einführung: „In der Erinnerung liegt Erlösung“
ОглавлениеIn der Gedenkstätte Yad Vashem zu Jerusalem fand ich diese Inschrift. Neben den zutiefst beschämenden Eindrücken des millionenfachen Judenmordes durch Deut - sche ging mir dieser denkwürdige Satz besonders lange nach. Gibt es doch in der Sprache der Juden, anders als im Deutschen, für „Erlösung“ und „Befreiung“ nur ein Wort. Deshalb drängt sich die Gedankenverbindung zur Bibelstelle - „Die Wahr- heit wird euch freimachen“ - geradezu auf Viele Menschen, ob Christen oder nicht, werden darin Leitsätze für ihr Leben sehen können.
Ln Europa aber scheint es davon eine kollektive Ausnahme zu geben: An die Nach - kriegsereignisse 1945/46 im ehemaligen Ostdeutschland wollen sich Millionen Men - schen nicht mehr erinnern. Die einen leiden unter dem sozialen Trauma der Vertrei - bung, an den damals erlittenen Mißhandlungen, Folterungen und Vergewaltigungen; die damaligen Sieger aber wollen sich ihrer Taten nicht mehr erinnern, weil sie ja dem Naziterror durch ihren opfervollen Kampf ein Ende gesetzt haben. Und so ver- drängen sie beide ihre böse Vergangenheit.
Fünfzig Jahre danach wurde unter russischen Kriegsveteranen, die als siegreiche Rotarmisten Ostdeutschland eroberten, eine repräsentative Umfrage veranstaltet. Dabei forschte man auch nach Massenvergewaltigungen, Plünderungen und Folte - rungen. Die alten Soldaten wußten nichts mehr davon. - Diese Reaktion ist keines - wegs außergewöhnlich. Auch die Nazis, die SS und die Sondereinheiten, wie auch später die KGB- oder die SED-Schergen wußten nachher nichts mehr von ihren Greueltaten. Sie hatten nur „ihre Pflicht getan“ und „Befehle ausgeführt“. -
Es gibt jedoch wiederum eine Ausnahme: Von einer Minderheit der rund 12 Millio - nen Vertriebenen, ihren Kindern und Enkeln, die heute noch unverdrossen ihre frühe - re Heimat in den ehemals deutschen Ländern Ostpreußen, Pommern, Ostbranden - burg, Schlesien und im Sudetenland besuchen, werden auch ein halbes Jahrhundert danach Bekenntnisse deutscher Soldaten erwartet. Die aber wirken inzwischen wie ein erstarrtes Ritual; denn es sind ja nunmehr oft schon die Kinder und Enkel der Täter wie der Opfer, die miteinander sprechen. Von den Gesprächspartnern jedoch hört man Schuldbekenntnisse kaum, denn viele von ihnen wissen wirklich nicht, daß es jemals eine Vertreibung gegeben hat, andere haben es längst verdrängt. Wichtig aber ist, daß sie miteinander sprechen. Denn alle wünschen nichts mehr als die Ver - söhnung.
Echte Aussöhnung aber kann nur aus der Vergebung wachsen. Schuld vergeben ist jedoch ohne Schuld zugeben ganz unmöglich. Das wiederum setzt wahrhaftiges Er -
innern voraus, was sogar die Grenzen der Selbstachtung verletzen kann. Früher gab es dafür das christliche Wort „Gewissenserforschung“. Es ist leider außer Gebrauch gekommen, vermutlich auch deshalb, weil man nach christlichem Verständnis Schuld immer zuerst bei sich selbst zu suchen hat, nicht bei anderen; und weil einseitige Schuld zu den unwahrscheinlichen Ausnahmefällen gehört. Man hat das schwammi - ge Wort „Aufarbeitung“ dafür erfunden, das viel weniger verpflichtend klingt. Verschweigen, Verdrängen, nicht daran rühren, scheint heute nicht nur die öffentli - che Meinung, sondern sogar die deutsche Außenpolitik zu bestimmen. Ln den Ge - denkreden der Fünfzig-Jahr-Feiern des Kriegsendes wurden viele Millionen Kriegs - opfer betrauert; von den KZ-Opfern über die Toten der schrecklichen Bombennächte bis zu den gefallenen Soldaten blieb niemand dabei vergessen. Doch die über zwei Millionen Toten, die ja nicht im Kriege, sondern bei der Vertreibung - als in Europa schon Frieden war - umgekommen sind, wurden nicht erwähnt. Ob diese selektive Trauer am diplomatischer Höflichkeit, am Feigheit oder aus welchen Motiven auch immer geschieht, der Versöhnung kann auf diese Weise niemand dienen. Im Gegen - teil: Blockiertes Leben, verhärtetes Mißtrauen, mentale Mauern sind in der Regel die bitteren Folgen. Sogar nach Generationen können daraus Wiederholungszwänge wie Krebsgeschwüre wuchern. Bittere Beispiele gibt es dafür aus der neueren Geschichte und aus der Gegenwart genug.
So soll auch meine Niederschrift einen kleinen Beitrag zur Versöhnung mit unseren Nachbarn zu leisten versuchen. Junge Leute, denen ich manchmal in Gruppenstun - den aus der Nachkriegszeit erzählte, forderten mich wiederholt auf, meine Erinne - rungen aufzuschreiben. Notizen davon besaß ich schon lange. Trotzdem habe ich mit dem Schreiben lange gezögert. Eben weil in Deutschland das Wort „Erinnern“, an - ders als in Yad Vashem, negativ besetzt ist und oftmals kurzschlüssig als „Aufrech - nen “ verleumdet wird.