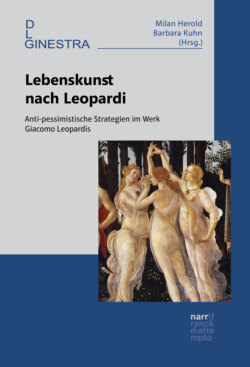Читать книгу Lebenskunst nach Leopardi - Группа авторов - Страница 12
I.
ОглавлениеDie negative Beurteilung menschlicher Existenz in Leopardis moralistischem Spätwerk der 111 Pensieri – posthum 1845 erstmals veröffentlicht bei Le Monnier – hat geradezu topischen Charakter1. Da ist die soziale Welt etwa bestimmt von «l’ingratitudine, l’ingiustizia, e l’infame accanimento degli uomini contro i loro simili» (XVI, 51 [«der Undankbarkeit, der Ungerechtigkeit und dem niederträchtigen Hass der Menschen gegen ihresgleichen»]), und ebenso entschieden wird die «carneficina che l’uomo fa del suo prossimo» (XX, 57 [«das Gemetzel, das der Mensch unter seinen Nächsten anrichtet»]) bildkräftig ins Blickfeld gerückt2. Mitunter verweist Leopardi dabei auf eine «condizione umana» (LIII, 98 [«conditio humana»]) oder gar auf eine «natura umana» (LXVIII, 114 [«menschliche Natur»]), mithin auf Basisfaktoren unabänderlicher Art, die eine grundsätzliche Determiniertheit menschlichen Verhaltens umschreiben sollen. Um sich auf dem schwierigen Terrain gesellschaftlichen Lebens ohne größeren Schaden zu bewegen, sei der Mensch folglich auf einen Lernprozess angewiesen, auf ein «imparare a vivere» (LII, 97 [«zu leben lernen»]), das seinerseits nur auf dem kognitiven Erfassen der menschlichen Natur und den daraus zu ziehenden Schlüssen aufbauen könne. In dem facettenreich dargelegten Tableau eines bellum omnium contra omnes gilt es für den Einzelnen demzufolge, sich behaupten zu können, ohne indes im eigenen Tun nur einen weiteren Beleg für die Misere des konstitutiven menschlichen Antagonismus bereitzustellen.
Leben zu lernen oder gar zu einer erstrebenswerten «Lebenskunst», zu einer «arte del vivere» (LXXIX, 127), zu finden, ist ein komplexer Vorgang, an dem offenbar nur eine begrenzte Zahl von Menschen teilhat. Die weitaus meisten bleiben, wie Leopardi zeigt, in einem unreflektierten Habitus befangen und suchen keine Wege, sich mit den Zwängen ihrer Natur auseinanderzusetzen sowie im Rahmen ihrer existentiellen Festlegung einen modus vivendi zu finden, der das Dasein erleichterte und Seelenfrieden, nämlich «tranquillità dell’animo» ermöglichte sowie ein «poter vivere» (LIV, 99 [«leben können»]) garantieren könnte. Dies aber wäre die notwendige Grundlage einer anti-pessimistischen Einstellung zum Leben.
Nun gibt es zwei Ansatzpunkte der negativen Einschätzung von Gesellschaft und Mensch in den Pensieri: zum einen die zeitgenössische Gesellschaft und ihre immanente Destruktivität; zum anderen die negative Beurteilung der menschlichen Natur in einem panchronischen Sinne. Sozialpsychologisch wie anthropologisch legt sich Leopardi mithin auf eine pessimistisch geprägte Rahmenvorstellung fest. Dies schließt anti-pessimistische Strategien sicherlich nicht aus, doch dies innerhalb eines gesellschaftlichen wie humanen Horizonts, der von unverrückbaren Gewissheiten unabänderlicher Negativität bestimmt ist. Lebenskunst kann sich demzufolge essentiell nur als Palliativ verstehen, als ein nützlicher Modus, die Zumutungen der Existenz erträglicher zu gestalten, als das Bemühen, in ausgewählten Segmenten der Lebensführung eine Entlastung zu finden. Und dies geschieht über eine operative Technik der Nutzbarmachung von Selbsterkenntnis und Erkenntnis der anderen Menschen. Diese Erkenntnisweisen charakterisieren sich durch den Umstand, dass sie sich hauptsächlich auf jeweilige humane Schwächen oder Defizite richten, mithin dadurch, dass aus einem Konzert widerstreitender Formen von Negativität per Kalkül für das nach Erleichterung existentieller Not suchende Subjekt ein spürbarer Mehrwert erwächst. Offenbar nutzt Leopardi hier die Hobbes’sche Auffassung des homo homini lupus antinomisch für ein Konzept der defensiven Selbstertüchtigung3.
Um dies zu bewerkstelligen, bedarf es entscheidend des Einsatzes der Vernunft. Schließlich ist es diese, die die Unzulänglichkeiten der eigenen Person erkennbar macht sowie die unverrückbaren Persönlichkeitsmerkmale und Defizite der anderen. Nur der kühle, unvoreingenommene Blick auf die strukturellen Charakterschwächen der menschlichen Spezies vermag die Grundlage für eine «arte del vivere» zu schaffen, die einer partiellen Befreiung vom Joch anthropologischer Ausweglosigkeit gleichkommt.
Diese Option für das rationale Vorgehen hat nun allerdings zwei nicht unproblematische Implikationen. Zunächst könnte sie der Grund dafür sein, dass in der Rezeptionsgeschichte der Pensieri diesen gelegentlich eine substantielle Aridität des Denkens und eine verengte Weltsicht unterstellt werden, wie es bereits im Urteil von Francesco De Sanctis der Fall ist4. Überdies ließe sich im Privilegieren des Vernunftregisters ein unverhüllter Widerspruch zu Leopardis ansonsten häufiger Kritik an der menschlichen Ratio, ja zu deren mitunter klaren Zurückweisung entdecken5. Das Bemühen um eine Eindämmung pessimistischer Gewissheiten bedarf mithin, so scheint es, der partiellen Reorganisation vertrauter Denkmuster und ihrer subjektiv gesicherten epistemologischen Basis. Dies hinterlässt letzten Endes den Eindruck einer Auflehnung gegen das ansonsten Unvermeidliche, gegen ein selbst erstelltes Weltbild ausnahmsloser Negativität.
So hat es den nicht unbegründeten Anschein, Leopardis Bekenntnis zum Einsatz einer strategischen Vernunft, im Hinblick auf ein besseres Leben im Verständnis selbstgewissen Handelns, komme einer Auflehnung gegen sein eigenes besseres Wissen gleich. Folglich nimmt es nicht wunder, dass Walter Benjamin – freilich ohne Bezug auf den verdeckten Widerstreit – auf Karl Voßlers Spuren in den Pensieri «eine Kunst der Weltklugheit für Rebellen» erkennt6. Rebellisches Verhalten aber versteht sich notwendigerweise als ein Tun, das sich dem Ziel einer möglichen Alterität verpflichtet weiß, als eine Reaktion, die zumindest potentielle Veränderbarkeit missliebiger Verhältnisse nicht ausschließt. Unter solchem Gesichtspunkt erwiese sich die «arte del vivere» gleichsam als ein anti-pessimistisches Elixir, dem wenigstens eine kleine Wirkungskraft eignet.
Damit geht indessen folgerichtig eine weitere Erkenntnis einher. Rebellion – und der Terminus ist seitens der leopardiani gerne aufgegriffen worden – ist semantisch nicht abtrennbar von einem Potential an Emotionalität, an Impulsivität. Dies wäre dann konsequenterweise der latente energetische Antrieb für Leopardis konzeptuelle und pragmatische Rationalität in seinen Pensieri.