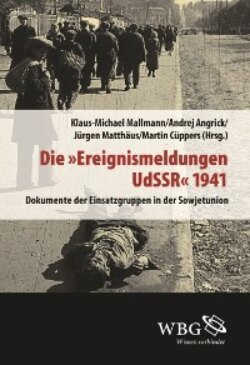Читать книгу Die »Ereignismeldungen UdSSR« 1941 - Группа авторов - Страница 20
Оглавление| Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD | Berlin, den 4. Juli 1941 |
| IV A 1 – B.Nr. 1 B/41 g.Rs. | [Stempel: Geheime Reichssache!] |
24 Ausfertigungen, 20. Ausfertigung
Herrn Reg.Rat Paeffgen Zim. 3261
Ereignismeldung UdSSR Nr. 12
I) Politische Übersicht:
a) Im Reich:
Ausser verschiedenen Festnahmen von Kommunisten aus präventivpolizeilichen Gründen wird gemeldet: Die Verbreitung kommunistischer Flugblätter (Schreibmaschine) in Prag. Stapoleit Prag deckte eine in den Bezirken Josefstadt, Nached und Politz arbeitende KP-Gruppe auf. Bisher 28 Protektoratsangehörige, darunter 2 Gebietsleiter, festgenommen. Gebietsarchiv vollständig erfaßt. Im Kreise Kladno wurde die Bezirksleitung der KPC ausgehoben. Schreib-, Abziehmaschinen und Matrizen beschlagnahmt. Bisher 35 Protektoratsangehörige festgenommen.
b) Im Generalgouvernement:
BdS Krakau berichtet über besondere Zuspitzung der ernährungspolitischen Lage im Generalgouvernement. Insbesondere in Warschau. Im Warschauer Ghetto sind Anfänge einer Hungersnot zu beobachten. Raub, Diebstahl und Plünderungen nehmen ein überdurchschnittliches Maß an. Zahl der Flecktyphusfälle innerhalb des Ghettos steigt. Abwehrmaßnahmen ergriffen.
c) Übrige besetzte Gebiete: Keine wesentlichen Meldungen.
II) Meldungen der Einsatzgruppen und -kommandos:
Chef der Sicherheitspolizei und des SD hat die Zuteilung des Höheren SS- und Polizeiführers z.b.V. SS-Oberführer Kosmann [Korsemann]1 bis zu seiner endgültigen Verwendung zum Stab des Höheren SS- und Polizeiführers beim Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes 103 angeordnet.
Einsatzgruppe A: Standort 4.7.41 Riga2 (FT-Verbindung).
Gruppenleiter SS-Brif. Stahlecker mit der kämpfenden Truppe in Riga eingerückt.3 Mit ihm EK 1a und Teile des EK 2.4 Zusammenarbeit mit AOK hervorragend. Eingliederung in Vorausabteilungen reibungslos möglich. Im Einvernehmen mit Wehrmacht wurde für Sicherung gegen versteckte Russen und bewaffnete Kommunisten gesorgt. Ein Angehöriger EK 1a leicht verwundet. Gesamte nationale Führungsschicht aus Riga verschleppt oder ermordet. Pogrome laufen an.5 Polizei wird unter Führung des aus Berlin mitgebrachten ehemaligen Leiters der Politischen Polizei in Riga organisiert und mit nur zuverlässigen Personen besetzt. Sie wird ausschließlich zur Fahndung von Kommunisten und Rotarmisten eingesetzt. Da nach Mitteilung des AOK 18 in Libau auch Zivilisten in die Kämpfe gegen Deutsche eingegriffen haben, wurde zusätzlich zu dem dorthin verschickten Teil des EK la ein Teil des EK 2 beordert mit dem Auftrag rücksichtslosesten Vorgehens.6 EK 1b: Standort 4.7.41 Kowno. In Kowno nur unwesentliche Zerstörungen. Heckenschützen insbesondere in der Gegend Tauroggen stark in Erscheinung getreten. Von Stapo Tilsit bisher 200 Erschießungen durchgeführt.7 Litauer haben wenig Vertrauen zu dem Berliner litauischen Gesandten Skirza [Sˇ kirpa] (hat in Berlin, wie bereits gemeldet, Hausarrest),8 als für den General Rastikis.9 Dieser sehr beliebt. In Kowno zwei Partisanengruppen: a) unter Führung Klimaitis,10 600 Mann, in der Hauptsache Zivilarbeiter, b) unter Führung des Arztes Dr. Zigonys, etwa 200 Mann stark. Versorgungslage sehr gespannt; Vorräte von Russen weitgehendst abtransportiert. Wehrmacht hat Preisstop angeordnet. Während der russischen Besetzung sind Gehälter um 100–200%, Lebensmittel um 4–500%, Textilwarenpreise um 1–2000% gestiegen. EK 2: Standort Schaulen. Wird baldmöglichst nach Riga nachgezogen.
Einsatzgruppe B: Standort Lemberg (FT-Verbindung).
Gruppenleiter berichtet: Sogenannte Landesregierung11 hat erklärt, in Universität Lemberg Dienstsitz nehmen zu wollen. Zusammensetzung bisher: Leitung Stezko, Karbowiecz auch Belends genannt, Gesundheitswesen Arzt Dr. Panyschan,12 Verwaltung Lyseyj, Justiz Gerichtsrat Fedusewicz, Sicherheitswesen Klimir,13 Wirtschaft Dr. Jaciw, Presse und Propaganda der Dichter Holowko, Kriegsministerium Rico Jary,14 mit Jüdin verheiratet, Kultus noch unbesetzt. Neben Kabinett soll Oberster Rat stehen. Als Leiter Dimitri Donzow vorgesehen.15 OUN-Gruppe Bandera beansprucht Führung des Staates nach dem Prinzip „Die Partei regiert den Staat“. Anerkennung auch de facto nicht erfolgt, jedoch mußte energisches Vorgehen gegen die Usurpatoren mit Rücksicht auf militärische Lage und Stimmung im Gebiet vermieden werden. Es wird abgewartet. Ausbruch des vorgesehenen Aufstandes in Richtung Berditschew und Richtung Shitomir-Kiew. Im Lande haben vielfach milit. Befehlsstellen Beauftragte der Landesregierung begrüßt und positiv zur Kenntnis genommen. General Lenz16 trifft heute in Lemberg ein und wird über Lage unterrichtet werden. Ic der HGRS erhielt Informationen und wird nachgeordnete Dienststellen unterrichten. Es besteht Übereinstimmung mit zuständigen Wehrmachtsstellen darüber, daß Westukraine seit bolschewistischer Besetzung ausserordentlich radikalisiert. Es muß jedoch im Einvernehmen mit VO des OKW Abw. II17 darauf hingewiesen werden, daß Berichterstattung der bisherigen antibolschewistischen Zentrale in Berlin (z. B. Dr. Leibbrand) weder in militärischer noch in politischer Hinsicht auch nur annähernd den Tatsachen gerecht wurde.18 Einsatzgruppe 2 [B] hat auf Vorlage den SS-O’stubaf. Meier19 zum Verbindungsführer der Einsatzgruppe zum Höheren SS- und Polizeiführer Obergruppenführer Jäckels [Jeckeln]20 abgestellt. Sonst keine neuen Meldungen
Einsatzgruppe D: Standort-Tagesziel Schässburg erreicht.
Tagesziel am 4.7.41: Piatra (Neamt). FT-Verbindung.
III) Militärische Ereignisse:
Heeresgruppe Süd:
Feind deckt weiterhin durch kampfkräftige Nachhuten den Abmarsch. 11. Armee: Gegen heftige Gegenangriffe wurden die Brückenköpfe ostwärts und nordostwärts von Jassy erweitert. Ungarn: Feindwiderstand bei Tatarow (Nordostwärts Tataren-Paß) gebrochen. Skole genommen. Gegner weicht nach Osten und Nordosten aus. 17. u. 6. Armee: Verfolgung auf ganzer Armeefront erfolgreich fortgesetzt. 6. Armee mit rechtem Flügel im zügigen Angriff gegen weichenden Feind. 120 Panzer erbeutet oder vernichtet. Panzergruppe gewann gegen zähen Feindwiderstand Boden, mußte aber starke Feindangriffe abwehren. Teile wurden nach Nordwesten gegen eine Feindgruppe bei Klewan im Angriff angesetzt. Erreichte Linie: Brzozdowce–Bobrka–westl. Zloczow–Kremenez–Luzk–Rozyszcze. Vorderste Panzerteile ostwärts und südostwärts Ostrog–ostwärts Zdolbunow am Horyn–südostwärts Klewan.
Heeresgruppe Mitte:
Westlich der Szczara eingeschlossene Feindteile wurden vernichtet. Die Gebiete um Wolkowysk und Bialystok von Feindresten gesäubert. 4. Armee tritt wieder zum Vormarsch nach Osten. 9. Armee stieß beim Vormarsch nach Osten auf keinen kampfkräftigen Feind. Panzergruppe hält gegen heftige Feindangriffe Brückenköpfe über die Beresina bei Bobruisk und Svislac und schließt mit Teilen den Nowogrodeker Kessel im Südosten ab. Feind scheint in Linie Orscha–Witebsk–Polozk eine neue Front aufzubauen.
Heeresgruppe Nord:
Das Aufschließen an die Düna und die Bereitstellung in den erweiterten Brückenköpfen Dünaburg–Liewenhef–Jakobstadt verliefen planmäßig. Vor 16. Armee nur schwacher Feindwiderstand. Bei Koltyniany wurden aus sieben russischen Maschinen Fallschirmjäger abgesetzt.
Rumänische Front:
Über den Ablauf des Angriffes der 11. Armee keine Einzelheiten bekannt. Verbindung dorthin ist z. Zt. nicht möglich. Bei Kuliani und Stefanesti nach Aufklärermeldungen eigene Truppen im Vormarsch nach Nordosten.
Die 17. Armee hat die Verfolgung des rasch nach Osten ausweichenden Gegners, der noch vereinzelt mit starken Nachhuten westlich Chodorow und südlich Bobrka kämpft, bis gegen Tarnopol fortgesetzt. Südlich Kremenez noch 2 feindliche Divisionen. Der Gegner weicht hier nach Osten aus. Örtliche Gegenangriffe richten sich gegen die Panzerspitzen bei Ostrog und Hoszcza, während dem Gegner aus dem Raum nordostwärts Luzk ein Einbruch in die nördliche Panzerstraße gelungen ist. Rollende Angriffe stärkerer Verbände des V. Fliegerkorps haben im Wesentlichen zur Wiederherstellung der Lage beigetragen. Gegner weicht auch hier bereits in Teilen nach Norden und Osten aus. Erreicht wurden: Stryj–Chodorow–Prezemyslany–westlich Tarnopol–Zahlocze–Kremenez–Ostrog. Ein weiterer Brückenkopf westlich Korzec, nordostwärts Luzk, Rozyczyze und Kowel. 9. Pz.Div. ist bereits in Tarnopol.
Aus dem Raum von Bobruisk–Borissow in nordostwärtiger Richtung auf Opotschka sind wir in weiterem Vorgehen.
Auch zwischen Jakobstadt und Riga ist die Düna erreicht. Im Raum nördlich Tukum– Frauenburg–Soldingen ein neuer Kessel gebildet worden. Windau besetzt, desgleichen Murmansk.
Verteiler:
RFSS und Chef der Deutschen Polizei
Chef der Sicherheitspolizei und des SD
Chef der Ordnungspolizei
Amtschefs I, II, III, V, VI und VII
SS-Obersturmbannführer Rauff21
IV-Gesch.Stelle (3 Stück)
IV D, IV D 1, IV D 2, IV D 3, IV D 4
IV E, IV E 5
IV A l d (5 Reserve)
Aus: BAB, R 58/214
1 Dr. Theodor Paeffgen, geb. 1910, Jurastudium, 1933 SA, 1934 Dr.jur., 1936 Assessorprüfung, 1937 NSDAP, Mai 1938 SD-HA, Nov. 1938 Übernahme in Gestapo, 1939 SS, Juni 1940–Juni 1941 SD-Referent BdS Metz, dann RSHA als Einsatznachrichtenführer „Barbarossa“, 1941 Stubaf., Nov. 1941 zur Stapo-Stelle Tilsit, April–Sept. 1942 stellv. Leiter Stapo-Stelle Allenstein u. amtierender KdS Bialystok, dann RSHA als Gruppenleiter VI D (England, USA) bis 1945, gest. 1969; BAB, BDC, SSO u. RuSHA Dr. Theodor Paeffgen; Erlaß RSHA v. 3.7.1941: Kdostab u. Einsetzung eines Einsatznachrichtenführers des RSHA, RGVA, 500–4–36; Vern. dess. v. 6.4.1967, BAL, B 162/5403; BAL, ZK: Dr. Theodor Paeffgen; Bender: The Jews of Białystok, S. 101.
2 Gemeint ist Gerret Korsemann, geb. 1895, Soldat 1914–1918, zuletzt als Lt., 1918/19 Freikorps Grodno, 1926 NSDAP u. SA, 1937 als Hptm. zur Polizei, 1938 ins HA Orpo, 1939 SS als Oberf., 1940/41 Kdr. PR Lublin, Aug. 1941 Brif., als HSSPF z. b. V. zum HSSPF Rußland-Süd abgestellt, verantwortlich für das Massaker von Rowno am 6./7.11.1941, Aug. 1942 als künftiger HSSPF Kaukasus zur HGr. A, Mai 1943 kommissarisch HSSPF Rußland-Mitte u. Weißruthenien, Juli 1943 Waffen-SS, 1946 an Polen ausgeliefert, zu 11 ½ Jahren Gefängnis verurteilt, 1949 entlassen, nie vernommen, gest. 1958; BAB, BDC, SSO Gerret Korsemann; BA-ZA, ZM 215/3 u. ZC 10888; GVP HSSPF Kaukasus (Stand: Sept. 1942), RGVA, 1323–1–52; BAL, ZK: Gerret Korsemann; Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord, S. 566–570, 605ff., 635–640, 671, 717.
3 Riga, seit 1918 Hauptstadt der unabhängigen Republik Lettland, wurde nach der Okkupation durch die Rote Armee am 17.6.1940 Zentrum der neuen Sowjetrepublik Lettland; vgl. Felder: Lettland im Zweiten Weltkrieg, S. 138–163. 1935 lebten dort 43000 Juden, die 11% der städtischen Bevölkerung u. 47% aller Juden Lettlands ausmachten. Ähnlich wie im übrigen Baltikum oder in Ostpolen führten der Verlust der nationalen Selbständigkeit u. der Regimewechsel zu einem sprunghaften Anstieg des Antisemitismus. Allein das Faktum, daß die lettischen Juden, die bislang de facto von allen staatlichen Positionen ausgeschlossen waren, nunmehr öffentliche Ämter bekleiden konnten, ließ sie als Nutznießer u. Parteigänger der Sowjetisierung erscheinen. Daß alle jüdischen Institutionen verboten u. 5000 lettische Juden nach Sibirien deportiert wurden, fiel nicht ins Gewicht. Insbesondere der Pērkonkrusts, eine faschistische Organisation, in der sich mehrere studentische Korporationen vereinigt hatten, nährte die Gleichsetzung von Judentum u. Bolschewismus. Argumente jüdischer Politiker wie „Es ist besser, den Schlüssel seines Geschäfts Stalin zu übergeben als seinen Kopf Hitler“ (Zit. bei Margers Vestermanis: Juden in Riga. Auf den Spuren des Lebens und Wirkens einer ermordeten Minderheit. Ein historischer Wegweiser, Bremen 1995, S. 14) dienten dafür als ‚Beweis‘; vgl. Dov Levin: The Jews and the Sovietisation of Latvia, 1940–1941, in: Soviet Jewish Affairs 5(1975), S. 39–56; ders.: Baltic Jews under the Soviets 1940–1946, Jerusalem 1994; Frank Gordon: Latvians and Jews between Germany und Russia, Stockholm 1990; Ezergailis: The Holocaust in Latvia 1941–1944, S. 79–115; Hans-Heinrich Wilhelm: Antisemitismus im Baltikum, in: Grabitz/Bästlein/Tuchel: Die Normalität des Verbrechens, S. 85–102; Angrick/Klein: Die „Endlösung“ in Riga, S. 16–39; Björn M. Felder: Stalinismus als „russisch-jüdische Herrschaft“. Sowjetische Besatzung und ethnische Mobilisierung im Baltikum 1940 bis 1941, in: ZfG 57(2009), S. 5–25.
4 Bereits hier unterlief die Wehrmacht das zwischen Heydrich u. dem Gen.Qu. Wagner vereinbarte Abkommen, das den Einsatz der SK auf die rückwärtigen Armeegebiete u. den der EK auf die rückwärtigen Heeresgebiete beschränkte. Ob dies durch die auf dem linken Flügel der HGr. Nord vorgehende 18. Armee bzw. direkt durch die HGr. oder durch Absprachen auf unterer Ebene ermöglicht wurde, läßt sich der Heeresüberlieferung nicht entnehmen. Jedenfalls wurde ein derartiges Vorgehen in der Folgezeit zum allzeit praktizierten Normalfall. Konkret bedeutete das, daß die Fluchtchance der Juden insbesondere in den westlichen Teilen der Sowjetunion minimal war; vgl. Headland: Messages of Murder, S. 82 ff.
5 In der Nacht vom 29. auf den 30.6.1941 räumte die Rote Armee fluchtartig Riga, so daß die Wehrmacht am 1.7. in die Stadt einrücken konnte; Der Einsatz der zum Voraus-Rgt. des I. AK gehörigen Truppen in der Zeit 22.6.–1.7.1941 (Einnahme von Riga), BA-MA, RH 19 III/662; Wilhelm: Die Einsatzgruppe A, S. 104, nennt dafür fälschlicherweise den 29. 6.
6 Noch vor der Ankunft der Wehrmacht nutzte der lettische Selbstschutz, der sich im Untergrund aus Anhängern des Pērkonkrusts u. der paramilitärischen Aizsargi gebildet hatte, das Vakuum, ergriff die Macht in Riga u. rief zum Kampf gegen den „inneren Feind“ auf; Anklage Staw Hamburg v. 10.5.1976, BAL, B 162/3076; Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden, Bd. 2, S. 325, irrt, wenn er die Initiative zum Pogrom der noch nicht anwesenden EG A zuschreibt. Bereits am 30.6. setzte ein blutiges Inferno ein, das sich bis zum 4.7. fortsetzen sollte: Auf den Straßen begann die Jagd auf die Juden Rigas, Hauswarte denunzierten ihre jüdischen Mieter, Synagogen brannten, es kam zu Massenerschießungen, Plünderungen u. Vergewaltigungen; vgl. Max Kaufmann: Die Vernichtung der Juden Lettlands. Churbn Lettland, München 1947; Margers Vestermanis: Der lettische Anteil an der „Endlösung“. Versuch einer Antwort, in: Uwe Backes/Eckhard Jesse/Rainer Zitelmann (Hrsg.): Die Schatten der Vergangenheit. Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus, Frankfurt/M.–Berlin 1990, S. 426–449; ders.: Der Holocaust in Lettland. Zur „postkommunistischen“ Aufarbeitung des Themas in Osteuropa, in: Arno Herzig/Ina Lorenz (Hrsg.): Verdrängung und Vernichtung der Juden unter dem Nationalsozialismus, Hamburg 1992, S. 101–130; Gertrude Schneider (Hrsg.): The Unfinished Road. Jewish Survivors of Latvia Look Back, New York u. a. 1991; Bernhard Press: Judenmord in Lettland 1941–1945, Berlin 19952; Max Michelson: City of Life, City of Death. Memories of Riga, Boulder 2001; Grossman/Ehrenburg/Lustiger: Das Schwarzbuch, S. 679ff.; Matthew Kott: The Portrayal of Soviet Atrocities in the Nazi-controlled Latvian-language Press and the First Wave of Antisemitic Violence in Riga July-August 1941, in: Gaunt/ Levine/Palosuo: Collaboration and Resistance During the Holocaust, S. 127–160; Katrin Reichelt: Lett-land unter deutscher Besatzung. Der lettische Anteil am Holocaust, Berlin 2011. Die Unterstellung „Für ‚spontane‘ Mordaktionen aus der lettischen Bevölkerung gibt es bisher keine Belege“ (Björn M. Felder: „Tod dem Roten Terror!“ Antikommunismus, gesellschaftlicher Konsens und Widerstand in Lettland 1943 bis 1946, in: JHK 2007, S. 144) ist angesichts dessen nur als absurd zu bezeichnen. Aber auch Stahleckers Behauptung, nur „unter erheblichen Schwierigkeiten [hätten] einheimische antisemitische Kräfte zu Pogromen gegen die Juden veranlaßt“ werden können (EG A: Gesamtbericht bis 15.10.1941, RGVA, 500–4–93), sollte im Hinblick auf solche Schilderungen als nachträglicher Versuch gewertet werden, sich selbst zum spiritus rector des Geschehens zu stilisieren; als Überblick: Andrej Angrick/ Peter Klein: Riga 1941–1944, in: Ueberschär: Orte des Grauens, S. 195–206.
7 Libau (Liepāja), die wichtigste lettische Hafenstadt, hatte 1939 57000 Einwohner, darunter 6000 Juden; EdH, Bd. 2, S. 859. Unmittelbar nach der Eroberung durch die 291. Inf.Div. am 29.6.1941 rückte ein Teilkdo. des SK 1a unter Ostuf. Fritz Reichert in Libau ein. Zur Unterstützungkam am 4.7. zudem ein Teilkdo. des EK 2 unter Ostuf. Erhard Grauel dort an. Am Abend desselben Tages fanden erste Judenerschießungen statt; vgl. Anklage Staw Hannover v. 18.1.1968, BAL, B 162/2637; Urteil LG Hannover v. 14.10.1971, BAL, B 162/14508.
8 Die Zahl ist deutlich zu niedrig. Allein bis zum 1.7. hatte die Stapo-Stelle Tilsit bereits 526 Juden erschossen. Die Initiative dazu ging von Stubaf. Böhme aus, der am 1.7.1941 dem RSHAberichtete: „Die Durchführung der Aktion wurde am 24. Juni mit SS-Brigadeführer Stahlecker durchgesprochen, der grundsätzlich sein Einverständnis zu den Säuberungsaktionen in der Nähe der deutschen Grenze erklärte.“ Zustimmung kam auch von Himmler u. Heydrich in Augustowo: „Der Reichsführer-SS u. der Gruppenführer, die dort zufällig anwesend waren, liessen sich über die von der Staatspolizeistelle Tilsit eingeleiteten Massnahmen unterrichten u. billigten diese in vollem Umfange“, Bericht Stapo-Stelle Tilsit v. 1.7.1941, RGVA, 500–1–758. Die ältere Forschung u. die Justiz interpretierten diese Massaker fälschlicherweise noch als vom RSHA angeordnete Befehlstaten u. folgten hierin der Argumentation Böhmes in seiner Vern. v. 13.1.1966, BAL, B 162/5401; vgl. Urteil LG Ulm v. 29.8.1958, BAL, B 162/2615; Krausnick: Hitlers Einsatzgruppen, S. 141.
9 Oberst Kazys Škirpa war der ehem. litauische Gesandte in Berlin u. das Sprachrohr seiner Regierung in der kritischen Phase, als die baltischen Staaten im Sommer 1940 von der UdSSR annektiert wurden. Er verblieb im Reich u. gehörte als maßgeblicher Funktionär der Litauischen Aktivistenfront (LAF) an, deren Propagandatätigkeit aber von den deutschen Dienststellen unterbunden wurde. Infolge der deutschen Vorbereitungen zum Überfall auf die UdSSR stieg jedoch Škirpas Stern. Er intensivierte seine Kontakte innerhalb der litauischen Elite u. baute Netzwerke zum Amt Rosenberg, insbesondere zu Georg Leibbrandt, zur Abwehr unter Oberstlt. Friedrich Graebe sowie über Dr. Heinz Gräfe zum SD in Ostpreußen auf. Der SD sowie die Abwehr nahmen so im Nov. 1940, von Škirpa unterstützt, Kontakte zu den Widerstandsgruppen in Litauen auf, die umgekehrt die Gruppe Berliner Exilanten der LAF als politische Führung anerkannten, so daß deren Verbände als fünfte Kolonne dem deutschen Angriff nutzbar gemacht werden konnten. Der politische Lohn für das Engagement blieb ihnen vorenthalten. Bei einem Treffen Škirpas mit dem Gesandten Grundherr wurde der Litauer am 23.6.1941 in seine Schranken gewiesen. Das auf denselben Tag datierte Schreiben Škirpas an Hitler, wonach er – das Einverständnis der deutschen Regierung vorausgesetzt – nach Litauen zurückkehren u. die Amtsgeschäfte übernehmen wolle, wurde gemäß der Entscheidung Ribbentrops v. 25.6.1941 ignoriert; vgl. Myllyniemi: Die baltische Krise 1938–1941, S. 146 ff.; ADAP, Serie D, Bd. XIII/1, Dok. 3–6, 18; seine Sicht in seinem Ms.: Litauens Aufstand gegen die Sowjets im Juni 1941, IfZ, Ms 289/1.
10 General Stasys Rastikis war bis zum 24.4.1940 OB der litauischen Armee gewesen u. hatte in dieser Funktion beste Kontakte nach Deutschland – bis hin zu persönlichen Treffen mit Hitler, Ribbentrop u. Halder – aufgebaut. Er selbst vertrat die Politik einer baltischen Entente. Die Sowjets akzeptierten im Juni 1940 den litauischen Vorschlag nicht, Rastikis als neuen Kabinettschef einzusetzen, obwohl sich dieser für die Annahme des sowjetischen Ultimatums ausgesprochen hatte. Daraufhin setzte er sich mit seiner Familie nach Deutschland ab. Bei seiner Rückkehr nach Litauen war er nur kurz im deutschen Sinne tätig u. zog sich dann aus familiären Gründen – die Sowjets hatten Angehörige von ihm in Haft – aus dem politischen Tagesgeschäft zurück; vgl. Myllyniemi: Die baltische Krise 1938–1941, S. 46f., 99f., 123; Krausnick/Wilhelm: Die Truppe des Weltanschauungskrieges, S. 349f.
11 Algirdas Klimaitis, geb. 1913, Journalist u. leitender Funktionär des litauischen Schützenverbandes; vgl. BAL, B 162/Vorl. AR-Z 41/83.
12 Am Abend des 30.6.1941 verkündete Stezko in der „Prosvita“ am Lemberger Marktplatz die Unabhängigkeit der Ukraine; vgl. Bericht Hans Koch (undat.), BAB, R 6/150; Erklärung Stezkos v. 5.7.1941: Deklaration der ukrainischen Staatsregierung, BAB, R 43 II/1500; diverse Grußbotschaften dazu, BAB, R 43 II/1504b; Bruder: Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben, S. 132–138, 140–145.
13 Wohl M. I. Panchyshyn, Funktionär der OUN in Westgalizien, der nach dem sowjetischen Einmarsch ab Nov. 1939 kurzfristig der Ukrainischen Vollversammlung vorstand; Armstrong: Ukrainian Nationalism 1939–1945, S. 68.
14 Wahrscheinlich ist damit der Bandera-Vertreter Iwan Klymiv, auch Lehenda genannt, gemeint. Klymiv war Leiter der westukrainischen Landesexekutive der OUN, der die bewaffnete Untergrundarbeit nach der sowjetischen Besetzung Galiziens organisiert hatte; Grelka: Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft, S. 189.
15 Rico Iarii (auch Jari u. Yary), Vertrauter von OUN-Führer Konovalec u. Angehöriger der Führungsorganisation, der bereits in der Weimarer Republik Verbindungen zur Reichswehr aufgebaut hatte. 1933 Gebietsführer der OUN im Reich, Leiter des Büros in Berlin-Wilmersdorf, Verbindungsmann zum AA u. schon damals für die Abwehr tätig. Für diese an den Vorbereitungen zum Überfall auf Polen beteiligt. Nach der Aufspaltung der ukrainischen Nationalbewegung zum Kontaktmann der OUN-B für das OKW ernannt. Er verfügte so über gute Kontakte zu Prof. Hans Koch u. Theodor Oberländer. Im Vorfeld des Überfalls auf die Sowjetunion verhandelte er seit Jan. 1941 mit Brauchitsch u. Canaris über die Ausbildung ukrainischer Soldaten, die in zwei Legionen im Osten zum Einsatz gelangen sollten. Dies lag im Interesse der OUN, die sich somit dem Aufbau einer eigenen Armee nähergekommen glaubte. Iarii leitete im April 1941 das Rekrutierungsbüro in Saubersdorf/Wiener Neustadt. Daher auch die Einstufung Iariis als Kriegsminister in der EM. Bedingt durch die fehlgeschlagene Proklamation einer eigenständigen Ukraine in Lemberg unmittelbar nach dem Einmarsch sah die Gestapo das Wiener Rekrutierungsbüro als Bedrohung an. Iarii u. andere Führer wurden am 16. 9. verhaftet; vgl. Aktennotiz v. 9.7.1941 u. Schreiben AOK 11 v. 26.7.1941, beides BA-MA, RH 20–11/485; biographisch: Grelka: Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft, S. 129, 131, 153, 266; Wolodymyr Kosyk: The Third Reich and Ukraine, Frankfurt/M. u. a. 1993, S. 23, 34, 54f., 83, 128ff.; Frank Golczewski: Die Ukraine im Zweiten Weltkrieg, in: ders.: Geschichte der Ukraine, S. 243, 251; Oleksandr Kuceruk: Rico Jarj – zahadka OUN [Rico Jarj – das Rätsel der OUN], L’viv 2005.
16 Es handelt sich um einen Theoretiker aus der Ostukraine, geb. 1883, der seit 1914 dem vom AA finanzierten Ukrainischen Pressebüro vorstand u. für die Eigenständigkeit der Ukraine unter einem starken Führer publizistisch eintrat. Er leitete seit 1918 die Ukrainische Nachrichtenagentur UTA, stand in Verhandlungen mit Groener u. war Mitbegründer der Ukrainischen Demokratischen Bauernpartei. Donzow gehörte offiziell nie der OUN an, war aber vielleicht gerade deswegen parteiübergreifend für die Ausbildung des ukrainischen Autoritarismus bedeutsam; Grelka: Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft, S. 54, 86, 134–138, 317, 336, 345f.
17 Wahrscheinlich Schreibfehler. Gemeint dürfte der General der Gebirgstruppen Hubert Lanz sein, damals Kdr. der 1. Geb.Div., deren Regimenter Lemberg eroberten. Z.T. idealisierend, jedoch mit Hinweis auf die „Sühnemorde“ an Juden: Roland Kaltenegger: Die Stammdivision der deutschen Gebirgstruppe. Weg und Kampf der 1. Gebirgsdivision 1935–1945, Graz-Stuttgart 1981, S. 215ff.
18 VO der Abwehr war Hptm. Prof. Dr. Hans Koch, geb. 1894 in Lemberg, Theologiestudium, Mitglied des Alldeutschen Verbandes u. der antisemitisch-großdeutsch ausgerichteten Studentenvereinigung „Wartburg“, Soldat im k.u.k. Heer im Ersten Weltkrieg. Bedingt durch seine weltanschauliche Prägung u. seine Sympathie für die Ukrainer nahm er 1919 als Offizier der Ukrainisch-Galizischen Armee am Kampf gegen Polen teil. Aus dieser Zeit resultierten seine freundschaftlichen Kontakte zu den führenden Radikalen der ukrainischen Bewegung. Seit Frühjahr 1920 wurde er nach seiner Gefangennahme durch die Sowjets von diesen ebenfalls im Kampf gegen Polen verwendet. Er kehrte 1921 nach Wien zurück, promovierte dort 1924 u. habilitierte sich 1929 im Fach Geschichte. 1932 trat er der österreichischen NSDAP bei u. wurde an die Universität Königsberg berufen, wo er bleibende Kontakte zu Kollegen wie den späteren Abwehrexperten Theodor Oberländer, Georg Gerullis u. Franz Alfred Six vom SD aufbaute. Spätestens im Vorfeld des Überfalls auf Polen stand er in Diensten der Abwehrstelle Breslau. Dabei arbeitete er v.a. mit den alten ukrainischen Seilschaften zusammen. Neben der Tätigkeit in der Ic-Abt. der HGr. Süd war er zeitgleich dort der zuständige Beauftragte des RMO. Da Koch jedoch in Lemberg die Eigenstaatlichkeit der Ukraine befürwortete, fiel er bei Rosenberg in Ungnade, blieb aber im Dienste der Abwehr beim Pz.AOK 4 an der Front. Nach seiner Rückversetzung war er neben seiner wissenschaftlichen Arbeit v.a. für den SD tätig. Ende 1944 übernahm er die Leitung des Wannsee-Instituts. In der Nachkriegszeit baute er das Osteuropa-Institut in München neu auf u. lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität. 1955 gehörte er bei Adenauers Reise nach Moskau zu dessen Delegation. Koch verstarb 1959; vgl. Haar/Fahlbusch: Handbuch der völkischen Wissenschaften, S. 324ff.; Gideon Botsch: „Geheime Ostforschung“ im SD. Zur Entstehungsgeschichte und Tätigkeit des „Wannsee-Instituts“ 1935–1945, in: ZfG 48(2000), S. 509–524; Gabriele Camphausen: Die wissenschaftliche historische Rußlandforschung im Dritten Reich 1933–1945, Frankfurt/M. 1990, S. 87, 89, 125.
19 Gemeint ist die von Dr. Georg Leibbrandt (1899–1982) geleitete „Abt. zur Bekämpfung des Bolschewismus“ im Außenpolitischen Schulungsamt der NSDAP. Aus dieser Rosenberg unterstehenden Einrichtung sollte das Spitzenpersonal des künftigen RMO rekrutiert werden. Die dort zusammengetragenen Informationen wurden im „Büro Leibbrandt“ redigiert u. in der Publikationsstelle Ost der Osteuropäischen Forschungsgemeinschaft veröffentlicht; vgl. Haar/Fahlbusch: Handbuch der völkischen Wissenschaften, S. 370–373, 611–614.
20 August Meier, geb. 1900, Soldat 1918, Schutzpolizei 1922–1934, 1925–1927 NSDAP, 1933 Wiedereintritt u. SS, Nov. 1934 als Ostuf. hauptamtlich zum SD, Fhr. SD-UA Wiesbaden, 1938 Stubaf. u. Fhr. SD-Abschnitt Troppau, 1941 Ostubaf. u. Fhr. SD-Abschnitt Liegnitz, Juni 1941 Leiter III im Stab EG B, Juli–Sept. VO der EG C beim HSSPF u. Berück Rußland-Süd, danach Kdr. EK 5 bis Jan. 1942, dann Stab BdS Kiew u. Unternehmen „Zeppelin“, Juni 1943 KdS Limoges, Okt. 1944 Kdr. z.b.V.Kdo. 2 im Raum Danzig, 1949 festgenommen, 1952 in Bordeaux zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, 1956 entlassen, 1959 erneut festgenommen, 1960 Selbstmord in Haft; BAB, BDC, SSO August Meier; Übersicht über die vorhandenen SD-OA u. SD-UA v. 5.12.1935, BAB, R 58/241; Vern. August Meier v. 8., 9. u. 16.9.1959, BAL, B 162/5224, Bl. 103ff., 116ff., 245ff.; dto. v. 29. u. 31.10.1959, BAL, B 162/5225, Bl. 399ff., 405f.; BAL, ZK: August Meier.
21 Gemeint ist Friedrich Jeckeln, geb. 1895, Soldat 1914–1918, zuletzt als Lt., Ingenieur, 1929 NSDAP, 1930 SS, 1931 Oberf., 1932 MdR, Jan.–Juli 1933 Fhr. SS-Gruppe Süd, August 1933 Fhr. OA Nordwest u. Gruf., 1936 Fhr. OA Mitte u. Ogruf., Juli 1940–Mai 1941 Fhr. OA West, danach HSSPF Rußland-Süd, Okt. 1941–1945 HSSPF Ostland u. Rußland-Nord, 1945 in Riga zum Tod verurteilt, 1946 dort hingerichtet; BAB, BDC, SSO Friedrich Jeckeln; BAL, ZK: Friedrich Jeckeln; Frank Flechtmann: „Und nun erst recht!“ Ein Hornberger läßt schießen, in: Die Ortenau 76(1996), S. 471–491; Richard Breitman: Friedrich Jeckeln. Spezialist für die „Endlösung“ im Osten, in: Smelser/Syring: Die SS: Elite unter dem Totenkopf, S. 267–275; Thomas Köhler: Himmlers Weltanschauungselite: Die Höheren SS- und Polizeiführer West– Eine gruppenbiographische Annäherung, in: Schulte: Die Polizei im NS-Staat, S. 59–62.
22 Walther Rauff, geb. 1906, 1924–1937 Kriegsmarine, zuletzt als Korvettenkapitän, 1937 NSDAP, 1938 SS u. als Hstuf. Referent I/1 im SD-HA, 1939 Stubaf., 1940/41 Chef einer Minensuchflottille an der Kanalküste, 1941 Ostubaf. u. als Gruppenleiter II D u. VI F (Technische Angelegenheiten) im RSHA zuständig für die Entwicklung der Gaswagen, Sommer 1942 Kdr. des EK der Pz.Armee Afrika, Nov. 1942 als Chef des EK Nordafrika nach Tunis, Sommer 1943 Sipo-Einsatz in Korsika, danach Kdr. Sipo-Kdo. Oberitalien-West, 1944 Staf., Dez. 1946 Flucht aus britischem Gefangenenlager, 1948/49 Berater für den syrischen Geheimdienst, Dez. 1949 Flucht nach Ecuador, 1958 Chile, gest. 1984; BAB, BDC, SSO Walther Rauff; GVP RSHA Stand 1.3.1941, BAB, R 58/240; Vern. v. 28.6.1972, BAL, B 162/3637, Bl. 76–91; BAL, ZK: Walther Rauff; Klaus-Michael Mallmann/Martin Cüppers: Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina, Darmstadt 2006, S. 138–147, 202–207, 242–245; Martin Cüppers: Immer davongekommen: Wie sich Walther Rauff dauerhaft seinen Richtern entzog, in: Mallmann/Angrick: Die Gestapo nach 1945, S. 71–89. In seiner Funktion als Gruppenleiter II D war Rauff auch für die Ausrüstung der EG zuständig u. wurde deshalb in den Verteiler der EM aufgenommen.