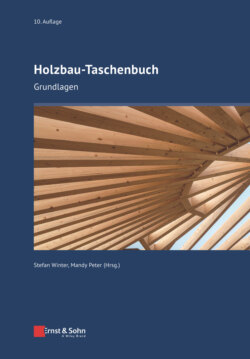Читать книгу Holzbau-Taschenbuch - Группа авторов - Страница 16
2.1 Ressourcenverfügbarkeit und Nachhaltigkeit
ОглавлениеDer Holzbau erfährt zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen ungeahnten Auftrieb. Basierend auf umfangreichen Forschungen und Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene – neben den Entwicklungen im Ingenieurholzbau insbesondere in den Bereichen Brandschutz und Bauphysik – und der umfangreichen Adaption von CAD/CAM-basierten Fertigungsmethoden gilt er plötzlich wieder als „modern“ . Und nicht nur in Europa, sondern auch in vielen anderen Regionen von Asien über Australien und Neuseeland bis nach Süd- und Nordamerika ist die Anwendung des Holzbaus aus politischen Gründen attraktiv geworden. Die Verpflichtungen aus dem Kyotoprotokoll und dem Pariser Klimaabkommen von 2016 haben in vielen Staaten von China bis Chile die Erkenntnis reifen lassen, dass mit der zunehmenden Verwendung des nachhaltig verfügbaren Baumaterials Holz ein signifikanter Beitrag zur Reduktion der Energieaufwendungen im Bauwesen und gleichzeitig eine Kohlenstoffspeicherung und damit CO2-Senkenfunktion erreicht werden kann.
Diese Funktionen können nur dann genutzt werden, wenn das Holz für die stoffliche Verwendung aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Entnahmemenge des Holzes darf die jährlich nachwachsende Menge nicht überschreiten. In der Bundesrepublik Deutschland ist diese Voraussetzung durch das Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) gegeben [2.1]. Diese gesetzliche Regelung fehlt jedoch in vielen Ländern, wird dort aber zunehmend durch die Nachhaltigkeitszertifizierungen des Forest Stuartship Council (FSC) [2.2] oder des Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) [2.3] ersetzt. Diese Nichtregierungsorganisationen sind inzwischen international breit anerkannt. Selbst in europäischen Ländern werden trotz vorliegender gesetzlicher Regeln inzwischen zum Teil diese Zusatzzertifizierungen vorgenommen. Entsprechende Vorgaben zum Nachweis der Herkunft der verwendeten Hölzer sind zudem in Ausschreibungen enthalten, um zu vermeiden, dass der gewünschte Klimaeffekt infolge der Holzverwendung durch Holz aus Raubbau konterkariert wird. Grundsätzlich ist rechtlich die Implementierung von Umweltverträglichkeitsnachweisen in Ausschreibungen möglich. Insbesondere der Bund und einzelne Länder und Kommunen verlangen eine gebührende Berücksichtigung entsprechend ihren Vergaberichtlinien. Private Bauherren sind selbstverständlich frei darin, diese Anforderungen ebenfalls zu implementieren oder sogar weitergehend die Verwendung regionaler Holzressourcen zu fordern und damit zu fördern.
Abb. 2.1 Zunehmende Mischwälder führen zu verändertem Holzaufkommen – Abnahme des Nadelholzaufkommens (Softwood – SW) und Zunahme des Laubholzaufkommens (Hardwood – HW)
(Quelle: Katharina Winter).
Aus Sicht der Nachhaltigkeit ist die Situation der Holzverwendung in Mitteleuropa und insbesondere Deutschland noch weitgehend entspannt. Im Jahr 2015 (EUROSTAT: Forstwirtschaftliche Statistik 2015 [2.4]) überstiegen die Zuwächse an Holzmasse in deutschen Wäldern die Entnahmen um 10 Mio. Festmeter bei einer Erntemenge von ca. 70 Mio. Festmetern.
Allerdings lohnt eine genauere Analyse der Zusammensetzung: Durch den fortschreitenden forstwirtschaftlichen Umbau unserer Wälder steigt das Laubholzaufkommen, während das Nadelholzaufkommen zurückgeht. Im Zeitraum von 2008 bis 2013 erhöhte sich das Laubholzaufkommen in deutschen Wäldern um 13,3 %, während das Nadelholzaufkommen um ca. 13,9 % abnahm [2.4] (Abb. 2.1).
Die Zusammensetzung der Nadelholzbestände selbst verschiebt sich ebenso allmählich, da die Forstwirtschaft eine Anpassung an den Klimawandel vornehmen muss und damit Baumarten wie die Douglasie zunehmend Verwendung finden. Sie sind gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels resistenter als beispielsweise der bisherige „Brot-und-Butter“-Baum der Forstwirtschaft, die Fichte.
Die Folgen der Veränderung des Rohholzaufkommens sind bisher noch kaum zu spüren. Aber die zunehmende Verfügbarkeit von Hartholz führt zu einer beginnenden Renaissance der Laubholzverwendung im Holzbau und zur Entwicklung einer Reihe neuer Werkstoffe. Bauhölzer wie die Eiche wurden schon immer dort für konstruktive Zwecke eingesetzt, wo besonders hohe Beanspruchungen aufgenommen werden mussten oder eine erhöhte Dauerhaftigkeit nötig war. Beispiele sind die Fachwerkkonstruktionen von vielgeschossigen Häusern oder Glockentürme. Aber auch punktuell wurde Eiche wegen ihrer hohen Querdruckfestigkeit zur Lastverteilung verwendet, z. B. in dem herausragenden Ingenieurbauwerk der Eisenbahnbrücke über die Iller in Kempten von 1848. In dem Howe’schen Fachwerkträger aus Schweizer Lärchenholz wurde Eiche als Druckknoten der Fachwerkstreben und für die Schirrbalken eingesetzt (Abb. 2.2).
Andere Laubholzarten wie die Buche oder Esche wurden hingegen in historischen Konstruktionen kaum konstruktiv eingesetzt, allenfalls regional, wie z. B. in Oberhessen die Buche als Schindel für Wandbekleidungen. Da jedoch bereits jetzt ein hohes Rundholzaufkommen insbesondere an Buche oder Esche vorhanden ist, setzte eine Entwicklung von Laubholz- und hybriden Holzwerkstoffen ein. Die Holzarten weisen wie die Eiche höhere Festigkeiten und Steifigkeiten auf und sind somit eine hochinteressante Erweiterung der Holz- und Holzwerkstoffsortimente. Beispiele sind Brettschichtholz aus Eiche [2.14], Esche und Buche [2.5], hybrides Brettschichtholz aus Fichte und Esche (Abb. 2.3) [2.5] oder Furnierschichtholz aus Buche (Abb. 2.4) [2.6].
Abb. 2.2 Fachwerkknoten der Eisenbahnbrücke über die Iller von 1848
(Quelle: bauart).
Abb. 2.3 Hybrides Brettschichtholz aus Fichte und Esche
(Quelle: HoFo TUM).
Die Entwicklung steht sicher erst am Anfang. Da sich die Harthölzer ökonomischer schälen und spanen als sägen lassen, ist zu erwarten, dass es insbesondere im Bereich der Sperrhölzer und Furnierschichthölzer, der Spanhölzer wie Oriented Strand Board (OSB) oder Laminated Strand Lumber (LSL) und hybriden Werkstoffe aus Schnittholz und Furnieren zu weiteren Innovationen kommen wird. Auch ein vermehrter Mix aus Nadel- und Laubhölzern in einem Produkt wie in Abb. 2.3 dargestellt, ist zu erwarten.
Abb. 2.4 Furnierschichtholz aus Buche
(Quelle: Pollmeier Furnierwerkstoffe GmbH).
Ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der planerischen Entscheidung, welcher Werkstoff eingesetzt werden soll, ist die ökologische und ökonomische Bewertung in Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment – LCA) und Lebenszykluskostenanalysen (Life Cycle Costs – LCC). Durch diese Berechnungen sollte möglichst objektiv nachgewiesen werden, welche Bauprodukte und Bauarten zu einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck bei gleichzeitig vertretbaren Kosten führen. Wichtigste Kriterien sind der Primärenergieverbrauch aus erneuerbaren und nichterneuerbaren Quellen und die CO2-äquivalenten Emissionen.
Leider sind zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches noch keine werkstoffübergreifenden, einheitlichen Datensätze für alle Bauprodukte und Bauarten verfügbar. Zwar hat es erhebliche Verbesserungen bei den die Berechnungsverfahren und -voraussetzungen beschreibenden Normen gegeben (insbesondere DIN EN 15978 [2.7]), aber noch immer sind am Markt Umweltdeklarationen (Environmental Product Declaration – EPD) kursierend, die auf alten Berechnungen beruhen. Die derzeit insbesondere im Holzbereich wohl zuverlässigste und den aktuellen Berechnungsverfahren entsprechende Baudatenbank ist die Ökobaudat [2.8]. Sie wird in den meisten wissenschaftlichen Vergleichsrechnungen derzeit als Basis herangezogen.
Holzbasierte Bauprodukte und Bauarten weisen prinzipiell drei Vorteile bei der Berechnung der klimarelevanten Umweltwirksamkeit gegenüber anderen Werkstoffen auf und einen zusätzlichen weiteren Vorteil, der den Forstsektor betrifft:
1 Treibhausgas-(THG-)Einsparungen, die entstehen, wenn anstelle eines mineralischen Gebäudes ein funktional äquivalentes Holzgebäude gebaut wird (stoffliches Substitutionspotenzial).
2 Potenzial an THG-Senken durch die temporäre Speicherung von biogenem Kohlenstoff aufgrund der stofflichen Holzverwendung auf nationaler Ebene (Speicherpotenzial Holzprodukte).
3 THG-Einsparungen, die entstehen, wenn anstelle von fossilen Brennstoffen nachwachsende Biomasse verwendet wird (energetisches Substitutionspotenzial).
4 Potenzial an THG-Senken durch die Speicherung von biogenem Kohlenstoff aufgrund der Zunahme an Biomasse in Wäldern auf nationaler Ebene (Speicherpotenzial Wald) → Forstsektor.
Aktuelle Berechnungen für Gebäude im Wohnungsbau weisen ein stoffliches Substitutionspotenzial an THG-Einsparungen von 9 bis 56 % in Bezug auf die Gebäudekonstruktion auf, wenn anstelle eines mineralischen Gebäudes ein funktional äquivalentes Holzgebäude gebaut wird. Die Höhe des Potenzials ist dabei abhängig vom Gebäudetyp, den verwendeten Baumaterialien und der Planung. Auch ein funktional äquivalenter holzbasierter Ausbau anstelle eines mineralischen Ausbaus weist bereits ein stoffliches Substitutionspotenzial von 10 bis 25 % auf [2.9].
Das Potenzial als THG-Senke wird durch die Speicherung des Kohlenstoffs in Holzprodukten beschrieben. Durch eine vermehrte stoffliche Verwendung von Holzprodukten im Bauwesen wird ein Kohlenstoffspeicher angelegt. Dieser Speicher wird bezüglich der THG-Wirkung analog zum Waldspeicher als CO2-Senke auf nationaler Ebene mit bilanziert. Das wirkt sich auf die Erreichung der Klimaziele positiv aus, wenn mehr Holzprodukte eingesetzt als entsorgt werden [2.9, 2.10].
Der dritte Vorteil beschreibt die energetische Substitution, da die im Holz enthaltene und gespeicherte erneuerbare Energie am Ende des Lebenszyklus zur Energiegewinnung eingesetzt werden kann und damit fossile Energieträger ersetzt werden können. Allerdings muss man beachten, dass häufig bei der Darstellung des Primärenergiebedarfs zur Herstellung eines Bauprodukts bei einer Einzahlangabe der erneuerbaren Primärenergie die im Holzprodukt enthaltene „eingebettete Energie“ enthalten ist. Normativ ist eine getrennte Darstellung und Ausweisung der Primärenergie, die für die einzelnen Prozesse benötigt wird (energetische Nutzung), und der Primärenergie, die im Material enthalten ist (stoffliche Nutzung), bereits vorgeschrieben [2.7, 2.11] und sie sollte in allen zukünftigen Untersuchungen konsequent umgesetzt werden. Für den Fall, dass ein Produkt stofflich genutzt wird und Primärenergie im Material enthalten ist, wird diese im Rahmen einer Ökobilanz zu Beginn angerechnet und am Ende des Lebenswegs wieder gutgeschrieben [2.10]. Durch die getrennte Ausweisung wird transparent, welche Primärenergie für Produktionsprozesse aufgewendet wird. Im Vergleich der Werkstoffe und Bauteile können dadurch die Optimierungspotenziale im Sinne der Energie-und Ressourceneffizienz erkannt und nachgewiesen werden.
Abb. 2.5 zeigt die positiven Wirkungen in einer schematischen Darstellung. Der Vorteil 1 wird in einer Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken nach DIN EN 15978 [2.7] durch eine vergleichende Ökobilanzierung auf Gebäudeebene dargestellt [2.9], der Vorteil 2 wird durch die eingesetzte Menge von Holz und Holzprodukten bestimmt und spiegelt sich im Indikator GWP (engl.: Global Warming Potential, dt.: Treibhausgaspotenzial) [2.12, 2.10] wider und der Vorteil 3 wird durch den Indikator PERM (engl.: Primary Energy Renewable Material, dt.: erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung) im Lebenszyklusmodul A und C sowie im Falle einer energetischen Verwertung im Modul D ausgewiesen. Zu berücksichtigen sind zudem die Interdependenzen und Wechselwirkungen der verschiedenen Vorteile und Themen, z. B. zwischen dem Waldspeicher und Holzproduktspeicher [2.9] oder bezüglich des Primärenergieaufwands und der Menge an Holz in der Konstruktion [2.12].
Ein vereinfachtes Nachweisverfahren im Sinne der wesentlichen Anforderung Nr. 7 (BWR 7) des Anhangs I der Bauproduktenverordnung [2.13] mit entsprechenden Kennwerten zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen würde dem Holzbau ermöglichen, seine Vorteile entsprechend darzustellen [2.9] und Vergleiche zu ziehen.
Abb. 2.5 Vorteile von Holzbauprodukten im Lebenszyklus der Bauprodukte
(Quelle: Stefan Winter).
Es ist mittelfristig zu erwarten, dass die Bauordnungen der Länder für das Nachhaltigkeitskriterium gleichberechtigt mit den anderen Grundanforderungen an Bauwerke Nachweise fordern werden. Der oben erwähnte politische Wille kann damit objektiviert werden, wenn ein vereinfachtes Verfahren für den Nachweis der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen verfügbar wird. Entsprechende Ansätze, die zunächst Verfahren vergleichbar zu den ersten Wärmeschutzverordnungen verfügbar machen könnten, befinden sich in der Entwicklung, stehen aber noch nicht zur Verfügung. Sie sollten sich zunächst auf die wichtigsten Punkte – Primärenergiebedarf und CO2-äquivalente Emissionen – beschränken. Damit wird der Entwurfsprozess bezüglich der Materialwahl objektiviert.
Der bestehende Widerspruch zwischen einer auch im Holzbau angestrebten Ressourcen- und damit Materialeffizienz und dem Ziel möglichst langfristig realisierter Kohlenstoffspeicherung in den Gebäuden als klimarelevantem Beitrag zur Senkung des CO2-Anteils in der Atmosphäre ist dadurch allerdings nicht aufzulösen – wird aber besser bewertbar.