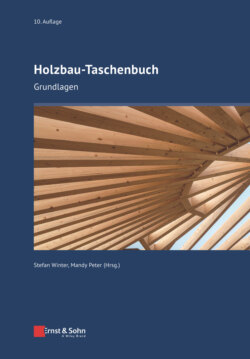Читать книгу Holzbau-Taschenbuch - Группа авторов - Страница 19
Hinweis
ОглавлениеBisher galt in Deutschland:
Einseitig beplankte Dach- und Deckentafeln benötigen in Deutschland zur Sicherstellung der Verwendbarkeit nur eine Herstellererklärung. Ihre Ausführung bezüglich der verwendeten Materialien, Verbindungsmittelabstände etc. ist auf der Baustelle kontrollierbar.
Allseitig geschlossene Holztafeln unterliegen dagegen einer Eigen- und Fremdüberwachung. Sie benötigen einen Verwendbarkeitsnachweis entsprechend der sogenannten „Tafelbaurichtlinie“ [2.15] oder eine CE-Kennzeichnung auf der Grundlage einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA). Eine harmonisierte Produktnorm (EN 14732) ist in Bearbeitung, liegt aber noch nicht vor.
Werden zusätzliche Anforderungen an die brandschutztechnischen Eigenschaften der Holztafeln im Sinne der Muster-Richtlinie für hochfeuerhemmende Holzbauteile [2.16] gestellt, ist darüber hinaus eine zusätzliche Überwachung der herstellenden Betriebe zur Sicherstellung der brandschutztechnischen Eigenschaften der Bauteile, z. B. der hochfeuerhemmenden Bekleidung (K260), der K260-Bekleidung, und der vorgenommenen Installationen erforderlich.
In den Jahren 2018 und 2019 wurden die bisherige Bauregelliste des DIBt und die Muster-Liste der eingeführten technischen Baubestimmungen zu der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) zusammengefasst [2.17]. Ergänzend wurde wegen der Veränderung einiger Landesbauordnungen in den Jahren 2018/2019 mit zunehmender Gestattung hochfeuerhemmender Holzbauteile und von Holzbauteilen, die anstelle von hochfeuerhemmenden und feuerbeständigen Bauteilen verwendet werden dürfen, der Entwurf einer neuen Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile in Holzbauweise (M-Holzbau-RL) [2.18] veröffentlicht. Mit den neuen Vorschriften wurden auch neue Begrifflichkeiten eingeführt. So gibt es beispielsweise für Bauarten keine „Zustimmung im Einzelfall“ mehr, sie wurde durch eine „vorhabenbezogene Bauartgenehmigung“ ersetzt. Die neuen Vorschriften werden nachfolgend in den Jahren 2020 ff. zu weiteren Veränderungen führen, die insbesondere die Regeln der Produktüberwachung und der Qualitätssicherung betreffen werden. Die bisherige „Tafelbaurichtlinie“ [2.15] und die Überwachungsregeln der M-HFHHolzR [2.16] sollen daher in einem neuen Teil 11 der DIN 1052 zusammengefasst werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass eine CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach harmonisierten europäischen Bauproduktnormen entsprechend der Bauproduktenverordnung [2.13] wegen der fehlenden Vollständigkeit der Produktdeklaration kein Verwendbarkeitszeichen mehr sein kann. Die neue Generation der Eurocodes wird daher an jeweils geeigneter Stelle zukünftig eine Aufzählung der Leistungseigenschaften von Produkten enthalten, die für die Sicherstellung der Übereinstimmung der Produkteigenschaften mit den in der Bemessung angenommenen Werten erforderlich sind.
Konsequenzen für Holzbauplaner und ausführende Unternehmen
Vermutlich ab dem Jahr 2021 ff. sind für die Ausführung von Holzbauwerken die jeweils aktuelle MVV TB in Verbindung mit der M-Holzbau-RL und die DIN 1052-11 zu beachten. In Ausschreibungen muss zudem auf die nach den Eurocodes anzugebenden Leistungseigenschaften der Bauprodukte hingewiesen werden und diese müssen sich in den Leistungserklärungen der Bauproduktehersteller zusammen mit der CE-Kennzeichnung wiederfinden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Holzbauplanung auch der Ausführung entspricht.
Der häufig zitierte Holzrahmenbau ist in der Konstruktionsweise mit dem Holztafelbau völlig identisch. Der Begriff „Holzrahmenbau“ wurde im Zuge des zunehmenden Interesses des Zimmererhandwerks in den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts am Holzhausbau und nach einigen Exkursionen maßgebender Akteure nach Nordamerika geprägt. Es sollten die Prinzipien des handwerklichen Holzhausbaus, im Amerikanischen „Timber Framing“ , für den Ein- und Zweifamilienhausbau nach Deutschland übertragen werden. Aus der mehr oder weniger wörtlichen Übersetzung entstand der Begriff „Holzrahmenbau“ .
Sehr schnell wurde jedoch klar, dass die Qualitätsansprüche hiesiger Bauherren und die bei uns vorherrschenden Witterungsverhältnisse mit einer reinen handwerklichen Baustellenfertigung nicht in Einklang zu bringen sind. Viele der mittelständischen Zimmereiunternehmen haben daher entsprechende Vorfertigungen der Holztafelelemente eingeführt. Da auch in der Normungssprache der DIN 1052 und des Eurocodes 5 durchgängig von Holztafel die Rede ist, hat sich inzwischen der Sprachgebrauch wieder zunehmend vereinheitlicht. Ein konstruktiver Unterschied zwischen Holzrahmenbau und Holztafelbau hat nie bestanden.
Holzfachwerkbau
Der klassische Holzfachwerkbau, wie seit dem frühen Mittelalter bekannt, ist als moderner Holzhausbau so gut wie nicht mehr anzutreffen. Lediglich in einer kleinen Nische ist er im baubiologisch ökologischen Bauen, z. B. kombiniert mit Lehmbauweisen, vorzufinden. Und natürlich im Zuge von Sanierungen und Rekonstruktionsbauten. Abb. 2.17 zeigt ein Beispiel für die Anwendung von Fachwerkbauten bei der Sanierung des Dom-Römer-Areals in Frankfurt.
Holzmassivbau
Die Holzmassivbauweise war jahrhundertelang dem Blockbau vorbehalten. Auch heute noch werden in nicht unerheblichen Mengen, insbesondere im Ein- und Zweifamilienhausbau, hochwertige Blockhäuser hergestellt. Aber sie weisen durch das Aufeinanderstapeln tragender liegender Hölzer verhältnismäßig hohe schwindund lastbedingte, vertikale Verformungen auf.
Dies erfordert besondere konstruktive Maßnahmen wie nachjustierbare vertikale Tragelemente, z. B. die Stützen von Firstpfetten oder gleitende Tür- und Fensteranschlüsse. In Kombination mit den heutigen Anforderungen an Luftdichtheit und Energieeffizienz von Gebäuden erfordert dies höchst sorgfältige Ausführungen und Spezialistenwissen, sodass der hochwertige Blockhausbau eher ein hochpreisiges Nischenprodukt darstellt.
Abb. 2.17 Dom-Römer-Areal
(Quelle: Stefan Winter).
Abb. 2.18 (a) Gedübeltes Brettstapelelement und (b) geklebtes Brettschichtholzelement – als Platte und Scheibe verwendbar
(Quelle: (a) Kaufmann GmbH, (b) best wood SCHNEIDER GmbH).
Aber seit der Entwicklung der Brettstapelbauweise und des Brettsperrholzes ist der „Massivholzbau“ neu zu definieren. Abb. 2.18 zeigt ein gedübeltes Brettstapel- und ein übliches, geklebtes Brettsperrholzelement. Beide Bauweisen sind als Platten- und Scheibentragwerke, als Wände, Decken- und Dachtragwerk einsetzbar. Entwickelte sich die Brettstapelbauweise ursprünglich aus der Idee, die beim Sägen anfallenden Seitenbretter auch konstruktiv zu verwenden und sie durch Vernageln oder Verdübeln einer höherwertigen Verwendung zuzuführen, war die Intention beim Brettsperrholz von vornherein die industrielle Herstellung großflächiger Tragelemente, die durch das kreuzweise Verkleben der Bretter oder Holzwerkstoffe besonders formstabil sind. Eine Variante der Brettstapelbauweise ist die Verwendung von liegendem Brettschichtholz als „geklebte Brettstapel“ . Während Brettstapelbauteile von den Abmessungen her meist auf Breiten bis zu 1,25 m beschränkt sind, werden Brettsperrholzelemente mit Abmessungen bis zu 3,50 m × 22,00 m angeboten, in Sonderfällen bei einer Herstellung im Vakuumbett auch mit noch größeren, nur durch die Transportmöglichkeiten beschränkten Maßen.
Abb. 2.19 Fugenausbildung einer zweiachsig spannenden Brettsperrholz-Beton-Fertigteildecke. d = Stabdurchmesser, t = Lamellendicke
(Quelle: [2.19]).
Holz-Beton-Verbundbau
Der Holz-Beton-Verbundbau ist eine Variante des klassischen Stahlbetonverbundbaus, wie er auch im Stahlbau bekannt ist. Für Deckenbauteile werden Plattenbalken aus Holzbalken und bewehrter Betonplatte hergestellt oder ein Verbund aus flächigen Holzbauteilen (Brettschichtholz, Brettsperrholz, Holzwerkstoffe) und Aufbeton. Die Bauteile bilden flächige Platten- und Scheibentragwerke. Der Verbund wird über Kerven, Schrauben und eingeklebte Verbindungsmittel (Lochbleche, Gewindestangen) oder eine Kombination daraus hergestellt. Meist werden zuerst die Holzdeckenbauteile im Zuge der Errichtung des Holzbaus verbaut, dann die Bewehrung verlegt und Ortbeton ergänzt. Nur in einzelnen Bauwerken wurden die Holz-Beton-Verbunddecken bisher als Fertigteile verwendet. Die Verbindung der Bauteile und der Verguss der Fugen erfolgt dann analog zum Betonfertigteilbau. Die Anwendung von Holz-Beton-Verbunddecken reicht von der Ertüchtigung bestehender Holzbalkendecken bis zum Neubau weit gespannter Decken wie im Schulbau oder im mehrgeschossigen Hochbau. Bisher nur vereinzelt werden auch Holz-Beton-Verbundwände eingesetzt, z. B. als Trennwände oder Fahrschachtwände. Die wachsende Bedeutung des Holz-Beton-Verbundbaus zeigt sich in der Neuerarbeitung eines weiteren Teils zum Eurocode 5 Holzbau, der die Bemessung von Holz-Beton-Verbundbauteilen enthält. Abb. 2.6 zeigt auch Querschnitte typischer Holz-Beton-Verbundbauteile.
Bei der Verwendung von Ortbetonergänzungen können im Holz-Beton-Verbundbau die gleichen Anschlussprinzipien wie im Stahlbetonbau verwendet werden, d. h. die Ausbildung von Ringankern oder der Einbau von Anschlussbauteilen wie Isokörben oder Tronsolen sowie die Ausbildung von Deckenscheiben mit entsprechenden Randbewehrungen. Ebenso sind zweiachsig lastabtragende Bauteile möglich. Abb. 2.19 zeigt den Stoß einer zweiachsig spannenden Holz-Beton-Verbunddecke.
Die Holz-Beton-Verbundbauweisen weisen wie der Stahlbetonbau zusätzlich den Vorteil des brand- und schallschutztechnisch sehr hilfreichen, lückenlosen Vergusses auf. Weitere Hinweise und Bemessungsgrundlagen sind in Abschnitt 5.2.3 enthalten.
Modulbauweisen
Aus der Holztafelbauweise ebenso wie aus der Massivholzbauweise oder einem Mix aus beiden Bauweisen lassen sich komplett vorgefertigte Module herstellen. Die Abmessungen sind im Holzbau im Vergleich zum Betonbau eher von den möglichen Transportabmessungen als von den Transportgewichten abhängig.
Abb. 2.20 Moxy-Hotel München
(Quelle: Stefan Winter).
Der Nachteil des Modulbaus ist die teilweise notwendige Doppelung von Konstruktionsbauteilen wie Trennwänden und Decken, wodurch jedoch gleichzeitig eine akustische Trennung der Bauteile und damit ein guter Schallschutz erreicht werden. Mehr Transportvorgängen für die Bauteile auf der Straße stehen weniger Hebevorgänge auf der Baustelle und eine sehr schnelle Montage gegenüber. Die wirtschaftliche Anwendung hängt also von den projektspezifischen Randbedingungen ab. Wie so oft liegt auch hier das Optimum in einer hybriden Lösung: Module für hoch installierte Bereiche, weitere Ergänzungen durch flächige Holztafel- oder Massivholzbauelemente.
Der wesentliche Vorteil des Modulbaus besteht in der weitgehenden Vorfertigung auch des Innen- und technischen Ausbaus. Sehr viele Arbeiten werden von der Baustelle in das Werk verlegt. Das Vorgehen ist bei hohen Wiederholungsraten besonders wirtschaftlich. Abb. 2.20 zeigt ein hybrides Hotelgebäude, das Erdgeschoss und die Untergeschosse wurden in Stahlbeton, alle aufgehenden Geschosse in Modulbauweise errichtet.