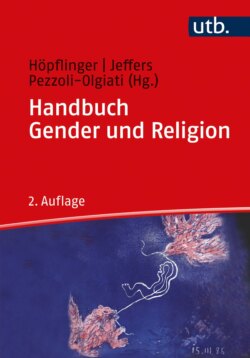Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 57
9 Die Genderisierung der Arbeitswelten
ОглавлениеEin zweiter Aspekt, der für die Genderarchäologie von besonderer Bedeutung ist, betrifft die wirtschaftliche Produktion und die Arbeitsteilung. Genderarchäolog*innen lehnen Annahmen ab, »die auf einer historisch bedingten Arbeits- und Aufgabenteilung beruhen, wie sie in sogenannten ›westlichen‹ Gesellschaften vorkommt«.54 Vielmehr wird Gender als ein Konstrukt hervorgehoben, dessen Fluidität durch die Hinterfragung eines rein binären, geschlechtsspezifischen Raumes betont wird. Somit bestätigt Nelson das Gendering von Arbeitsplätzen als problematisch: Nicht nur war die Arbeitsteilung nach Geschlecht selten absolut, sondern auch geschlechtsspezifische Arbeit war nicht unbedingt geschlechtsspezifisch getrennt.55 Daher ist zu erwarten, dass Männer, Frauen und Angehörige des dritten Geschlechts an denselben Orten unterschiedliche Arbeiten verrichteten, sei es drinnen oder draußen. Meyers vergleicht Agrarwirtschaften mit der heutigen Industriegesellschaft und kommt zum Schluss, dass die Arbeitsleistungen der Geschlechter gleichwertig geschätzt worden wären.56 Zu Recht hat sie »komplementäre geschlechtsspezifische Aufgaben«57 als Beweis hervorgehoben für »eine ausgewogenere Situation geschlechtsspezifischer Macht in den Haushalten, als dies in biblischen Texten impliziert wird«.58
Eine dritte Fallstudie führt uns in die Welt des Backens. Als Grundnahrungsmittel verschaffte die Brotproduktion den israelitischen Frauen Macht über den Haushalt.59 Meindert Dijkstra hat wenig hoffnungsvoll behauptet, dass im alten Israel »die Arbeitsteilung die Frauen […] gewöhnlich an das Haus und an die Aufgaben im Haus bindet«.60 Das archäologische Auffinden von Schleifsteinen und großen sowie kleinen Backöfen in Außenhöfen deutet jedoch darauf hin, dass die Brotherstellung eine gemeinschaftliche Tätigkeit war, bei der gemeinsame Einrichtungen genutzt wurden.61 Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang Delwen Samuels Untersuchung einer ähnlichen Zusammenarbeit der Haushalte im Arbeiterdorf in Amarna, Echnatons kurzlebiger ägyptischer Hauptstadt.62 Darüber hinaus können wir dies mit den Textbelegen abgleichen. Die Frau, die Abimelech in Richter 9:53 tötet, verwendet einen häuslichen Mühlstein, den sie vom offenen Dach eines Turms herunterfallen lässt, und liefert somit ähnliche Beweise für das zeitaufwändige gemeinsame Mahlen im öffentlichen Raum.
Die Anwesenheit von kleinen Öfen deutet auf die Kuchenherstellung hin. Die Materialität lässt sich wiederum mit den literarischen Zeugnissen aus Jeremia 7:16–20 und 44:17–25 in Verbindung bringen. Sie beziehen sich auf Frauen, die in Juda und Jerusalem im späten 7. und frühen 6. Jahrhundert v.u.Z. Kuchen buken. Von besonderer Bedeutung ist Jeremia 7:18, wo ein subversiver Hauskult beleuchtet wird, an dem alle Familienmitglieder beteiligt sind: »Die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer an, und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen.«63
Erst durch das Zusammenführen solch vielfältiger Quellen lassen sich Meyers’ »typische Muster geschlechtsspezifischer Aufgaben bestimmen«.64 Darüber hinaus ist es der Genderarchäologie zu verdanken, dass den Annahmen darüber, wie geschlechtsspezifische Beiträge in der Vergangenheit gemessen und bewertet wurden, heute größere Aufmerksamkeit geschenkt wird.