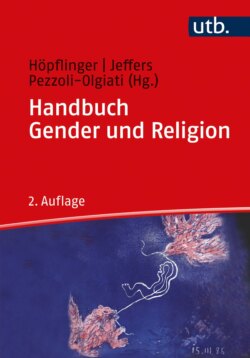Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 63
Einleitung
ОглавлениеSowohl zu Religion als auch zu Gender gibt es unzählige Zugänge. Immer wieder spielen dabei jedoch bestimmte gemeinsame Konzepte eine Rolle, die manchmal als reflektierte Leitlinien, bisweilen aber auch als durchaus kontroverse Schlagwörter verwendet werden. Für den vorliegenden zweiten Teil des Handbuchs haben wir acht solcher aktueller Grundkonzepte von Gender und Religion ausgesucht. Ich möchte in dieser Einleitung zunächst kurz über den Begriff »Konzept« nachdenken, bevor ich auf die hier behandelten acht Grundkonzepte eingehe und am Ende ein Fazit der gemachten Beobachtungen formuliere.
Der Begriff Konzept entstammt der lateinischen Denkwelt: conceptum, wörtlich »das Zusammengefasste«, ist ein Wort für etwas Entstehendes, Erdachtes oder Erfasstes, aber auch für den Fötus, der im Mutterleib heranwächst. Aufschlussreich ist, dass bei dieser Grundbedeutung das Körperliche und das Denkende nicht getrennt sind. Eine Idee ist genauso etwas, das empfangen wird, entsteht und im Wachsen ist, wie eine Leibesfrucht. Körper und Denken sind dabei keine binären Gegensätze, sondern ineinander verwoben. Insofern ist in diesem Begriff, den wir dem zweiten Teil des Buches zugrunde legen, eine Verbindung zu einer genderfokussierten Sichtweise bereits angelegt. Konzept, wie wir es im vorliegenden Buch verstehen, ist ganz gemäss der lateinischen Bedeutungsdimension nichts Statisches, sondern etwas Prozessuales. Ein Konzept ist nicht einfach da; es entsteht, wird aufgenommen und weitergedacht, formt sich aus und transformiert sich. Dies geschieht in der individuellen Reflexion, aber auch im Austausch mit anderen Positionen und Blickwinkeln wie die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Mieke Bal in ihrem 2002 erschienenen Buch Travelling Concepts in the Humanities ausführt.
Im vorliegenden zweiten Teil des Handbuches soll dieser Moment des Austauschs betont werden. Die hier vorgestellten Konzepte präsentieren Denkanstöße aus unterschiedlichen Perspektiven und akademischen Kontexten zu grundlegenden Debatten (und deshalb nennen wir sie Grund-Konzepte), die genderzentrierte Blickwinkel in den letzten Jahren geprägt haben. Wir haben dabei acht Konzepte ausgewählt, die für eine Untersuchung von Religion besonders fruchtbar sind, da mit ihnen eine Reflexion über wissenschaftliche Blickwinkel verbunden ist und sie die Prozessualität und Fluidität sowohl von Gender als auch von Religion betonen.
Grundlegend für viele der heutigen Diskurse über Geschlecht und Religion erwiesen und erweisen sich feministische Theorien und Bewegungen. Sie sind nicht nur in der Gegenwart präsent, sondern waren auch in der Religionsgeschichte bedeutsam. Oder mit anderen Worten: Die heutige Welt und unser Blick auf Gender sähen ohne die feministischen Diskurse und Kämpfe der Vergangenheit anders aus. Dolores Zoé Bertschinger geht in ihrem Beitrag Feminismus. Auf dem »religiösen Auge« blind? der Vernetzung von Feminismus und Religion nach und betont dabei eine Kontinuitätslinie zwischen historischen und gegenwärtigen feministischen Positionen. Sie argumentiert, dass übliche Typologien, beispielsweise die Einteilung der feministischen Bewegungen in drei Wellen, zu eng gefasst sind und dem Facettenreichtum der Fragen nach Gleichberechtigung und der Kämpfe um eine egalitäre Stellung der Frau nicht gerecht werden – vor allem mit einem Blick auf Religion. Die drei Wellen entlarvt Bertschinger als ein »säkulares Narrativ«. Feministische Bewegungen der Vergangenheit waren oft eng mit religiösen Fragen und Positionen vernetzt, während jüngere feministische Diskurse, wie Bertschinger es nennt, manchmal »auf dem religiösen Auge blind« sind. Die Autorin führt dieses Wechselspiel zwischen Feminismus und Religion schließlich am Beispiel der Theologin und Frauenrechtlerin Marga Bührig aus und zeigt auf, wie das Engagement dieser starken Frau auch Fragen der Lebensart und der Identität miteinschloss. Am Ende ihres Beitrags entwirft Dolores Bertschinger das Bild des Kaleidoskops, um die Komplexität feministischer Bewegungen zu betonen.
Diese Idee des Kaleidoskops kann allgemein auf Konzepte im hier verstandenen Sinn übertragen werden. Ein Konzept ist – metaphorisch gesprochen – wie ein Blick durch ein Kaleidoskop. Dieses Instrument verdichtet das Gesehene in bestimmten Mustern und Farben, es multipliziert es aber auch, und bei einer Drehung der geschliffenen Linse wird das Gesehene fluide, vermischt sich mit anderem, tritt neu hervor. Besonders für die großen Fragen des 21. Jahrhunderts eignet sich diese Metapher sehr gut. Eine dieser drängenden Herausforderungen bezieht sich auf ökologisches Bewusstsein und Handeln. Dabei ergibt sich in den Debatten über dieses Themenfeld die Suche nach der Stellung des Menschen im Kontext der Weltzusammenhänge, die sowohl religiöse Blickwinkel als auch Genderdebatten tangiert. Vor allem der sogenannte Ökofeminismus hat sich mit einem Fokus auf Geschlecht vertieft mit Fragen rund um das Zusammenleben von Flora, Fauna und Mensch auseinandergesetzt und dabei nach Zusammenhängen der hierarchisch konstruierten Position des Menschen über die Welt und des Mannes über die Frau gesucht. In dieser Vertiefung verbindet der Ökofeminismus philosophische Reflexion mit Aktivismus. Die Suche nach der Stellung der Frau im Kontext ihrer Umwelt ist verknüpft mit einem Kampf gegen Systeme, die sowohl Frauen und Kinder als auch den Boden, die Tierwelt und die Pflanzen instrumentalisieren und ausnutzen. Ann Jeffers geht in ihrem Artikel Ökofeminismus. Über die Ausbeutung von Frau und Natur diesen komplexen ökofeministischen Strömungen nach. Sie zeigt auf, wie ökofeministische Bewegungen mit Weltbildern religiöser Traditionen interagieren und welche zentralen Fragen dabei debattiert werden. Im Ökofeminismus hat sich eine globale Bewegung über unterschiedliche religiöse Traditionen und verschiedene kulturelle Kontexte hinweg herausgeformt, die sich dieser bedeutenden aktuellen Problematik stellt.
Diesen bei Ann Jeffers thematisierten Blick auf globale Kontexte vertieft Janet Wootton in ihrem Beitrag Frauenbewegungen in globalen Kontexten. Kritische Auseinandersetzung mit »Feminismen«. Feminismus ist nämlich nicht nur eine Bewegung von europäischen und nordamerikanischen Frauen, sondern wird aus unterschiedlichen kulturellen Perspektiven geformt und gedacht. Wootton kritisiert die noch immer zu findende kulturelle Befangenheit im »westlichen« Feminismus sowie deren teilweise bis heute vorhandene Verwobenheit mit dem Erbe des Kolonialismus und präsentiert einen Überblick über zentrale Positionen der weltweiten Frauenbewegung: Von Lateinamerika über den black feminism führt sie ihre Reise nach Asien zu den Dalit-Frauen in Indien und der Minjung-Theologie in Südkorea. Wootton zeigt auf, wie in diesen verschiedenen Kontexten gegen Gewalt und Unterdrückung gekämpft wird und welche Strategien Frauen im Dialog um Gleichberechtigung entwickeln. Am Ende ihres Beitrags diskutiert sie Homi Bhabhas Konzept der »Hybridität«, das er in seinem Buch The Location of Culture entwickelt hat und das hilfreich ist, um die Vielfalt dieser verschiedenen Diskurse und Kämpfe zu verstehen und zu kontextualisieren.
Das Konzept von Fluidität und Vielschichtigkeit liegt auch Benedikt Bauers Beitrag zugrunde. Im Beitrag mit dem Titel »Where heaven and hell collide«. Intersektionen, Religion, Diskriminierungen und Potentiale widmet sich Bauer den intersektionalen Wechselströmungen von Gender und Religion. Mit der Verwendung des Begriff intersection wird ein weiteres metaphorisches Bild angestoßen, nämlich das einer Schnittstelle oder einer Kreuzung. Betont wird dabei die Verwebung von Geschlecht im Netzwerk von Kultur: Gender ist eine wichtige kulturelle Differenzkategorie, aber sie steht nicht alleine im luftleeren Raum, sondern ist, was sich vor allem bezüglich Diskriminierungs- und Ausgrenzungspraktiken prägnant zeigt, verknüpft mit anderen Kategorien wie race, Alter, Bildung. Allerdings handelt es sich bei diesen Überschneidungen, wie Benedikt Bauer ausführt, nicht einfach um simple Additionen von Diskriminierungen, sondern intersektionale Prozesse sind komplexer, und zeit- und kulturgeschichtliche Kontexte verfügen über je eigene Schnittstellen, Machtstrukturen und Differenzmechanismen, die wiederum fluide sind und sich je nach kollektiven Fragen und Diskursen transformieren.
Grundlegend für alle bisherigen betrachteten Ansätze ist das Konzept des Körpers. Der Körper ist etwas, von dem wir alle wissen, was es ist, und das dennoch theoretisch kaum zu fassen ist. Wir sind Körper, aber gleichzeitig bleibt der Körper konzeptuell unbestimmbar und undefinierbar, die Reflexion über ihn schreitet an ihm vorbei. Claudia Jahnel beginnt ihren Artikel Körper und Religion. Jenseits von Somatophobie und Somatophilie mit dieser Unfassbarkeit des Körpers, die vor allem Judith Butler prägnant ausformuliert hat. Der Körper bildet, trotz seiner theoretisch schwierigen Erfassbarkeit, nicht nur ein Repräsentationssystem für Geschlecht, sondern auch für Religion: Religiöses Denken und Handeln sind körperlich geprägt. Claudia Jahnel fokussiert in ihrem Beitrag auf aktuelle theoretische Ansätze, die im Rahmen des material turn entstanden sind. Sie antworten auf die verschiedenen gegenwärtigen Diskurse rund um den Körper, beispielsweise politischer oder medizinischer Art, und definieren den Körper als Produkt unterschiedlicher kultureller Aushandlungsprozesse. Jahnel führt in diese neueren theoretischen Gedanken ein und reflektiert sie.
Eine Verbindung zwischen früheren und aktuellen Ansätzen zieht auch Christian Feichtinger in seinem Beitrag Neue und alte Denkwege. Masculinity und Religion. Er unterscheidet dabei »Maskulinität« als symbolisches, zeit- und kulturspezifisch ausgeformtes Ideal männlicher Eigenschaften von »Mannsein« im Sinne von vielschichtigen empirisch beobachtbaren Aushandlungen von Gender. Während Maskulinität als binäre Differenzkategorie normativ aufgeladen wird, ist das auszuhandelnde Mannsein facettenreich. Die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeitsidealen in Religion ist jüngeren Datums; maßgebend dafür waren Erfahrungen von Homosexuellen mit Diskriminierungsprozessen. Dennoch ist auch gegenwärtig die Religionsforschung zu Männlichkeit noch im Entstehen. Feichtinger schließt seinen Beitrag deshalb mit einem Ausblick auf Aufgaben der Männlichkeitsforschung. Dazu gehört es, Männlichkeit als eine Genderkategorie ernst zu nehmen und den Einfluss von Religion auf Männlichkeitsbilder, aber auch von Männlichkeit auf unterschiedliche Religionen zu untersuchen.
Bei diesen bisherigen Beiträgen wurde deutlich, dass nicht einfach von jeweils einem statischen Konzept gesprochen werden kann. Wissenschaftliche Konzeptualisierungsversuche stehen in Interrelation zu den jeweiligen emischen Konzepten in religiösen Gemeinschaften und Traditionen, aber auch zu Vorstellungen und Erwartungen, eben zum Beispiel hinsichtlich Männlichkeit, die in verschiedenen Medien, wie dem Internet, in Zeitungen, Filmen, Bildern, Musik, etc., ausgeformt und über sie vermittelt werden. Die hier besprochenen Konzepte sind also nicht homogen, sondern leben genau durch das reflexive Zusammenspiel unterschiedlicher Konzeptualisierungsprozesse. Besonders deutlich wird dies beim Beitrag von Stefanie Knauß. Sie geht in ihrem Artikel Queer. Das Konzept, das keines ist Theorieansätzen in diesem Bereich nach. Der Begriff queer entstammt dem HIV-/AIDS-Aktivismus sowie der LGBTQI+-Bewegung und ist sowohl vom öffentlichmedialen Diskurs als auch der Wissenschaft aufgenommen worden. Knauß geht der Forschungsgeschichte dieses Konzepts nach und zeigt auf, dass queere Theorien Identitäten denaturalisieren und die mit ihnen verbundenen Differenz- und Machtprozesse hinterfragen. Theorien über queere Diskurse formen eine Denkrichtung, die Normen, Werte und gesellschaftliche Erwartungen reflektiert. Das Vertraute, als natürlich Geltende wird benannt, analysiert und durchleuchtet, und zwar auch im Rahmen religiöser Traditionen und im Zuge der Religionsforschung. Dazu gehört selbstkritisch das Reflektieren von Grundkonzepten und Axiomen wissenschaftlicher Zugänge, was wir im vorliegenden Buch, vor allem in der Verbindung der Teile I, II und III andenken möchten.
Ein ebenso komplexes und eng mit religiös geprägten Werten und Normen verbundenes Grundkonzept eines genderzentrierten Blicks ist die Familie. Familie formt über Sozialisation Gender- und Wertvorstellungen. Über dieses Konzept und mit ihm konnotierte Geschlechterrollen werden aber auch rege öffentliche Debatten geführt. Wie sind die verschiedenen Rollen innerhalb einer Familie geschlechtsspezifisch zu füllen? Wer gehört zeit- und kulturbezogen überhaupt zu einer Familie? Welche Normen gelten innerhalb der Familie und im Umgang mit ihr, welche Erwartungen sind, wiederum je nach Kontext, mit ihr verbunden? Welche Relationen bestehen zwischen Staat und Familie? Yasmina Foehr-Janssens zeigt diese vielschichtigen Verflechtungen von Familie, Geschlecht und Religion in ihrem Beitrag »Papa, Mama und die Kinder, das ist natürlich!« Familienvorstellungen auf der Spur eindrücklich auf. Sie macht deutlich, wie religiöse Weltbilder und Gendervorstellungen über repräsentative Regimes von Familie legitimiert, naturalisiert, aber auch durchbrochen und in Frage gestellt werden.
Die Beiträge dieses zweiten Teils des Handbuchs werfen je unterschiedliche Blickwinkel auf zentrale Konzepte des Wechselspiels zwischen Gender und Religion. Sie betonen jeweils spezifische Dimensionen und treten somit miteinander in einen Austausch und ein Gespräch. Dabei fallen zwei Prozesse, die immer wieder betont werden, besonders auf:
Erstens heben alle Artikel die Komplexität der jeweiligen konzeptuellen Zugänge hervor. Konzepte lassen sich nur in einem zeit- und kulturgeschichtlich kontextualisierten Setting verstehen. Sie sind geprägt von spezifischen Forschungsvorstellungen und Untersuchungserwartungen, aber ebenso von öffentlichen Debatten und emisch-religiösen Weltbildern. Konzepte sind reflektiertes Nachdenken über die Fragen einer gewissen Zeit und Kultur. Auch unsere gegenwärtigen öffentlichmedialen und wissenschaftlichen Diskurse über Geschlecht und Religion entziehen sich dieser Kontextualität nicht. Sie sind von unseren heutigen normativen Vorstellungen und kollektiven Erwartungen geprägt. Dies zeigen beispielsweise die Beiträge zum Konzept des Feminismus, der Maskulinität oder der Familie auf.
Zweitens verdichten Konzepte Fragen an empirisch beobachtbares Material und machen damit Problemstellungen vergleichbar. Sie haben also einen komparatistischen Grundcharakter und bilden Leitlinien für einen vergleichenden Blick. Dieser kann, wie die Beiträge zeigen, diachron im Sinne einer historisch vergleichenden Perspektive oder synchron als transreligiöse Untersuchung gestaltet sein. Die Herausforderung dabei ist jedoch, auch im Vergleich die Kontextualität der Konzepte nicht zu vergessen. Dies macht der Beitrag zum Ökofeminismus deutlich: Obwohl drängende globale Fragen in verschiedenen Teilen der Welt gestellt werden, sind die konkreten Reflexionen darüber von lokalen Begebenheiten und spezifischen Vorstellungen, auch bezüglich Gender und Religion, geprägt.
Für die genderzentrierte Religionsforschung ist damit eine zweifache Herausforderung verbunden. Auf der einen Seite sollen Grundkonzepte präzise genug bestimmt werden, damit ihre verdichtende Funktion zu einer profilierten Forschungsfrage führen kann. Auf der anderen Seite sollen sie jedoch genügend offen sein, um den empirisch beobachteten Phänomenen gerecht werden zu können. Dabei verhindert eine sorgfältige Reflexion, dass dies zu einer Reise zwischen Skylla und Charybdis wird: Konzepte im Verständnis dieses Handbuchs sind also Denkanstöße, die hoffentlich Neues entdecken lassen.