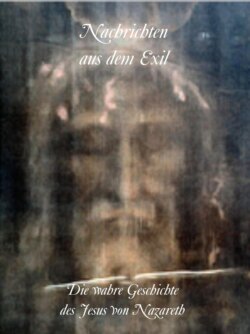Читать книгу Nachrichten aus dem Exil - Hannes Hanses - Страница 6
Nazareth
ОглавлениеDann kam der Tag, an dem wir Nazareth erreichten.
Endlich waren wir da.
Mirjam, Jehosaf, Jeschua, Jakobus, Esther, Joses, Judas, Schimon und Rahel waren wieder Zuhause angekommen.
Der Empfang hätte nach meinem Geschmack jedoch herzlicher ausfallen können, schließlich wohnte fast unsere gesamte Verwandtschaft in Nazareth. Außerdem waren Nachrichten hin und her gegangen und so wusste man in Nazareth bereits Tage oder Wochen vor unserer Ankunft um unsere Situation.
Doch ich kann den Schrecken verstehen den sie empfunden haben müssen als sie Jehosaf, den sie mit siebzehn Jahren als stolzen und kräftigen Burschen von Zuhause weggehen sehen hatten, nun plötzlich als dreißigjährigen sich oft kindisch verhaltenden Mann wieder sahen.
Außerdem lag immer noch ein latent vorhandener Vorwurf in der Luft, der auf meine außereheliche Zeugung zurückging.
Im Großen und Ganzen wurden wir jedoch freundlich empfangen.
Ich bemerkte die Befangenheit der älteren Gemeindemitglieder meiner Mutter gegenüber.
Sie wussten nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollten, wo Jehosaf doch für alle so offensichtlich unfähig geworden war seine Familie zu versorgen.
Es entsprach in keiner Weise ihrer Tradition, dass Frauen so selbstständig und selbstbewusst auftraten, wie Mirjam es nun tat.
Das Leben in Alexandria war freier gewesen und Mirjam hatte sich an dieses Leben gewöhnt.
Gerade für sie war es nun schwer sich wieder zurückzustellen und unterzuordnen.
Aber es blieb ihr nichts anderes übrig wollte sie in Nazareth zurechtkommen und in die Dorfgemeinschaft integriert werden.
Für uns Kinder war es am einfachsten.
Kinder schließen schnell Kontakte, sind noch nicht so in Konventionen gefangen.
Und so tobten besonders meine jüngeren Geschwister bald mit den anderen Kindern des Dorfes durch die Felder.
Mir wurde nachgesagt schon sehr erwachsen für mein Alter zu sein, und so trat ich dann in die Fußstapfen meines Vaters und verdingte mich als Tékton.
In den folgenden Jahren sollte ich der Ernährer der Familie sein.
Ich habe diese Zeit nie bereut. Sie hat mich stark gemacht für das, was noch auf mich zukommen sollte.
Gleichzeitig habe ich diese Zeit genutzt mich intensiv mit der Torá auseinander zusetzen.
Meine buddhistischen Freunde und Gesprächspartner fehlten mir jedoch sehr, besonders mein Lehrer Sedûn, der mir immer neue Anregungen und Betrachtungsperspektiven eröffnet hatte.
Sie waren es, die ich am meisten vermisste. Und ich habe versucht, ihr Andenken so gut es mir möglich war zu bewahren.
Das Ritual, an jedem Morgen meine Gebete und Meditationsübungen durchzuführen behielt ich ehrfürchtig bei. Es war zu meinem inneren Schatz geworden, was innerhalb des Dorfes verwunderte und irritierte Reaktionen auslöste. Man verstand nicht, was ich da machte und hielt mich für sonderbar. Doch man entschuldigte dies mit meinem zu frühen Erwachsenwerden, bedingt durch den tragischen Unfall meines Vaters.
So wurde ich in Nazareth ungewollt zu einem Außenseiter.
Meine jüngeren Geschwister hatten da weniger Schwierigkeiten sich in die neue Gemeinde einzugliedern. Ihnen fehlte die multikulturelle Umgebung Alexandrias nicht so sehr wie mir.
Und Mutter veränderte sich im Laufe der Jahre immer mehr und ordnete sich in das jüdische Umfeld ein.
*
Wir lebten in Galiläa, und hier war ein hellenistischer Einfluss bedingt durch die Herrschaft Herodes Antipas, eines Sohnes Herodes des Großen, unverkennbar.
Galiläa zählte damals zu den Randgebieten der jüdischen Einflusssphäre und es lag Herodes sehr daran Galiläa zu hellenisieren. Aus diesem Grund ließ er Städte wie Sepphoris, die nur sechs Kilometer von Nazareth entfernt lag, oder seine Regierungshauptstadt Tiberias16 am See Genezareth erbauen.
Aber die griechische „Vielgötterei“ stieß bei uns Juden auf strikte Ablehnung und auf massiven Widerstand. Das drängen Herodes führte nur dazu dass wir unseren Glauben noch intensiver bewahrten und lebten.
Es war fast so wie im Exil in Alexandria. Der Glaube unserer jüdischen Nachbarn und Verwandten war strenger und inniger als der im Kernland Judäa, wo sich der Glaube nicht so gegen Fremdeinflüsse behaupten musste.
Hier in Galiläa sollte ich auch erfahren was es heißt arm und ohne Hoffnung zu sein.
Was uns nicht von den reichen Großgrundbesitzern weggenommen wurde, für die meine Landsleute als abhängige Pächter oder Kleinbauern arbeiten mussten, wurde uns durch die Zölle und durch die Kopfsteuer des Kaisers in Rom und auch durch den Zehnten und die Tempelsteuer weggenommen.
Wir waren Handwerker, angesehene Téktone, uns ging es dabei noch verhältnismäßig gut.
Doch mir blieb die bedauernswerte Armut der Kleinbauern, Fischer, Weinbauern, kleinen Handwerker und nicht zuletzt der Tagelöhner und Bettler nicht verborgen. Ich empfand Mitleid mit ihnen und gab ihnen von dem was wir erübrigen konnten.
Ändern konnten wir unsere Situation und die Verhältnisse jedoch nicht.
Auch wir gehörten zur Unterschicht.
Wir waren die „Am ha arez“, die unterdrückten und ausgebeuteten kleinen Leute vom Land, die sogar noch von den Pharisäern aufgrund der geringeren Torá Kenntnisse religiös verachtet wurden, ganz zu schweigen von den Sadduzäern in Jerusalem, die unsere erbarmungswürdige Existenz erst gar nicht zur Kenntnis nehmen wollten.
Die Zeloten waren eine der wenigen Gruppen die, besonders unter ihrem Anführer ‚Judas der Galiläer’ versuchten etwas zu verändern.
Aber ihr Weg war der der Gewalt.
Sie hassten die Römer und sie empfanden es als besonders schmerzlich dem römischen Kaiser die Kopfsteuer zahlen zu müssen.
In ihren Augen war die Entrichtung der Kopfsteuer ein Götzendienst.
Deshalb versuchten sie die Römer mittels Gewalt aus unserem Land zu vertreiben, was bei der militärischen Übermacht der Römer ein schier unmögliches Unterfangen darstellte.
Jeder noch so kleine Erfolg der Zeloten wurde von den Römern grausam gerächt.
Wurden römische Soldaten von Zeloten getötet, so wüteten die römischen Söldner anschließend in unseren Dörfern, vergewaltigten Frauen und Mädchen und nahmen Männer fest, um sie anschließend vor den Augen ihrer Angehörigen grausam zu kreuzigen.
Ja, Kreuzigungen gehörten zu meinen Alltagserfahrungen in der Zeit meiner Jugend und zogen sich letztlich als ständiger Begleiter durch mein ganzes Leben, bis hin zu meiner eigenen Kreuzigung durch die Römer.
In dieser angespannten Atmosphäre also sollten wir nun leben.
*
Anfangs glaubte ich dass mich die Enge des hier gelebten Glaubens einschnüren würde und ich fürchtete, die zarte Knospe meines eigenen Verständnisses von Gott und den menschlichen Beziehungen auf Erden würde ersticken.
Doch der Same des Glaubens und des Mitleids, so wie ihn meine buddhistischen Freunde mich gelehrt hatten, war in mir bereits gekeimt.
Meine Sorge war rückblickend betrachtet unbegründet.
Indem ich meine Rituale allmorgendlich zu beten und zu meditieren beibehielt, gab ich diesem in mir gekeimten Samen die Nahrung die er zum Gedeihen benötigte.
An manchen Tagen war es schwer für mich meine Gewohnheiten einzuhalten.
Hier in Nazareth war ich zum Mann im Haus geworden.
Mein Vater, Jehosaf, hatte zwar immer wieder klare Momente in denen er sich unserer und seiner selbst erinnerte, in denen man mit ihm sprechen konnte, so wie es früher möglich gewesen war, doch die meiste Zeit lebte er in seiner eigenen Welt. In unseren Augen war er dann wie ein Kind.
Wie er sich selbst erlebt hat, haben wir nie erfahren können, denn für ihn gab es nur die eine oder die andere Welt. In wachen Momenten zumindest erinnerte er sich nicht an diesen – ich will es einmal Dämmerzustand nennen – in dem er sich vorwiegend befand.
Jehosaf machte jedoch trotz seines Zustandes einen recht glücklichen und zufriedenen Eindruck auf uns alle.
Für Mirjam war es eine harte Zeit.
Jakobus, Esther und ich halfen ihr so gut es uns möglich war.
Die restlichen Geschwister waren noch zu jung. Für sie war Vater ein toller Spielkamerad, ein Riese mit einer kindlichen Seele, mehr nicht.
Da ich als Ältester und als derjenige, der bereits in Alexandria mit meinem Vater zusammen gearbeitet hatte, das Handwerk meines Vaters am besten beherrschte, nahm ein Onkel meiner Mutter mich auf, bei dem ich die Gelegenheit bekam meine Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vervollkommnen.
Und so wurde aus mir im Laufe der Jahre ein guter und erfahrener Tékton.
Solange ich bei meiner Familie lebte, bzw. finanziell für sie sorgte, habe ich in diesem Beruf gearbeitet. Ich habe mit meinem Onkel in Sepphoris gearbeitet, jener Stadt, die Herodes Antipas mit Genehmigung der Römer wieder aufbauen ließ nachdem sie von Varus17, einem römischen Feldherren, komplett zerstört worden war. Und so schufen wir zusammen mit all den Arbeitern die „Zierde Galiläas“. Wir errichteten Häuser, Synagogen, Tempel, Schulen, Paläste, Banken, legten Straßen und Marktplätze an und erbauten ein Theater das 5000 Sitzplätze besaß und zu den schönsten Bauwerken unseres Landes zählte.
Auch in der Zeit in der ich in Sepphoris arbeitete besuchte ich wann immer es mir möglich war die Theaterveranstaltungen. Doch waren sie nur ein schwacher Abglanz dessen, was ich in Alexandria hatte sehen und erleben dürfen. So wurden hier in Sepphoris vorwiegend unterhaltende Stücke aufgeführt. Komödien des Menander, selten Stücke von Aischylos oder Sophokles. Das Volk liebte die „Pantomimos“, Tänzer die alleine oder in Gruppen Stücke mimisch darstellten, während ein Chor oder einzelne Sänger dazu den Text darboten. Aber viele der aufgeführten Stücke dienten nur noch der Volksbelustigung.
*
Irgendwann in dieser Zeit, ich war gerade für einige Tage in Nazareth mit Arbeiten beschäftigt, bemerkte ich eines frühen Morgens als ich meine Gebete und Meditationen gerade beendet hatte, dass mein Vater verschwunden war.
Das gesamte Dorf beteiligte sich an der Suche nach ihm.
Er war ein Mann mit einer Kinderseele und alle hatten ihn inzwischen lieb gewonnen so wie er jetzt war. Aber manchmal hörte ich sie auch noch tuscheln wie so ein starker und kräftiger Mann so zart und zerbrechlich wirken könne.
Nun suchten alle nach ihm.
Die Rufe: „Jehosaf, Jehosaf“ schalten durch den Ort und über die Felder.
Es wurde Abend aber wir hatten ihn immer noch nicht gefunden.
Die meisten Dorfbewohner hatten schon aufgegeben und waren inzwischen nach Hause zurückgekehrt. Samuel, ein alter Mann der unser Dorfhirte war, saß neben mir und gemeinsam überlegten wir, wo mein Vater stecken könnte.
Samuel murmelte etwas vor sich hin, das ich anfangs nicht verstand. Ich weiß nicht ob er sich mit seinen Worten nur Mut vor der nahenden Dunkelheit machen wollte oder ob es seine tiefe Überzeugung war, auf jeden Fall murmelte er die ganze Zeit etwas wie „…ein guter Hirte lässt seine Schafe nicht im Stich und verirrt sich eines, so sucht er es, bis er es gefunden hat…“ Schließlich wiederholte er diesen Satz immer wieder und er prägte sich in mein Gedächtnis ein.
Etwas später, die Dämmerung war bereits weit vorgerückt, machten wir uns erneut auf die Suche.
Vielleicht hatte dieser Satz, den Samuel ständig vor sich hin gemurmelt hatte ihm beim Nachdenken geholfen, ich weiß es nicht, jedenfalls war Samuel ganz zielstrebig aufgestanden und in Richtung der Felsen gegangen. Ich folgte ihm, in Gedanken immer noch mit seinen Worten beschäftigt. Wir durchkämmten die Felsen und spähten mit unseren Fackeln jeden Spalt und jede Ritze ab. Es wurde immer dunkler und ich war mir sicher, dass mein Vater hier nicht sein würde. Er war in all den Jahren nie hierher gewandert, wir waren nie mit ihm hier gewesen.
Plötzlich blieb Samuel stehen. Vor ihm tat sich ein Abgrund auf, nicht tief, aber die Felsen fielen hier fast senkrecht ab.
Und da lag er, mein Vater. Sein Gesicht lag im Moos welches die Steine bedeckte. Er lag lang ausgestreckt auf dem Bauch da und sah so friedlich aus.
Ich rief ihn an, denn ich glaubte er würde schlafen, so entspannt lag er da.
Samuel half mir hinab zu steigen und folgte mir dann in respektvollem Abstand.
Was ich anfangs nicht erkennen wollte, hatte er sofort begriffen.
Mein Vater schlief nicht, – er war bereits tot.
Vorsichtig berührte ich meinen Vater an der Schulter, doch er rührte sich nicht. Ich drehte ihn zu mir um und sah in sein Gesicht, es wirkte entspannt. Seine Augen strahlten jedoch so, als sehe er etwas unbeschreiblich Schönes.
Samuel stand dicht hinter mir und flüsterte: „Jetzt hat er seinen ewigen Frieden gefunden“.
Ich drehte mich zu Samuel um und sah ihn an. Tränen liefen mir übers Gesicht.
Ich weinte um meinen Vater, doch gleichzeitig, ich kann es nicht anders beschreiben, erfüllte mich auch ein Gefühl des inneren Friedens. Ich spürte in diesem Moment zum ersten Mal, dass der Tod wohl keine Bedrohung darstellt, so wie ich es bisher immer gesehen hatte. Er ist wohl mehr ein Übergang zu etwas, was uns Lebenden verborgen bleibt.
In diesem Moment, den Vater im Arm haltend, geschah etwas in mir, das meine Angst vor dem Tod für immer besiegte.
Ich erkannte dass der Tod nichts Grausames und Unreines war, so wie die Priester es uns lehrten.
Sicher, für uns Zurückbleibenden ist es hart und schmerzlich. Ein vertrauter geliebter Mensch ist für uns auf immer verloren. Wir können uns nicht mehr an seinen Bewegungen, an seinen Worten und seinem Dasein erfreuen.
Und ich begriff, dass Trauer etwas ausschließlich für die Überlebenden ist. Der Tote selber empfindet keine Trauer.
In unserer Religion ist es Brauch seinen Schmerz zum Ausdruck zu bringen, indem man sich das Hemd über dem Herzen zerreißt, und ich glaube, dass diese symbolische Geste sehr prägnant zum Ausdruck bringt wie der trauernde Angehörige oder Freund sich fühlt. Das Herz scheint zu zerreißen über den Verlust des geliebten Menschen.
Vielleicht sollte man dieses Zerreißen folgendermaßen interpretieren:
Ein in den Boden geworfener Same muss erst „zerreißen“, also aufspringen, damit sich aus ihm der Keim des Neuen und Lebendigen entwickeln kann.
So verstehe ich seither auch unsere Trauer. Aus ihr kann sich etwas Neues entwickeln, das die Erinnerung an den Verstorbenen in sich trägt und aus der wir Zurückbleibenden unsere Kraft für das Weiterleben ohne den geliebten Verstorbenen schöpfen können.
Samuel suchte einen Weg aus der Schlucht, während ich meinen Vater im Arm hielt und ihn wie ein Kind in meinem Schoß wiegte. Ohne dass ich es selber gemerkt hatte summte ich Lieder die mein Vater mir in meiner Kindheit vorgesungen hatte.
Die Rollen hatten sich endgültig vertauscht.
Nun war ich der Mann und er das in meinem Schoß ruhende Kind.
Ein Gefühl des vollkommenen Friedens umfing mich.
Samuel näherte sich uns vorsichtig.
Wie er mir später einmal erzählte, hatte er uns schon eine ganze Weile zugesehen, hatte aber diesen intimen und intensiven Moment des Zusammenseins von mir und meinem Vater nicht stören wollen.
Er sagte mir: „Jesus, du hattest den gleichen ruhigen und strahlend zufriedenen Gesichtsausdruck wie dein Vater als ihr beide dort ‚saßt’. Eine solch tiefe und innige Verbundenheit eines Lebenden mit einem Toten habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen“.
Ich wusste damals keine Antwort darauf, doch habe ich seine Worte in meinem Gedächtnis bewahrt.
Zum ersten Mal spürte ich, dass es gut und wichtig ist den Sterbenden oder Toten auf seinem Weg zu begleiten. Man muss davor keine Angst haben, im Gegenteil. In dem Moment, wo ich mich auf die Vorgänge des Sterbens und Todes einlasse, eröffnet sich eine vollkommen neue Perspektive. Meine eigene Erfahrungswelt wird bereichert und der Tod verliert seine Schatten.
„Ich habe einen Weg gefunden, wie wir deinen Vater hier herausbringen können“.
Ich nickte still, wäre jedoch am liebsten für immer so sitzen geblieben.
Samuel half mir meinen Vater zu Schultern. Jetzt wirkte er, dort auf meinen Schultern, wie ein Opferlamm das zum Altar getragen wird. Er war so leicht. Ich spürte seinen Körper kaum.
Samuel ging voraus und zeigte mir den Weg. Einige Male hielt er an um mich zu fragen ob wir nicht lieber anhalten sollten um eine Pause zu machen. Doch ich winkte jedes Mal ab. Als wir unser Dorf erreichten wurde es bereits wieder hell.
*
Ich sah es meiner Mutter an, dass sie die ganze Nacht voll Angst gewesen war und gewacht hatte.
Mit jeder verstrichenen Stunde war ihre Hoffnung gesunken dass wir Jehosaf lebend zurückbringen würden.
Jetzt, als sie uns ankommen sah, lief sie auf uns zu.
Ihr Gesicht klarte auf, doch als sie sich uns auf etwa 10 Meter genähert hatte, blieb sie abrupt stehen. In einem Moment erlosch alles Leben in ihren Augen. Sie hatte erkannt, dass ich einen leblosen Vater auf den Schultern trug.
Obwohl Vater ihr in den letzten Jahren kein Mann mehr hatte sein können, liebte Mirjam unseren Vater immer noch sehr. Sicher, er war in gewisser Weise zu einer Art „Last“ geworden, die für uns alle den Alltag gänzlich verändert hatte; doch erträgt wahre Liebe nicht so manches Unglück?
Die Endgültigkeit des Todes überwältigte meine Mutter in diesem Moment.
Sie empfand beim Anblick ihres toten Mannes nicht den Frieden den ich empfunden hatte als wir ihn dort in der Schlucht fanden; und es ist mir auch später nie wirklich gelungen ihr begreiflich zu machen, dass der Tod kein böser Schrecken ist.
Genauso abrupt wie sie stehen geblieben war, drehte sie sich um und lief zum Haus.
Ich fühlte ihren ohnmächtigen Schmerz und hörte ihr Klagen und Weinen, und ich erkannte augenblicklich, dass in diesem Moment eine große Distanz zwischen ihrer und meiner Trauer lag.
Vorsichtig legte ich Jehosaf in den Sand vor unserem Haus. Der Abdruck seines Gürtels zeichnete sich auf meiner Schulter ab. Ich wünschte mir in diesem Moment, er möge für immer dort bleiben, als „Mal“, als sichtbares Zeichen der Verbundenheit zwischen Vater und mir. Gleichzeitig aber wusste ich auch, dass es dieses sichtbaren Zeichens nicht bedurfte.
Samuel und ich standen in der aufgehenden Sonne des neuen Tages vor meinem Vater.
Langsam kamen immer mehr Dorfbewohner zu unserem Haus und umringten uns.
Die Frauen hatten sich zu meiner Mutter gesellt und stimmten mit ihr in die monotonen aber irgendwie auch beruhigenden Klagerufe ein.
Der Rabbi kam und segnete meinen Vater. Dann wies er einige Männer des Dorfes an auf dem Begräbnishügel ein Loch für seinen Leichnam auszuheben.
Am Abend dieses Tages, in meinem sechzehnten Lebensjahr, wurde mein Vater also beigesetzt. In ein Tuch eingewickelt hatten wir ihn in das ausgehobene Erdloch gelegt. Meine Schwestern Esther und Rahel hatten wunderschöne wilde Blumen gepflückt und sie auf den eingehüllten Leichnam meines Vaters gestreut. Die Gemeinschaft des Dorfes umfing uns und ich spürte wieder wie gut es tat, in einer Gemeinschaft aufgefangen und von vertrauten Menschen umgeben zu sein, die alles mit einem teilten, Freude ebenso wie Schmerz und Leid.
Meine Mutter weinte die ganze Zeit über und es sollte noch einige Wochen dauern, bevor sie sich selbst wieder gefunden hatte.
Erstaunlicherweise trug die Routine des Alltags sehr dazu bei, dass sich die Trauer nicht wie ein bleischwerer, dunkler Schatten über uns alle ausbreitete.
Das Leben – unser Leben – ging weiter.
Im Grunde hatte sich in unserem Alltagsleben auch nicht so sehr viel verändert.
Seitdem wir nach Nazareth zurückgekehrt waren, war ich derjenige gewesen der für die Arbeit und die Ernährung unserer Familie zuständig war. Die Belastung der Verantwortung die ich empfand, seit mein Vater nicht mehr unter uns weilte, war zwar größer geworden, doch hatte sich grundsätzlich nichts geändert.
In meiner Freizeit spielte ich mit meinen Geschwistern oder zog mich in aller Stille zurück.
Dann durchstreifte ich allein die Umgebung unseres Dorfes und fand mich dabei oft in der Schlucht wieder, in der wir meinen Vater gefunden hatten.
Dieser Ort hat für mich seither etwas Magisches, etwas Spirituelles, Heiliges. Dort betete und meditierte ich und fühlte mich dabei von vollkommenem Frieden umfangen. Dort war ich meinem Vater nahe. Dort führte ich im Geiste Zwiegespräche mit ihm, fragte ihn um Rat und bat ihn um Hilfe. Und immer erhielt ich eine Antwort oder erfuhr auf irgendeine Weise Hilfe, indem mir zum Beispiel plötzlich etwas klar wurde oder ich etwas erkannte, das mir zuvor bei aller Nachdenklichkeit nicht in den Sinn gekommen war.
Auf diese Weise verbrachte ich immer häufiger meine Zeit in dieser einsamen Schlucht wobei die Kraft, die ich von diesem Ort bezog, von Tag zu Tag größer wurde.
Gleichzeitig wuchs in mir aber auch etwas, dass ich damals noch nicht beschreiben konnte. Es war eine Art Sehnsucht die nichts mit meinem Leben in Nazareth zu tun hatte. Ich verspürte ein Brennen in mir – einen Durst nach Wissen und Verstehen.
*
Einige Zeit nachdem wir meinen Vater begraben hatten, war der Rabbiner unserer Gemeinde an mich herangetreten um mir zu erklären, dass ich mich reinigen lassen müsse.
Ich sah ihn unverständlich an, denn ich begriff nicht, was er damit meinte.
Unbeholfen trat er von einem Bein auf das andere und erklärte dann, der Umstand dass ich meinen toten Vater so lange auf den Schultern getragen hätte, in diesem Zustand des Todes also mit ihm in Berührung gekommen war, hätte mich unrein gemacht und deshalb müsse ich mich eines Reinigungsrituals unterziehen.
Ungläubig sah ich ihn daraufhin an und obwohl mir der Brauch des Reinigens nach der Berührung mit Unreinem durchaus bekannt war fragte ich dennoch ganz direkt: „Warum?“
„Der Tote und sein toter Körper“, sagte er darauf, „sind unrein und vergiften uns und unsere Seele. Deshalb muss jeder der in Kontakt mit Toten gekommen ist gereinigt werden. So will es das Gesetz.“
Ich konnte nicht glauben was ich da hörte.
Der Kontakt zu Toten sollte unrein machen?
Mir hatte dieser Kontakt das Herz und die Augen geöffnet!
Mich hatte das Zusammensein mit meinem toten Vater gelehrt mit dem Herzen zu sehen!
Mir hatte dieses Zusammensein neue Horizonte erschlossen und nun sollte all dies unrein und verwerflich sein!?
Ich wusste schon dass mich einige der Dorfbewohner für komisch und befremdlich hielten; sie konnten nicht verstehen was ich tat wenn ich betete und meditierte. Und seit dem Tod meines Vaters war diese Fremdheit eher größer geworden. Doch auch auf die Gefahr hin endgültig zum Sonderling abgestempelt zu werden, weigerte ich mich den Anweisungen des Rabbiners zu folgen und mich einem Reinigungsritual zu unterziehen.
Meine Weigerung machte in unserer Gemeinde schnell die Runde.
Nun schlug das Unverständnis in Verachtung und latent vorhandenen Hass um.
Und, ich muss es leider sagen, in dieser Situation war mir meine Familie keine Hilfe. . .
Meine Geschwister hatten nie so wie ich das multikulturelle Leben in Alexandria gelebt. Sie waren dort ganz und gar in der großen jüdischen Gemeinschaft aufgegangen und konnten sich von daher hier in Nazareth viel leichter in die Gemeinschaft integrieren.
So entfremdete sich mir also mit der Zeit auch meine Familie.
Ich spürte wie Mutter unter dieser Entwicklung litt und ich hätte mich ihr gerne erklärt. Doch sie hatte sich in den vier Jahren, in denen wir nun bereits in Nazareth lebten, so in das dörfliche Leben integriert, dass sie kein offenes Ohr mehr für mich hatte. Sie wollte um keinen Preis auffallen und erwartete dies wohl auch von ihren Kindern.
Dem konnte ich jedoch nicht nachkommen, würde ich mich nicht selbst und meine Überzeugungen verraten.
Zwar nahm ich an den Unterweisungen des Rabbis teil und studierte die alten Schriften, doch konnte ich einfach nicht kritiklos hinnehmen was dort geschrieben stand.
Mein Geist war die Freiheit des Denkens gewöhnt und konnte und wollte sich nicht in die formalen Regeln der Schrift, ihrer determinierten Auslegung und ihren gesetzlichen Vorschriften eingrenzen lassen.
So begann man mich schließlich der Besserwisserei und des Frevels gegen Gott zu beschuldigen. Dabei wollte ich doch nur verstehen und begreifen und das Geschriebene ernsthaft durchdringen.
Die Situation wurde von Monat zu Monat angespannter.
Ich versuchte meinen Weg zu gehen, versuchte dem Rabbi klar zu machen, worum es mir ging.
Doch die latente Bedrohung unseres jüdischen Glaubens durch die hellenistischen Vorlieben unseres „Landesvaters“ Herodes Antipas machten es scheinbar unmöglich Toleranz Andersdenkenden gegenüber zu zeigen.
Ich wurde immer einsamer.
Immer öfter zog ich mich zurück und betete und meditiere in der „Schlucht meines Vaters“.