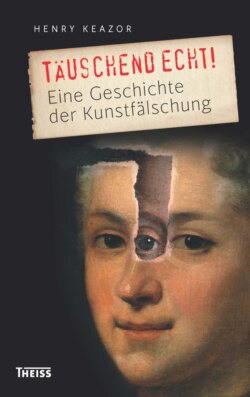Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 10
Fälscher und Kunsthändler
ОглавлениеDie Bloßstellung von Experten war auch das erklärte Ziel des englischen Fälschers Tom Keating (1918–1984), einem Maler und Restaurator, der über 2000 Gemälde von über 100 verschiedenen Künstlern gefälscht haben soll. Keating wurde 1976 von der Journalistin Geraldine Norman im Rahmen eines in The Times erschienenen Artikels überführt, im Folgejahr verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Aufgrund seines damals schlechten Gesundheitszustandes wurde die Anklage jedoch fallen gelassen – vielleicht nicht zuletzt, weil Keating stets deutliche Spuren in seinen Fälschungen gelegt hatte. Seine Fälschungen konzipierte er als Hoaxes. So schrieb er beispielsweise in Bleiweiß Botschaften an seine Restauratorenkollegen auf die Leinwand, bevor er darüber die gefälschte Malerei auftrug, sodass die Schrift bei einer Röntgenuntersuchung des Bildes sichtbar wurde. Oder er baute absichtlich Fehler wie etwa Anachronismen in seine Gemälde ein oder führte diese mit modernen Materialien aus, selbst wenn sie vorgaben, aus der Frühen Neuzeit zu stammen. Keating betrachtete diese Praktiken als ein Legen von „Zeitbomben“. Er spekulierte darauf, dass die von ihm gelegten Spuren früher oder später entdeckt, seine Fälschungen enttarnt und damit zugleich die Schwächen des Kunsthandels aufgedeckt würden, was diesen verunsichern und destabilisieren sollte. Besondere Verachtung hegte er für den seiner Meinung nach von Galerien dominierten korrupten Kunstmarkt, auf dem in seinen Augen amerikanische Kunstkritiker und -händler den Geschmack vorgaben. Dieser ziele nur darauf ab, Kritikern und Händlern, auf Kosten einfältiger Sammler und verarmter Künstler, die Taschen mit Geld zu füllen. Nach seiner Überführung moderierte Keating übrigens zwischen 1982 und 1983 im britischen Fernsehen Sendungen, in denen er die Zuschauer in die Technik Alter Meister einführte. Wie später Wolfgang Beltracchi, der ab Dezember 2014 im Rahmen einer fünfteiligen Dokumentationsreihe auf 3sat ebenfalls solche Themen erörterte, wurde der Fälscher auf diese Weise zum Experten und damit gewissermaßen selbst zum Bediensteten eben jenes Systems gemacht, das er zunächst bekämpft hatte.
Keatings Verfahren der „Zeitbomben“-Hoaxes hat dann später auch Eingang in den Film gefunden, denn die Idee, eine verräterische Botschaft in Bleiweiß unter einer Fälschung zu platzieren, bildet die Inspiration für den Höhepunkt des 2012 von Lawrence Roeck gedrehten Spielfilms The Forger. Erzählt wird darin die Geschichte des 15-jährigen Joshua Mason (gespielt von Josh Hutcherson), der von seiner drogensüchtigen Mutter vernachlässigt wird. Er findet in der Malerkolonie Carmel-by-the-Sea in Kalifornien Unterschlupf, wo er sich schnell als begnadetes Maltalent erweist. Seine Begabung wird von dem skrupellosen Kunsthändler Everly Campbell (Alfred Molina) ausgenutzt, der Joshua dazu anstiftet, für ihn eine Fälschung nach einem verschollenen Bild des amerikanischen Malers Winslow Homer anzufertigen. Als der Junge erkennt, dass Campbell einst auch die ältere und von ihm bewunderte Malerin Annemarie Sterling (Lauren Bacall) dazu gezwungen hatte, für ihn ein Bild zu fälschen, woran sie als Mensch und Künstlerin zerbrach, rächt er sich an dem skrupellosen Kunsthändler: Bei der Enthüllung des angeblich neu entdeckten Winslow-Homer-Gemäldes soll das Bild zum Beweis seiner Echtheit öffentlich mithilfe der Infrarotreflektografie untersucht werden, bei der die unter der Maloberfläche liegenden Vorzeichnungen auf dem Malgrund sichtbar werden. Joshua hat unter seiner Fälschung jedoch – ganz in der Art von Keatings Anachronismen – die Darstellung einer Comicfigur angebracht, sodass das Gemälde sofort als Fälschung entlarvt wird und somit Everly Campbell als Betrüger überführt werden kann: Der junge Künstler hat ein als Fälschung intendiertes Bild auf diese Weise zu einem entlarvenden Hoax werden lassen.
Roecks ansonsten eher etwas blasser Film veranschaulicht die Konjunktur, welche Erzählungen um Kunstfälschungen und über Kunstfälscher aktuell haben – möglicherweise auch provoziert durch den Fall Beltracchi. So legte beispielsweise die amerikanische Autorin B. A. (Barbara) Shapiro 2013 ihren Roman The Art Forger vor, und auch ältere Texte, etwa der bereits 1930 publizierte Roman des im Folgejahr verstorbenen deutschen Schriftstellers Walter Harich werden wiederentdeckt: 2013 legten gleich zwei Verlage dessen Roman Der Kunstfälscher neu auf.
All diesen literarischen und filmischen Aufarbeitungen der Fälscherthematik ist die Präsentation des Künstlers als verführtes oder erpresstes Wesen eigen, das von einem dunklen und geldgierigen Hintermann beherrscht und dirigiert wird. Der ist im Kunsthandel tätig und bereichert sich mithilfe der Fälschungen, die er dem Künstler abgezwungen hat. Diese bei Roeck, Shapiro und Harich gleichermaßen anzutreffende Figurenkonstellation lässt sich sogar bei der Adaption „wahrer“ Geschichten beobachten: 1949 dramatisierte der deutsche Regisseur Fritz Kirchhoff den damals hochaktuellen Stoff um die Vermeer-Fälschungen Han van Meegerens (vgl. Kapitel 6) in seinem Film Verführte Hände. Der Titel ist insofern bezeichnend, als die Schuld in Kirchhoffs Film gegenüber der Realität umverteilt wird: Während Han van Meegeren selbst Initiator und Akteur des Ganzen war, der die Fälschungen nicht nur aus freien Stücken anfertigte, sondern dann auch selbst vertrieb, wird sein filmisches Alter Ego, der geniale Maler Verkooren, von einem skrupellosen Kunsthändler ausgenutzt, der sich das Künstlergenie mithilfe einer absichtlich herbeigeführten Drogenabhängigkeit gefügig gemacht hat.
Solche Rollenzuweisungen sagen wahrscheinlich sehr viel über die in unserer Gesellschaft in Bezug auf Kunst gehegten Mythen aus. Das System der Kunst wird hier aufgeteilt in eine hehre Sphäre, in welcher selbstlose und idealistische Kreative nur für ihre Arbeit leben und daher keine verbrecherischen und geldgierigen Absichten haben können und dürfen. Dem stehen die allzu irdischen Niederungen des Kunstmarkts gegenüber, der von bösen Händlern bevölkert wird, welche sich die nur für ihre hehren Ideale lebenden Künstler gefügig machen und sie ausnutzen.
Interessanterweise scheint eine solche Trennung im japanischen Kulturkreis weniger notwendig zu sein. In der 1951 veröffentlichten Erzählung Das Leben eines Fälschers (Aru Gi-sakka no Shogai) lässt der japanische Schriftsteller Yasushi Inoue (1907–1991) den Ich-Erzähler nach und nach das Leben und Werk eines Fälschers rekonstruieren, der nicht nur aus freien Stücken fälscht, sondern seine Fälschungen auch selbst verkauft. Inoue schildert, wie die Fälschung den Schöpfer des Originals und den Urheber der Fälschung in gewisser Weise miteinander verbindet. So wird an einer Stelle der Erzählung für den Urheber der Fälschung ein Name gefunden, der die Namen des Originalkünstlers und des Fälschers miteinander verschmilzt. Am Ende des Textes kommt der Ich-Erzähler zu dem Schluss, dass es eigentlich egal sei, ob es sich bei den fernab der Zivilisation in einem Bergdorf aufbewahrten Fälschungen um Originale oder Fälschungen handelt, da der Name des Künstlers ohnehin irgendwann vergessen sei und dann nur noch das Werk bleibe. Auch Fälschungen wird hier als Werken, welche die Zeiten überdauern, ein Wert beigemessen, wenngleich dafür offenbar der sonst übliche Rahmen für die Betrachtung von Kunstwerken in Museen und Sammlungen aufgehoben sein muss – wie im Fall der fernab in dem Bergdorf aufbewahrten Malereien.
Dennoch wird die Fälschung auch von Inoue negativ bewertet, und das Leben des Fälschers, in Anbetracht seiner Aktivitäten, als ein Scheitern, ein Abstieg und letzten Endes als eine Tragödie beschrieben. Dass unter bestimmten Bedingungen vielleicht kein Unterschied darin besteht, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt, ist eine Sichtweise, zu der der Ich-Erzähler, der über den Maler wie über seinen Fälscher recherchiert, erst auf der letzten Seite findet. Sicherlich ist Inoue als Schriftsteller ein durchaus spezieller Fall, da er auch in anderen Texten Helden präsentiert, die man in Japan üblicherweise als befremdlich empfinden würde. Insofern stellt er also sicherlich keine für die dortige Kultur repräsentative Norm dar. Dennoch scheint es, als habe die ostasiatische Kunsttradition ein komplexeres Verhältnis zu Begriffen und Phänomenen wie Original, Kopie, Fälschung sowie deren facettenreichen Mischformen begünstigt. Das mag daran liegen, dass in dieser Kultur ein stärkeres Gewicht auf die Adaption und Aneignung altehrwürdiger, zum Teil gar nicht mehr vorhandener Vorbilder gelegt wurde als auf die Eigenschöpfung.
Die in der westlichen Literatur immer wieder anzutreffende rigide Trennung von Künstler und Kunstmarkt erklärt vielleicht auch die allgemeine Reaktion amüsierten Schocks, mit welchem der Fall Beltracchi aufgenommen wurde, bei dem unleugbar war, dass der Künstler selbst als Drahtzieher agiert hatte. Geradezu aufatmend nahm man die Hippie-Vergangenheit Beltracchis und seine Aussagen zur Kenntnis, dass er eigentlich immer nur dann als Maler aktiv geworden sei, wenn er wieder Geld gebraucht habe. Beide Aspekte ließen sich dazu instrumentalisieren, das tradierte Bild vom hehren Künstler zu wahren. Zum einen scheint Beltracchi als Hippie und damit Außenseiter der Gesellschaft, der einfach nur gut leben möchte und eigentlich keine bösen und kriminellen Absichten hegt, gewissermaßen „entschuldigt“. Zum anderen, so die Wahrnehmung, ist Beltracchi im Grunde genommen kein „echter“ Künstler, da er ja immer nur malerisch tätig wurde, wenn er gerade wieder Geld brauchte. Nicht zuletzt gab Beltracchi der Trennung in „guten“ Künstler und „bösen“ Kunstmarkt selbst immer wieder Nahrung, indem er wiederholt darauf hinwies, dass letztlich er selbst vom bösen und gierigen Kunsthandel betrogen worden sei. Dieser habe ihm schließlich nur einen Bruchteil dessen bezahlt, was mit seinen Fälschungen erlöst worden sei.