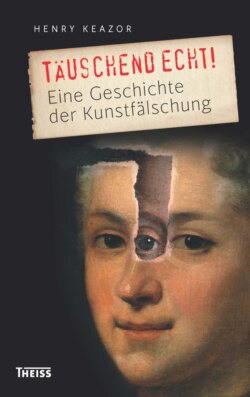Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 9
Der Piltdown-Hoax
ОглавлениеVon geschickt konzipierten und platzierten Fälschungen ist jedoch immer wieder eine Faszination ausgegangen, die zur Folge hatte, dass die Bereitschaft, an die Echtheit der Fälschung zu glauben, größer war als die Beweiskraft des Zweifel weckenden empirischen Materials. Dies soll hier an einem historischen Beispiel verdeutlicht werden, das – ausnahmsweise – nicht der Kunstgeschichte, sondern der Archäologie entnommen ist. Obwohl oder vielleicht sogar gerade, weil es sich in einer anderen, gleichwohl ebenfalls historisch ausgerichteten und mit konkreten Objekten und Artefakten arbeitenden Disziplin abgespielt hat, ist es gut dazu geeignet, Verlauf und Dynamik eines Fälschungsvorganges mit allen damit verbundenen Interessen und Motivationen zu illustrieren.
Im Dezember 1912 stellten Arthur Smith Woodward, der Konservator der Geologischen Abteilung des British Museums in London, und Charles Dawson, ein sich für Geologie und Altertumskunde begeisternder Rechtsanwalt, auf einer Versammlung der Geologischen Gesellschaft von London einen Fund vor, der spektakulär schien: 1908 war Dawson ein Fragment gezeigt worden, das ein Arbeiter beim Abbau einer Kiesgrube im englischen Piltdown (Sussex) entdeckt hatte und das Dawson als fossiliertes linkes Scheitelbein eines menschlichen Schädels identifizierte. Obgleich er nach diesem ersten Fund sofort nach weiteren Objekten an der Fundstelle suchte, fand er nichts. Erst 1911 entdeckte er ein weiteres Stück des Schädels, zusammen mit Zähnen und Knochen eines Nilpferds. Im Juni 1912 organisierte Dawson ein Picknick in der Kiesgrube von Piltdown, zu dem er auch Woodward und den Jesuitenpater und Paläontologen Teilhard de Chardin einlud. Bei diesem Aufenthalt entdeckten sie ein weiteres Stück des Schädels und den Backenzahn eines Elefanten. Die eigentlich spektakuläre und die Serie dieser Funde krönende Entdeckung machten Dawson und Woodward jedoch erst Ende Juni 1912, als sie auf den Kiefer des Schädels stießen, der zwar wie der eines Affen aussah, aber Zähne trug, die bereits wie Menschenzähne aussahen: Der menschliche Schädel und das Stück des Unterkiefers schienen das lange ersehnte fehlende Beweisstück in der Entwicklung vom Affen zum Menschen zu sein, wie sie Charles Darwin hypothetisch postuliert hatte. Wegen des bereits stärker entwickelten Gehirns wies der Fund, anders als bei Affen, bereits eine größere Schädeldecke auf, zeigte jedoch zugleich noch einen affengemäßen Kiefer. Damit schien auch gegenüber den bis dahin anderslautenden Rekonstruktionen die Dominanz des Gehirns über den sonstigen Körper bewiesen: Der Entdeckung zufolge hatte sich zuerst das größere Gehirn ausgebildet und erst daran hatte sich anscheinend die menschliche „Veredelung“ des restlichen Körpers angeschlossen. Just in England, der Wiege der Evolutionstheorie, ließ sich nun also der Übergang vom Affen zum Menschen dokumentieren, wo doch bis dahin in diesem Land kaum relevante Fossilien gefunden worden waren. Um die verschiedenen Schädelteile herum hatte man stets weitere Objekte gefunden wie Nilpferdzähne, Hörner verschiedener ausgestorbener Säugetierarten sowie primitive Geräte und roh behauene, als Eolithe bekannte Kieselsteine. Sie belegten ganz offensichtlich die Intelligenz des Wesens, da derartig bearbeitete Gegenstände bei Affen unbekannt waren. Woodward gab dem die Frühzeit der Menschheit dokumentierenden Wesen den Namen „Eoanthropus dawsoni“ („Mensch der Morgendämmerung von Dawson“). Misslicherweise fehlten dem Schädel jedoch Kinn und Kiefergelenk, sodass die Zusammengehörigkeit von Schädel und Kiefer nicht zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Genau diesen Schwachpunkt thematisierten auch einige Zweifler, als Woodward am 18. Dezember 1912 der Öffentlichkeit ein Gipsmodell des Schädels des sogenannten „Menschen von Piltdown“ vorstellte. Sie lehnten ihn als Fantasieprodukt ab, da ihnen zufolge Schädel und Kiefer nichts miteinander zu tun hatten und nur zufällig an derselben Stelle gefunden worden waren. Als Teilhard de Chardin jedoch am 30. August 1913 am selben Ort den unteren Eckzahn eines Affen fand, der ebenfalls menschliche Merkmale aufwies, und als Dawson zwei Jahre später weitere Bruchstücke der Schädeldecke eines zweiten Exemplars des „Menschen von Piltdown“ entdeckte, gaben sich auch die letzten Skeptiker geschlagen. Woodward wurde geadelt, dem 1916 verstorbenen Dawson 1938 in Piltdown ein Monument errichtet, das 1950 sogar zum Nationaldenkmal erklärt wurde – kurz darauf wurde das Ganze als Betrug aufgedeckt.
Erste Zweifel waren dem Geologen des British Museums, Kenneth Oakley, gekommen, als er 1949 feststellte, dass die Funde von Piltdown angesichts der geologischen Schicht, in der sie gefunden worden waren, unmöglich das von ihren Entdeckern geschätzte Alter haben konnten. Er untersuchte die Schädelteile mithilfe der Fluormethode (einem Verfahren zur Bestimmung des relativen Alters fossiler Knochen und Zähne) und stellte fest, dass diese nicht 500.000 Jahre, sondern lediglich 50.000 Jahre alt waren. Sie stammten also aus der Zeit des Neandertalers, woraus sich weitere Ungereimtheiten ergaben: Wie war es möglich, dass der Piltdown-Mensch offenbar gleichzeitig mit dem Neandertaler gelebt hatte, im Unterschied zu diesem aber noch einen Affen-Kiefer aufwies? Und wie konnten die viel älteren fossilen Teile von Tieren vom selben Fundort stammen wie die viel jüngeren humanoiden Reste? Eine eingehendere Untersuchung des Kiefers ergab, dass dieser aus einer Zeit nicht vor dem Mittelalter stammte und offenbar einem weiblichen Orang-Utan und keinesfalls einem Menschen gehört hatte. Auch die Zähne erwiesen sich nicht als menschlich, sondern waren lediglich so zurechtgefeilt worden, dass sie menschliche Merkmale vortäuschten. Das Kiefergelenk schließlich war absichtlich abgebrochen worden, um zu vertuschen, dass es gar nicht zum Schädel passte. Die Säugetierfossilien hingegen stammten aus dem Mittelmeerraum, genauer aus Malta und Tunesien, ebenso wie einzelne Kieselsteine, die ebenfalls importiert worden sein mussten, da sie Muschelfossilien enthielten, die sonst nur in einer Stadt im Landesinneren Tunesiens nachweisbar sind. Sämtliche ergänzende Funde stammten mithin nicht einmal aus England.
Am 21. November 1953 meldete die Zeitung The Times, dass es sich bei dem „Menschen von Piltdown“ um eine Fälschung handle, was eine Art nationaler Trauer auslöste. Die Frage, wer hinter der Fälschung stand, ist bis heute nicht geklärt – von Dawson, der früher schon einmal als Fälscher überführt worden war, über den Jesuitenpater Teilhard de Chardin, der möglicherweise aus religiösen Gründen daran interessiert war, die Theorie des fehlenden Gliedes in der Evolutionstheorie lächerlich zu machen, bis hin zu einem Kurator des Britischen Naturkundemuseums, der Woodward möglicherweise diskreditieren wollte, hätte fast jeder der maßgeblich Beteiligten ein Motiv gehabt. Schließlich ist es auch möglich, dass es sich bei dem ganzen Unterfangen ursprünglich um einen von Dawson aus Rache an den englischen Experten geplanten Hoax handelte, der ihm dann jedoch völlig außer Kontrolle geriet.
Am Fall des „Menschen von Piltdown“ lässt sich vieles beobachten, das typisch für Fälschungen auch im Bereich der Kunst ist, angefangen von den Motivationen über die Dynamik und die Rezeption bis hin zur Entlarvung der Fälschung:
Schon die Konzeption und Präsentation der Fälschung war bezeichnend. Dahinter stand zum einen die naive Annahme, dass sich der Fund des fehlenden Gliedes in der menschlichen Evolutionskette natürlich in demjenigen Land ereignen müsse, das die Wiege der Evolutionstheorie ist, nämlich England. Zum anderen wurde auf die Unzufriedenheit mit der Tatsache gerechnet, dass ausgerechnet in diesem Land bis dahin keine bedeutenden Fossilien gefunden worden waren, während Frankreich seinen Cro-Magnon-Menschen und Deutschland seinen noch älteren Neandertaler hatten. So erklärt sich auch die nationale Trauer bei der Aufdeckung des Betrugs. Die Funde hatten wie eine Befreiung von dieser Demütigung gewirkt, was wohl wesentlich dazu beitrug, dass man über Jahrzehnte hinweg unfähig und nicht willens war, die Fälschung als solche zu erkennen. Im Rückblick fallen jedoch Eigentümlichkeiten auf, die auf die offensichtliche Angst der Fälscher vor eventuellen Zweiflern schließen lassen. Einzelne Elemente der Piltdown-Fälschung nahmen nämlich geradezu ängstlich die Erwartungen der späteren Finder und Experten voraus und versuchten, diese auf geradezu perfekte Weise zu erfüllen. So erweisen sich die um die Schädelteile herum platzierten Tierfossilien und Werkzeuge im Nachhinein geradezu als kleine, etwas zu vollkommen geratene Stillleben: Zum Zeichen der Intelligenz des Piltdown-Wesens wurden auch gleich die von ihm hergestellten und verwendeten Werkzeuge mitgeliefert. Dem entsprechen im Bereich der Kunstfälschungen häufig auffällige Signaturen oder demonstrative Verweise auf die angeblichen Stationen der Fälschungen in bedeutenden Sammlungen (vgl. Kapitel 7) oder auf bekannte biografische Stationen des gefälschten Künstlers. So tauchte im Jahr 2010 beispielsweise in Italien ein Vincent van Gogh zugeschriebenes Gemälde mit dem Titel Fienile Protestante (Protestantischer Heuschober) auf, das im Folgejahr angeblich technisch untersucht und für echt befunden wurde. 2012 wurde es der niederländischen Botschaft in Florenz von einem italienischen Künstler namens Massimo Mascii als ein Werk aus einer „belgischen Privatsammlung“ vorgestellt und zugleich der Plan zu einer Ausstellung, die das Gemälde zum Zentrum haben sollte, unterbreitet. Mascii lag angeblich ein Brief des Van Gogh-Museums in Amsterdam vor, der die Echtheit des Bildes bezeugte; er sollte sich jedoch in den entscheidenden Partien, in denen das Museum die Authentizität bestreitet, als zensiert erweisen. Als zusätzlichen unleugbaren Beweis für die Echtheit verwies Mascii auf ein an dem Bild angeblich inzwischen entdecktes rotes Haar, das er als dem Maler gehörig interpretierte. Hinzu kamen Blutspuren, die mit einem Mal an dem Gemälde entdeckt wurden und belegen sollten, dass es sich bei dem Fienile Protestante um das letzte Werk van Goghs handelt, an dem er arbeitete, ehe er an den Folgen der sich selbst zugefügten Schusswunde am 29. Juli 1890 verstarb. Diesen plötzlich zutage tretenden materiellen Befunden fällt ganz offensichtlich die Aufgabe zu, genau in den Punkten Überzeugungsarbeit zu leisten, in denen das weder zu van Goghs allgemeinem noch zu seinem Spätstil passende Gemälde höchst verdächtig erscheint.
Für den Bereich der Kunstfälschungen ist ebenso die Dramaturgie der zur Entlarvung des Piltdown-Menschen führenden Schritte typisch – auf Zweifel angesichts von Ungereimtheiten folgen technische Untersuchungen. Auch hat man es in der Geschichte der Kunstfälschungen mit denselben Beweggründen zu tun, die für den Piltdown-Hoax rekonstruiert wurden (vgl. den Fall Beltracchi, Kapitel 7): Angefangen bei „ideellen“ Motiven wie dem, ein vermeintlich noch nicht entdecktes oder identifiziertes Objekt zu fälschen, um eine Überlieferungsund Forschungslücke zu schließen, über Ruhmsucht (Dawson) und Gewinnstreben – Woodwards Assistent Frank O. Barlow verdiente an den Gipsmodellen des Piltdown-Menschen –, bis hin zu der Absicht, Experten bloßzustellen (Teilhard de Chardin).