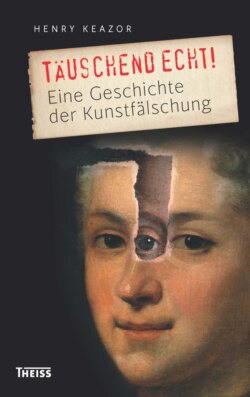Читать книгу Täuschend echt! - Henry Keazor - Страница 17
Die Hintergründe einer Fälschung
ОглавлениеAngesichts solcher Zweifel wundert es nicht, dass schon bald Gerüchte zirkulierten, bei der Tiara handle es sich um eine moderne Arbeit des 19. Jahrhunderts, und bald auch die ersten Namen möglicher Urheber gehandelt wurden. Am 21. März 1903 veröffentlichte der Figaro einen Artikel, in dem die Aussage eines Pariser Künstlers und Fälschers namens „Elina Mayence“ referiert wurde, der erklärt haben soll, er sei der Schöpfer der Tiara. Möglicherweise war mit dieser Veröffentlichung nur eine Provokation beabsichtigt, mit der man den wahren Schöpfer der Tiara aus seiner Deckung locken wollte. Falls dem so gewesen sein sollte, ging der damit verfolgte Plan auf, denn nur zwei Tage später, am 23. März 1903, veröffentlichte die Zeitung Le Matin die Gegendarstellung eines russischen, in Paris lebenden Juweliers, der behauptete, er sei bei der Herstellung der Tiara durch seinen Freund Rouchomovsky in Russland seinerzeit dabei gewesen. Und tatsächlich meldete sich weitere zwei Tage später der besagte, aus Odessa stammende, jüdische Goldschmied Israel Dov-Ber-Rouchomovsky (1860–1934) selbst. Er gab zu Protokoll, erst zu diesem Zeitpunkt von dem spektakulären Ankauf der Tiara durch den Louvre erfahren zu haben, und bekannte sich zu seiner Autorschaft. Rouchomovsky erhielt Reisemittel vom Direktorium des Louvre, um von Odessa nach Paris zu reisen, wo man ihm bei seiner Ankunft am 5. April 1903 einen triumphalen Empfang bereitete, obgleich er eigens unter einem Pseudonym angereist war, um nicht erkannt zu werden. Tatsächlich hatte man ihn nach Paris kommen lassen, um ihn ausgiebig befragen und so prüfen zu können, ob er wirklich der Urheber der Tiara sein konnte. Vor einem speziell zusammengestellten parlamentarischen Komitee musste Rouchomovsky Rede und Antwort stehen, aber selbst, als er über Details der Herstellung Auskunft gab, die nur der Hersteller kennen konnte, etwa Angaben zur Goldlegierung, schenkten ihm noch nicht alle Gutachter Glauben. Erst, als er aus dem Gedächtnis mit einem Stück Goldblech und Werkzeugen innerhalb weniger Stunden ein beliebiges Fragment der Krone vor den Augen der Experten zu reproduzieren vermochte, überzeugte er auch noch die letzten Zweifler (eine Konstellation, wie sie sich 42 Jahre später in den Niederlanden im Fall der gefälschten Vermeer-Gemälde Han van Meegerens wiederholen sollte, wo man dem Geständnis des Fälschers zunächst auch nicht glauben wollte – vgl. Kapitel 6). Rouchomovosky legte auch die Hintergründe der „Entdeckung“ der Tiara dar. Diese war von zwei Brüdern, den rumänischen Kunsthändlern Schapschelle und L. Hochmann (auch transkibiert als Gokhmann bzw. Gauchmann) bei ihm bestellt worden, angeblich als Geschenk für ein an Archäologie interessiertes Familienmitglied oder einen Freund, einen „berühmten Professor“. Sie stellten Rouchomovosky, an den sie sich gewendet hatten, da er als brillanter Kunsthandwerker galt, entsprechendes Material wie originale skythische Schmuckobjekte, Zeichnungen und Bücher zur Verfügung, auf deren Grundlage er die Tiara entwerfen und herstellen konnte. Die Publikationen, nach denen der Goldschmied sodann arbeitete, betrafen jedoch nicht nur skythische Funde, sondern auch die Kunst späterer Zeiten und anderer Regionen, weshalb es zu Irrtümern wie den Rückgriff auf die spätrömische Silberschüssel aus der Rhône-Region oder die apulische Vasenmalerei kommen konnte. Hatte man diese erst einmal als konkretes Modell erkannt, so ließ sich sogar das Variationsverfahren rekonstruieren, mit dessen Hilfe aus den zwei Pferden der Vorlage vier Pferde auf der Tiara gemacht worden waren.
Nach der Fertigstellung der Krone, für die Rouchomovosky mit 4000 Francs entlohnt worden war, behaupteten die Hochmanns, die Tiara sei bei der Ausgrabung eines Kurganes, eines Zarengrabhügels, an der Schwarzmeerküste auf der Krim gefunden worden. Im Nachhinein zeigte sich nun, dass sie zuvor schon andernorts Versuche unternommen hatten, das Objekt zu verkaufen, so auch in Wien, wo man jedoch den notwendigen hohen Betrag zum Ankauf des Objekts nicht zusammenbekommen hatte. Daraufhin hatten die Hochmanns zwei Agenten nach Paris geschickt, die die Tiara am 13. März 1896 den Louvre-Kuratoren zeigten, wobei die beiden Brüder ihre eigene Abwesenheit damit begründeten, dass sie angeblich auf dem Weg nach London seien, um den Verkauf der Tiara an das dortige British Museum in die Wege zu leiten. Angesichts des damit ausgeübten Zeitdrucks, ließen sich der Direktor des Louvre Albert Kaempfen, der dortige Kurator für die Antiken Antoine Héron de Villefosse sowie der Archäologe Salomon Reinach schnell davon überzeugen, dass die Tiara original sei und veranlassten ihren Ankauf – entgegen aller Bedenken, die es damals durchaus schon gab: Der russische Archäologe und Skythen-Experte Nikolaj Ivanovič Veselovskij wies schon im Mai 1896 auf die von ihm beobachteten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Herkunft der Figuren und Stilmerkmale aus verschiedenen Kulturen und Zeiten hin und beurteilte die Krone daher als Fälschung. Der deutsche Archäologe Rudolf Furtwängler gab ihm noch im gleichen Jahr recht, sprach von einem „abscheulichen Betrug“ und ergänzte Veselovskijs Hinweise noch durch die Beobachtung, dass die an sich fragile Tiara erstaunlicherweise vollkommen intakt, ohne jede Delle oder sonstige, eigentlich zu erwartende Beschädigung gefunden worden sei. In dem darauf ausbrechenden Streit zwischen den sogenannten „Saitapharnisten“ und „Anti-Tiaristen“ wurde seitens der Echtheits-Befürworter auf die in den unteren Rändern der Tiara entdeckten oxidierten Bronzestifte hingewiesen, die tatsächlich alt waren. Nichtsdestotrotz entfernte man das umstrittene Objekt zunächst aus der Museumsvitrine, wohin es dann auch nicht mehr zurückkehrte, nachdem 1903 offiziell bekannt gegeben wurde, dass es sich um eine Fälschung handle.
Einer der Gründe, die Rouchomovosky dazu bewogen hatten, sich zu Wort zu melden, bestand darin, dass er sich von den Hochmann-Brüdern betrogen fühlte. Diese hatten ihm mit den 4000 Francs nur einen Bruchteil dessen gezahlt, was sie dann anschließend selbst mit der Tiara verdient hatten. Dieselbe Begründung für die Aufdeckung einer Fälschung lieferte 24 Jahre später auch der italienische Bildhauer Alceo Dossena, der ebenfalls an die Öffentlichkeit ging, da er sich um den ihm zustehenden Verdienst geprellt sah (vgl. Kapitel 3). Wie nach ihm Dossena, verwahrte sich Rouchomovosky gegen den Vorwurf, ein Fälscher zu sein, da er die Tiara nicht als Fälschung und in Täuschungsabsicht, sondern als Nachbildung, sozusagen als „Nachempfindende Schöpfung“ und „Stilaneignung“ hergestellt habe.
Wie später Dossena, genoss auch Rouchomovosky die Berühmtheit, die er mit und nach der Aufdeckung des Betrugs erlangte. Seine Werke erregten große Aufmerksamkeit, er wurde mit Auszeichnungen versehen und konnte angesichts des ihm nun zur Verfügung stehenden Geldes seine Familie nach Paris nachkommen lassen. Einzig die Realisierung des Projektes eines amerikanischen Impresarios, die Tiara und ihren Schöpfer auf eine Welttournee zu schicken, scheiterte – unter anderem am Widerstand des Louvre. Dieser hatte die Tiara nach ihrer Enttarnung erst in das Depot verbannt, sie dann vorübergehend im Pariser Musée des Arts decoratifs als Nachbildung zeigen lassen, dann wieder ins Depot verbracht und erst 1997 anlässlich einer Ausstellung in Jerusalem wieder öffentlich präsentieren lassen, als im dortigen Israel Museum eine Retrospektive der Werke Rouchomovoskys gezeigt wurde, da dieser jüdischer Herkunft war. Seit ihrer Rückkehr in den Louvre wird die Tiara im Depot verwahrt, nur gelegentlich zu Ausstellungen verliehen und kann von Kunsthistorikern nur auf Anfrage besichtigt werden.
Rückblickend erscheint an dem Fall bemerkenswert, dass für den Erfolg der Fälschung wohl gerade die Kühnheit maßgeblich gewesen ist, mit der man hier recht naiv zu Werk gegangen war: Rouchomovsky war zwar handwerklich äußerst geschickt, aber archäologisch vollkommen ungeschult, weshalb er unkritisch den Vorlagen der ihm zur Verfügung gestellten Handbücher folgte. Gerade dies scheint jedoch die Experten heraus- und überfordert zu haben, die sich offenbar nicht vorstellen konnten, dass jemand derart plump verfahren würde. Von den zu beobachtenden Parallelen verblüfft, suchten sie nach Denkmodellen, um diese zu erklären, anstatt die auffälligen Entsprechungen als Argumente für eine Fälschung anzusehen. Als Salomon Reinachs Bruder Théodore den Versuch unternahm, Furtwänglers Einwände spöttisch zu entkräften, indem er das mit dessen Kritik suggerierte intellektuelle Profil des Fälschers umriss, kam er der Wahrheit ungewollt erstaunlich nahe: „Ein ungewöhnlicher Mann: raffiniert und dumm, gebildet und unwissend, ein plumper Plagiator und ungestümer Erfinder. Kurzum: Eine Mischung gegensätzlicher Stärken und Schwächen, die nicht auf eine einzige Person hinauslaufen, sondern vielmehr auf ein ganzes Komitee von Professoren, Künstlern, Scharlatanen und Betrügern […].“