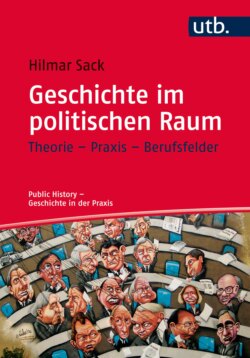Читать книгу Geschichte im politischen Raum - Hilmar Sack - Страница 12
3.1 Das Ende der NS-Zeitzeugenschaft
ОглавлениеGeschichtsschreibung stützt sich auch auf Selbstzeugnisse von Menschen, dazu gehören Tagebücher, Briefe, Memoiren, Gerichtsaussagen und andere mehr. Die Aussagen des ZeitzeugenZeitzeuge unterscheiden sich von diesen historischen Quellen grundlegend, da sie nicht aus der Zeit stammen, sondern erst später verfasst werden. Der Begriff Zeitzeuge hat seine Ursprünge in den 1970er Jahren. Er ist eng mit der Oral history (→ Glossar) verknüpft (siehe Sabrow 2012). Sein Aufstieg hat vor allem mit der veränderten medialen Vermittlung von Geschichte zu tun, vor allem im Fernsehen, wo der Authentizität versprechende Zeitzeuge längst den geschichtliche Sachverhalte beglaubigenden Historiker ergänzt, wenn nicht sogar verdrängt hat.
Mit dem ZeitzeugenZeitzeuge rückt gegenüber schriftlichen Selbstzeugnissen das Interview ins Zentrum, das sich durch die körperliche Präsenz des Erzählers auszeichnet. Martin SabrowSabrow, Martin (2012, 13) beschreibt den erzählenden Zeitzeugen bildlich als Wanderer zwischen der Welt der Vergangenheit und der Gegenwart und definiert ihn in Abgrenzung zum Tat- oder Augenzeugen: „Der Zeitzeuge […] beglaubigt nicht so sehr außerhalb seiner selbst liegende Geschehnisse, wie dies der klassische Tat- und Augenzeuge tut; er konstituiert vielmehr durch seine Erzählung eine eigene Geschehniswelt.“ Er bestätige weniger durch sein Wissen fragliche Einzelheiten eines sich häufig ohne sein Zutun abspielenden Vorgangs, sondern dokumentiere durch seine Person eine raumzeitliche Gesamtsituation der Vergangenheit: Er „autorisiert eine bestimmte Sicht auf die Vergangenheit von innen als Träger von Erfahrung und nicht von außen als wahrnehmender Beobachter.“
Der Bedeutungsgewinn des ZeitzeugenZeitzeuge ist untrennbar mit der AufarbeitungVergangenheitsbewältigung der nationalsozialistischenNationalsozialismus Vergangenheit verbunden. Anfänglich diente er einer ‚Gegengeschichte‘ von unten: gegen die Fixierung auf die Täter durch die Übermacht ihrer schriftlichen Überlieferung in Form von Akten, gegen abstrakt-theoretische Erklärungen, gegen Distanzierungsbestrebungen, wie sie der Begriff ‚VergangenheitsbewältigungAufarbeitung‘ (→ Kapitel 6.1) suggeriert. Diese ursprünglich kritische Funktion büßte der Zeitzeuge jedoch in seinem medialen Siegeszug zugunsten seiner heute vorrangig bekräftigenden, meist nur illustrierenden Rolle ein (Sabrow 2012, 21). Die Geschichtswissenschaft begegnet dem Zeitzeugen dementsprechend mit Vorbehalten. Er gilt gemeinhin als ihr größter Feind (siehe Plato 2000). Die Kritik, die hier nur ansatzweise skizziert wird, baut auf der trügerischen persönlichen Erinnerung, auf der Subjektivität im Erleben historischer Ereignisse und Prozesse, die nicht selten in Konflikt mit anderen überlieferten Zeugnissen gerät. Der Informationsgehalt der Zeitzeugenaussage gilt dem kritischen Historiker als überschätzt, da er selten über den anderer Quellen hinausgehe. Dafür reproduziere der Zeitzeuge aber gern verbreitete Stereotype. Dem Historiker komme deshalb die Aufgabe zu, die Zeitzeugenaussagen zu prüfen, abzugleichen, zu kontextualisieren und so in ihrer Bedeutung zu gewichten. In einem medialen Umfeld aber, das den Zeitzeugen weitgehend unhinterfragt zur zentralen Beglaubigungsinstanz erhoben hat, gewinnt der Zeitzeuge aus Sicht seiner Kritiker eine problematische Dominanz. Die emotionalisierende Suggestionskraft der Zeitzeugenschilderung unterlaufe die wissenschaftlichen Prämissen des auf Aufklärung bedachten Historikers – und macht den Zeitzeugen gerade deshalb so attraktiv für eine Geschichtsaufbereitung, die weniger einem sachlich-nüchternen Erkenntnisanspruch folgt als vielmehr in einer breiten Öffentlichkeit den emphatischen Geschichtszugang sucht.
Insbesondere die gemeinhin dem ZeitzeugenZeitzeuge zugesprochene Authentizität (→ Glossar), das heißt sein angenommener „Wirklichkeitsvorsprung gegenüber anderen Erzähltypen“ (Welzer 2012, 33), erregt den Widerspruch der Historiker. Sie betonen seinen Charakter als Kunstfigur, der eine Vermittlerrolle zwischen Vergangenheit und Gegenwart ausübe. Der Zeitzeuge verspreche zwar den unmittelbaren Zugang zur Vergangenheit, der perspektivische Fluchtpunkt der erinnernden Erzählung liege aber in der Gegenwart (ebd.). In Wirklichkeit passe der Zeitzeuge seine Erinnerung den Wertmaßstäben der Gegenwart an. Das unterscheide ihn vom Mitlebenden bzw. Zeitgenossen. Ein Erzähler, der den Geist der Zeit, von der er zeugt, willentlich oder unwillentlich in die Gegenwart transportiere, falle jedoch aus seiner Rolle. Denn die vom Rezipienten erwünschte Leistung des Zeitzeugen sei gerade die kathartische Distanzierung von der Vergangenheit. Deshalb komme im Regelfall allenfalls der geläuterte Mit-Täter zu Wort, nie aber der bekennende Nazi oder Kommunist. Denn der würde die Vergangenheit nicht in ihrer Überwundenheit und Unwiderbringlichkeit, sondern im Gegenteil in ihrer Ungebrochenheit und vorstellbaren Wiederholbarkeit beschwören (Sabrow 2012, 25ff.).
Trotz solcher Kritik: Der ZeitzeugeZeitzeuge ist das goldene Kalb, um das sich die Erinnerungsgemeinschaft versammelt. Mit dem Ableben der letzten Generation, die den NationalsozialismusNationalsozialismus noch selbst erlebt hat, zeichnet sich jedoch ein tiefgreifender Wandel ab. Damit sind tektonische Verschiebungen in den Grundpfeilern der ErinnerungskulturErinnerungskultur verbunden. Der Hinweis auf das nahende Ende der NS-Zeitzeugenschaft gehört längst zum festen Grundbestand jeder Gedenkrede. Von geschichtspolitischer Brisanz ist, dass natürlich nicht die Zeitzeugenschaft an sich endet, sondern nur das lebendige Zeugnis von NS-Diktatur, Krieg und Holocaust, das bislang alle vorangegangenen und späteren Epochen dominierte. Wenn also, was unter den Bedingungen der modernen Mediengesellschaft anzunehmen ist, dem Zeitzeugen ungebrochen die herausragende Bedeutung in der Vermittlung von Geschichte wie bisher zukommen wird, dann werden sich zwangsläufig Epochen der Zeitgeschichte verstärkt in den Fokus schieben, die bislang weniger Aufmerksamkeit gefunden haben. Denn mit noch lebenden Zeitzeugen verfügen sie über ein größeres mediales Darstellungspotential als die Vergangenheit, die mit dem Ende der Generation von Mitlebenden ins Stadium ‚toter‘ Geschichte übergegangen ist. Mit dem Schwinden der Zeitzeugen geht natürlich nicht zwangsläufig die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu Ende, mit Blick auf den kategorischen Erinnerungsimperativ ist das in Deutschland auch nicht zu erwarten; es geht aber die unmittelbare Präsenz der Erfahrung der Überlebenden verloren, „die auf einzigartige Weise zu berühren vermag und Lernprozesse in Gang setzen kann“ (Knigge 2005). Anders ausgedrückt: Es beginnt das Stadium der Historisierung. Die Geschichtsschreibung wird zwar auch weiterhin über einen gigantischen Pool an Zeitzeugenstimmen in Schrift, Ton und Bild verfügen, und zahlreiche Initiativen widmen sich derzeit bereits der Aufgabe, möglichst viele dieser Interview-Zeugnisse zu sammeln, um sie zukünftigen Generationen bereitzustellen (etwa die Shoah-Foundation von Steven SpielbergSpielberg, Steven oder das deutsche Projekt „GedächtnisGedächtnis der Nation“ mit seinem Jahrhundertbus). Moderne technische Mittel sollen den NS-Zeitzeugen auf diese Weise virtuell in die Nachwelt retten. Nicht nur Totgesagte, sondern Tote leben länger, ironisiert Christoph ClassenClassen, Christoph (2012, 302) das Vorgehen. Doch die ‚Konserve‘ ist von grundlegend anderer Qualität, denn der Zeitzeuge könne die „Imagination der unmittelbaren Begegnung mit der Vergangenheit“ nur so lange verbürgen wie er selbst der Gegenwart angehöre. Sein Zeugnis verliere für die Geschichtsvermittlung an Relevanz, wenn das Band der Generationen gerissen sei (Sabrow 2012, 25f.).
Wenn die AufarbeitungVergangenheitsbewältigung von NationalsozialismusNationalsozialismus, Krieg und ShoahHolocaust/Shoah weiterhin das erinnerungskulturelle Fundament im Selbstverständnis der Deutschen bilden soll, woran politisch kein Zweifel gelassen wird, bedarf es besonderer Anstrengungen, um die Erinnerung auch künftig wachzuhalten. Das gilt für Darstellungen in den Medien genauso wie für Veranstaltungen, die dem offiziellen Gedenken dienen, und in denen – etwa bei den jährlichen Bundestags-Gedenkveranstaltungen zum 27. JanuarGedenktage27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus (→ Kapitel 6.4) – regelmäßig erst der Auftritt von ZeitzeugenZeitzeuge mit ihrer auratischen Präsenz die gewünschte öffentliche Aufmerksamkeit schafft. „Niemand zeugt für den Zeugen“, heißt es in dem Gedicht „Aschenglorie“ von Paul CelanCelan, Paul (1920–1970). Demgegenüber betonte der Friedensnobelpreisträger Elie WieselWiesel, Eli, dass jeder, der einem Zeugen zuhört, selbst zum Zeugen wird (Doerry 2006). Auch die Politik betont die Notwendigkeit einer solchen Generation von Zeugen der Zeugen (siehe beispielhaft die Rede des BundestagspräsidentenLammert, Norbert bei der in der Web-Mediathek des BundestagesBundestag abrufbaren zentralen Gedenkveranstaltung zum 27. Januar 2015). Die Wissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von der sekundären oder stellvertretenden Zeugenschaft, bei der den Nachgeborenen die Rolle des Berichterstatters zufällt. Schon heute beglaubigen Kinder und Enkel mit ihren Erzählungen die authentischen Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern. Einen Schritt weiter gehen Fernsehformate, die in einer Vermischung von Fakten und Fiktionen Schauspieler in die Rolle von Zeitzeugen schlüpfen lassen, wobei sich – je populärer der Darsteller und bekannter die jeweilige Rollenfigur – das Image des Schauspielers und die Aura des Zeitzeugen nicht unproblematisch wechselseitig vermischen können (siehe Gries 2012).
Das Authentizitätsbedürfnis des Menschen lässt vermuten, dass die authentischen Stätten des Verbrechens zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen werden. Das zöge kulturpolitisch die Forderung nach personeller wie materieller Stärkung der Gedenkstätten nach sich. Volkhard KniggeKnigge, Volkhard sieht als Leiter der StiftungStiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora darin die Chance zu einer grundlegenden Neujustierung unseres Umgangs mit der NS-VergangenheitNationalsozialismus: weg vom Paradigma der Erinnerung als bloß appellative, moralisch aufgeladene Pathosformel, hin zu neuen Wegen historischen Lernens, kritischer Selbstvergewisserung und der Bildung eines selbstreflexiven GeschichtsbewusstseinsGeschichtsbewusstsein (Knigge 2010). Damit würde nicht zuletzt auch ein grundsätzlicher Bedeutungsgewinn der Geschichtswissenschaft einhergehen.
Weiterführende Literatur
Baer 2000: Ulrich Baer (Hg.), „Niemand zeugt für den Zeugen“ – ErinnerungskulturErinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah (Frankfurt a.M. 2000).
Plato 2000: Alexander von Plato, ZeitzeugenZeitzeuge und die historische Zunft. Erinnerung, kommunikative Tradierung und kollektives GedächtnisGedächtniskollektives in der qualitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss. In: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 13, H. 1, 2000, 5–29.
SabrowSabrow, Martin/FreiFrei, Norbert 2012: Martin Sabrow/Norbert Frei (Hg.), Die Geburt des ZeitzeugenZeitzeuge nach 1945 (Göttingen 2012).