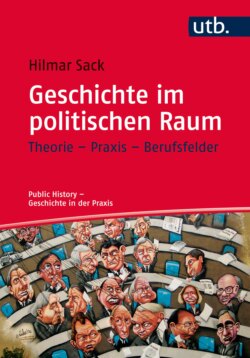Читать книгу Geschichte im politischen Raum - Hilmar Sack - Страница 4
Оглавление1 Einleitung
„Die Erinn’rung ist eine mysteriöse
Macht und bildet die Menschen um.
Wer das, was schön war, vergißt, wird böse.
Wer das, was schlimm war, vergißt, wird dumm.“
(Erich KästnerKästner, Erich, „In memoriam memoriae“)
1989 provozierte Francis FukuyamaFukuyama, Francis mit einer steilen These: Angesichts des Niedergangs des realexistierenden Sozialismus prognostizierte der amerikanische Politikwissenschaftler im Siegeszug des Liberalismus mit seinen westlichen Ordnungsmodellen Demokratie und Marktwirtschaft die Überwindung aller weltpolitischen Widersprüche, mithin das „Ende der Geschichte“ (Fukuyama 1989). Im Gegensatz dazu gab zwei Jahrzehnte später der große Liberale Lord Ralph DahrendorfDahrendorf, Ralph (1929–2009) einem Sammelband seiner seit 1989 publizierten Essays den Titel „Der Wiederbeginn der Geschichte“ (Dahrendorf 2004). Dahrendorf sah gerade im Systemgegensatz des Kalten Krieges – Ost gegen West – den Geschichtsverlauf zu einem künstlichen Stillstand gekommen und erst mit dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs den historischen Prozess wieder machtvoll neu beginnen. 1989 – Ende oder Anfang? Die revolutionären Veränderungen in Mittelost- und Osteuropa verlangten nach historischer Einordnung und inspirierten zu gänzlich unterschiedlichen Interpretationen. Vieles, was bislang gegolten hatte, galt nun nicht mehr. Solche historischen Aneignungsprozesse sind eminent politisch. Denn, um KästnersKästner, Erich Eingangsverse aufzugreifen: Was war eigentlich schön und was war schlimm? Was soll warum erinnert, was besser vergessen werden? Welche Erinnerung hilft weiter, welches VergessenVergessen macht blind und führt womöglich in die Katastrophe – und vor allem: Wer bestimmt darüber?
Geschichte und Politik sind untrennbar aufeinander bezogen, sie sind miteinander ‚verwoben‘, wie der Politikwissenschaftler Werner WeidenfeldWeidenfeld, Werner (1987, 13) formuliert: „Geschichte konstituiert Politik – und Politik konstituiert Geschichte.“ Das vorliegende Buch stellt dieses „doppelte Bezugsverhältnis“ (WolfrumWolfrum, Edgar 2010, 21) ins Zentrum. Es thematisiert damit die politische Dimension der Angewandten Geschichte/Public History – ein potentiell uferloses Thema, das Begrenzung erfordert. Deshalb bleiben die großen, politisch wirkmächtigen Interpretationen der Geschichtsphilosophie, wie etwa der Historische Materialismus, unberücksichtigt; und auch eine Einführung in die politische Ideengeschichte wird ausgespart. Es ist zudem unvermeidlich, sich in Zeit und Raum zu begrenzen: Der Fokus liegt auf der Zeitgeschichte und es wird vorrangig eine nationale, nämlich deutsche Perspektive eingenommen – allerdings um dort zeitlich auszuholen und auf andere Länder oder transnationale Prozesse zu verweisen, wo dies sinnvoll oder notwendig ist.
An mehreren deutschen Universitäten haben sich im Hinblick auf Angewandte Geschichte/Public History Studienangebote etabliert, die mit Hilfe von Theorien und Forschungsansätzen der Fachwissenschaft die Studierenden in praxisorientierter Ausbildung darauf vorbereiten, Geschichte zu vermitteln – sei es in MuseenMuseen, im Tourismus oder in den Medien. Die politische Dimension der Geschichte, also Fragen von ErinnerungskulturErinnerungskultur und GeschichtspolitikGeschichtspolitik, stehen überall auf den Lehrplänen, sie zählen zum Basiswissen der Absolventen – und sie werden folglich auch in diesem Buch thematisiert. Der politische Raum als ein eigenes Praxisfeld der Geschichtsvermittlung – und damit nicht zuletzt als ein potentielles Berufsfeld für Historiker – bleibt demgegenüber in den Curricula unterbelichtet. Dieses Lehrbuch, das sich an interessierte Studierende in Bachelor- und Master-Studiengängen richtet, soll den Grundbestand im Werkzeugkasten des künftigen Geschichtsvermittlers im politischen Raum erweitern, es dient der Praxisorientierung zwischen Fachwissenschaft und einschlägigen Berufsfeldern.
Im Zentrum stehen (kultur-)politische Handlungsbereiche, für die geschichtliche Erfahrung Bedeutung hat oder die direkt auf unsere Vorstellung von Geschichte einwirken. Wenn dabei vom ‚politischen Raum‘ gesprochen wird, dann deshalb, um den Blickwinkel nicht auf die Politik zu verengen, mit der gemeinhin der Staat und seine politischen Akteure in Regierung, Verwaltung und Parlament gemeint sind. Der politische Raum konstituiert sich vielmehr im Zusammen- und Gegenspiel einer Vielzahl von Akteuren, zu denen neben den Repräsentanten und Institutionen des Staates sowie den politischen Entscheidungsträgern unter vielen anderen auch Medien, Wissenschaft und Vertreter aus der Zivilgesellschaft gehören.