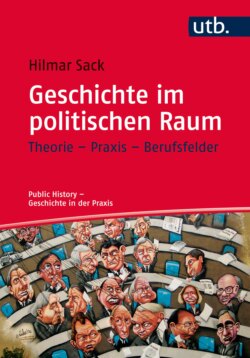Читать книгу Geschichte im politischen Raum - Hilmar Sack - Страница 6
Оглавление2 ErinnerungskulturErinnerungskultur: Leitbegriff in Wissenschaft und Gesellschaft
2.1 Von der Sehnsucht nach Geschichte in Zeiten globalen WandelsGlobalisierung
„Die Suche nach der Erinnerung hat eingesetzt“, verkündete 1982 ein Sammelband über Geschichte und demokratische Identität in Deutschland (Ruppert 1982, 9). Was damals vermeintlich erst begann, gehört heute unbestritten zu den prägenden Zeittendenzen: die Hinwendung zur Vergangenheit. Das Erinnerungspostulat ist so allgegenwärtig, dass sich kaum mehr vorstellen lässt, dies sei einmal anders gewesen. Doch tatsächlich bedurfte es dazu eines tiefgreifenden Mentalitätswandels. Zuvor hatte eher der Begriff „Geschichtslosigkeit“ (Heimpel 1957, 4) das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik bestimmt. Mit dem Zivilisationsbruch zwischen 1933 und 1945 schien die Brücke zur nationalen Vorgeschichte abgebrochen – ein Eindruck, der sich mit der Fixierung auf die nationalsozialistische Diktatur im Generationenkonflikt der 1960er Jahre und durch die intensivierte AufarbeitungVergangenheitsbewältigung dieser Epoche in der Folge zunächst noch verstärkte.
Heute sagt Paul NolteNolte, Ernst hingegen: „So viel Geschichte war selten“ (Nolte 2003, 24). Der Trend wechselte rasant von der „Geschichtsvergessenheit“ zur „Geschichtsversessenheit“ (Assmann/Frevert 1999). Erinnern wurde zu einer gesellschaftlichen Leitinstanz und „ErinnerungskulturErinnerungskultur“ (→ Glossar) avancierte zum dominierenden Begriff in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft – mit ihr weitete sich das Interesse auf andere Epochen der Geschichte, auch wenn die NS-AufarbeitungVergangenheitsbewältigung in Deutschland geschichtspolitisch stets im Mittelpunkt blieb. Numerisch lässt sich das historische Interesse, das über Wissenschaft, Feuilleton und Politik hinaus längst in der Breite der Gesellschaft anzutreffen ist, an der hohen Zahl von MuseenMuseen ablesen. Binnen weniger Jahrzehnte wuchs sie in Deutschland um ein Drittel auf heute weit über 6000. Neben zahlreichen von Vereinen getragenen kleineren Dorfmuseen und Heimatstuben ziehen Ausstellungen großer staatlicher Museen als gesellschaftliches Ereignis regelmäßig die Massen an. Daneben folgen seit den 1970er Jahren viele historisch interessierte Bürger in lokalen Geschichtswerkstätten dem Aufruf: „Grabe, wo Du stehst!“ Parallel zu diesen Formen gewissenhafter (wissenschaftlicher) AufarbeitungVergangenheitsbewältigung der Vergangenheit hat sich das ‚Histotainment‘ entwickelt, das vom aufwendig inszenierten Ritterspektakel über das Computerspiel bis zur interaktiven App fester Bestandteil der Tourismus- und Unterhaltungsindustrie geworden ist. Geschichte erweist sich obendrein als film- und fernsehtauglich, sogar als quotenstark. Auf den Bestsellerlisten erscheinen historische Romane, dazu Biographien und Memoiren. Magazine füllen regelmäßig ihre Titelgeschichten mit Serien zu historischen Ereignissen und Persönlichkeiten. Selbst vor der Wirtschaft und ihren Unternehmen macht der Trend nicht Halt: „Zukunft braucht Herkunft“ – Odo MarquardsMarquard, Odo Kurzformel zur nachhaltigen Bedeutung der Vergangenheit für Gegenwart und ZukunftZukunft (Marquard 2003) ist bis in die Etagen der Marketingabteilungen vorgedrungen. Als eingängiger ‚Claim‘ legitimiert sie hier in Abgrenzung zu klassischen Kommunikationsmaßnahmen eine populäre, spezifisch historische Ausrichtung von Werbung und Marketing.
History rules – and sells. Was hat diesen Paradigmenwechsel bewirkt? Die Forschung verweist auf mehrere Prozesse, die seit den 1970er Jahren zu einer „grundlegenden mentalitätsgeschichtlichen Wende“ geführt haben (Cornelißen 2003, 553; zum Folgenden vor allem auch SchmidSchmid, Harald 2009c, 56ff.). So sei mit der ersten großen Energie- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit der Fortschrittsglaube aus der Gründungsära verloren gegangen. Mehr noch: Neue soziale und ökologische Bewegungen, die die ‚Grenzen des Wachstums‘ und soziale Ungerechtigkeiten in einem globalen Rahmen problematisierten, hätten den planvollen Zukunftsoptimismus der Moderne grundsätzlich in Frage gestellt. An seiner Stelle seien Skepsis und Krise getreten. Überdies sei es nach den ideologischen ‚Sechzigern‘ zu einer Abkehr von politischen Utopien gekommen, habe etwa der Marxismus, nicht zuletzt angesichts der ernüchternden Erfahrung mit dem realexistierenden Sozialismus, an Strahlkraft verloren. Orientierung versprach man sich nun weniger von Ideologien und ihren ZukunftsentwürfenZukunft, sondern vom Blick zurück: von den Erfahrungen der Vergangenheit. Nach der Wende 1989/90 beschleunigte sich zudem ein in jeder Hinsicht grenzenloses Phänomen gesellschaftlichen Wandels: die GlobalisierungGlobalisierung. Rasante technische Neuerungen, insbesondere auf dem Feld der Kommunikationsmittel, ließen die Welt zum Dorf schrumpfen. Nationale Ereignisse bekommen heute globale Bedeutung, Entwicklungen in weiter Ferne nehmen unmittelbar Einfluss auf das eigene Land. Dies führt nicht nur zwangsläufig zur Universalisierung der Erinnerung an historische Ereignisse (→ Kapitel 3.2). Die Komplexität der Welterfahrung lässt in einer Gegenreaktion zugleich auch lokale und regionale Traditionen an Bedeutung gewinnen. Mit dem Fall des ‚Eisernen Vorhangs‘ und der Wiedervereinigung erfuhr zudem die Nation als identitätsstiftender Rahmen einen Bedeutungszuwachs, jedenfalls in Deutschland und in den jungen mittelost- und osteuropäischen Demokratien. Konträr zum zeitlich parallel verlaufenden europäischen Einigungsprozess wurden verschüttete nationale Traditionen neu in den Blick genommen. Und noch etwas nährte das Interesse an der Vergangenheit: Die untergegangene DDRDDR forderte nach AufarbeitungVergangenheitsbewältigung (so wie die alte Bundesrepublik nach Historisierung). Gleichzeitig vergegenwärtigten sich ehemalige DDR-Bürger in wiederkehrenden nostalgischen Schüben ihrer Alltagserfahrungen jenseits von Diktatur und Staatssicherheit – heftige politische Kontroversen darüber inbegriffen.
Der Antiquitäten- und Flohmarktboom in Deutschland, die Rekonstruktionen ganzer Bauensembles oder die politische Idee der UNESCO-WeltkulturerbesUNESCO-Weltkulturerbetätte: Sie alle sind Ausdruck von gesellschaftlichen Musealisierungsprozessen. Was liegt diesem Großtrend zugrunde? Aufschlussreich ist die Kompensationstheorie eines Kreises liberalkonservativer Denker um Joachim RitterRitter, Joachim (1903–1974), unter ihnen Hermann LübbeLübbe, Hermann und Odo MarquardMarquard, Odo (1928–2015) (siehe Hacke 2006). Die sich von Tradition und Vergangenheit entfremdende Moderne entwickelt demnach eine paradoxe Eigendynamik, indem sie selbst wieder die Beschäftigung mit der Vergangenheit produziere. Nur so seien die beschleunigten Modernisierungsprozesse, die ja erst zur Geschichtslosigkeit geführt hätten, auszuhalten (Lübbe 1982, 18). Als diagnostischer Erklärungsansatz für die dynamische Hinwendung zur Vergangenheit ist diese Theorie einleuchtend und bis heute wirkmächtig. Widerspruch löst hingegen aus, sie normativ zu begreifen. Den Geisteswissenschaften und den kulturellen Akteuren würden dann nämlich, so lautet die Kritik, nur eine gesellschaftsstabilisierende Funktion zufallen, indem sie – ökonomische und soziale Defizite ausgleichend – „Modernisierungsschäden“ (Marquard 1986, 105) kompensierten.
Infobox
UNESCO-WeltkulturerbeUNESCO-Weltkulturerbe
1972 verabschiedete die Generalkonferenz der UNESCO in Paris die „Internationale Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“. Stätten von „außergewöhnlichem universellen Wert“ stehen seitdem unter der Obhut der gesamten Menschheit. Die Unterzeichner (die Bundesrepublik trat 1976 bei) verpflichten sich dazu, diese ausgewählten Orte im eigenen Land zu pflegen und für die Nachwelt zu erhalten. In Deutschland sind heute 41 Natur- und Kulturdenkmale (Stand: Herbst 2016) auf der Welterbeliste der UNESCO verzeichnet. Das Spannungsverhältnis von moderner Stadtentwicklung und Schutz des Welterbes zeigten in der jüngeren Vergangenheit die heftigen Debatten um die Bebauung am Kölner DomKölner Dom und um die Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal.
Mit dem gesellschaftlichen Bedeutungsgewinn der Vergangenheit verband sich ein gewachsenes Bewusstsein für die Geschichte als Politikum. Wer sich politisch auf Vergangenes bezieht, strebt in der Regel nach Sinnstiftung, ihm geht es um Identität, um Bindungen und Loyalitäten – und immer auch darum, politisches Handeln zu begründen und zu legitimieren. Erinnern sei ein politisches Auseinandersetzungsfeld par excellence, vielleicht das wichtigste, sagt der Sozialpsychologe Harald WelzerWelzer, Harald, es ginge darum, wer die richtige Erinnerung definiere. Dieser Kampf werde eher schärfer, Erinnerung sei nicht auf dem Rückzug, sondern auf dem Vormarsch: „Erinnerung gilt als Wert an sich, und sie wird immer mehr zur Obsession“ (Feddersen/Reinecke 2005).
Halten wir also fest: In Zeiten des Wandels gewinnt das historische Bewusstsein als eine kulturelle Fähigkeit immens an Bedeutung. Erinnern avancierte seit den 1970er Jahren in Deutschland, und nicht nur hier, zum „neuen kategorischen Imperativ“, hat sich überall als eine „kulturelle, soziale und politische Wirklichkeit ersten Ranges durchgesetzt“ (François 2009, 23, 36). Und angesichts einer Welt im rasanten globalen Wandel ist ein Ende des ‚Erinnerungsbooms‘ nicht absehbar – vielmehr öffnen sich vielfältige Berufsperspektiven für angehende Historiker, die Freude am öffentlichen Diskurs haben und sich daran aktiv beteiligen wollen. Zu den wichtigsten Akteuren – und potentiellen Arbeitgebern – gehören der Staat mit seiner offiziellen Gedenkpolitik genauso wie die Medien und zahlreiche Initiativen und Projekte der Zivilgesellschaft – und natürlich die Wissenschaft. Mag letztere in der öffentlichen Debatte zwar in die Defensive gedrängt sein, so liefert sie ihr dennoch die grundlegenden Theorien und notwendigen Stichworte. Sie stellen ein unerlässliches Basiswissen für jeden angehenden ‚Erinnerungsarbeiter‘ dar. Um sie geht es in den folgenden Kapiteln.
Weiterführende Literatur
Cornelißen 2003: Christoph Cornelißen, Was heißt ErinnerungskulturErinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 54, 2003, 548–563.
Frevert 2003: Ute Frevert, Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit revisited. Der jüngste Erinnerungsboom in der Kritik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, H. 40–41, 2003, 6–13.
Zeitschrift für Politikwissenschaft 25. Jg. 4 (2015), Schwerpunkt: Wie wirkungsmächtig ist Geschichte in der Politik?, 559–591.
SchmidSchmid, Harald 2008: Harald Schmid, Kommodes Gedenken: die ErinnerungskulturErinnerungskultur des vereinten Deutschlands. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 53, H. 11, 2008, 91–102.
WinklerWinkler, Heinrich August 2004a: Heinrich August Winkler, Aus der Geschichte lernen? Zum Verhältnis von Historie und Politik in Deutschland nach 1945. In: Die Zeit, 25.3.2004.
WolfrumWolfrum, Edgar 2010: Edgar Wolfrum, ErinnerungskulturErinnerungskultur und GeschichtspolitikGeschichtspolitik als Forschungsfelder. Konzepte – Methoden – Themen. In: Jan Scheunemann (Hg.), Reformation und Bauernkrieg. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im geteilten Deutschland (Leipzig 2010) 13–47.