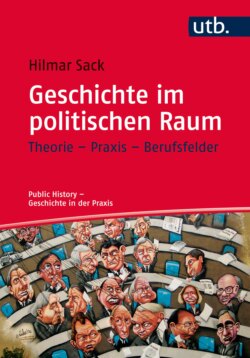Читать книгу Geschichte im politischen Raum - Hilmar Sack - Страница 5
Die Themen
ОглавлениеGeschichte ist en vogue. War das schon immer so? Und warum ist das eigentlich heute so? Detaillierter gefragt: Was wurde bzw. was wird erinnert, welche Vergangenheit erweist sich – bei wem und zu welchen Zeiten – als politisch anschlussfähig und ist noch immer aktuell? In diesem Kontext ist der schillernde Begriff ‚ErinnerungskulturErinnerungskultur‘ allgegenwärtig und zählt längst zum Grundwortschatz der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Er verweist auf transdisziplinäre Forschungsansätze der Wissenschaft, die sich seit einigen Jahrzehnten intensiv mit dem individuellen und kollektiven GedächtnisGedächtniskollektives befassen. In einem ersten Abschnitt werden zentrale Theorien vorgestellt und Sichtachsen durch das Geflecht einer verwirrenden, quasi-babylonischen Begriffsvielfalt geschlagen: vom kommunikativen und kulturellen GedächtnisGedächtniskulturelles über politische MythenMythos, politischer und ErinnerungsorteErinnerungsorte bis zum GeschichtsbewusstseinGeschichtsbewusstsein, der Vergangenheits- und/oder GeschichtspolitikGeschichtspolitik (→ Kapitel 2).
Öffentliches Erinnern und Gedenken unterliegen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Welche (geschichts-)politischen Implikationen ergeben sich daraus? Dies wird an drei Beispielen diskutiert: der EuropäisierungEuropa und GlobalisierungGlobalisierung, der Zuwanderung sowie der Folgen des Aussterbens der Generation von ZeitzeugenZeitzeuge des NationalsozialismusNationalsozialismus (→ Kapitel 3).
Die Geschichte an sich gibt es nicht; es gibt tote, ‚kalte‘ Vergangenheit, die erst im Zugriff der Gegenwart zur lebendigen, politisch ‚heißen‘ Geschichte wird. Im Kontrast zu Diktaturen, in denen die Propaganda gewünschte Geschichtsbilder diktiert, vollzieht sich die Verständigung über die Geschichte in pluralistischen, demokratischen Gesellschaften im Widerstreit unterschiedlicher Erinnerungen und konkurrierender Vorstellungen von der Vergangenheit; es herrscht ein permanenter Deutungskampf, ein Wettstreit der Geschichtsbilder. Zentrale Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit aus den letzten Jahrzehnten werden exemplarisch vorgestellt (→ Kapitel 4). Neben diesen Geschichtsauffassungen, die sich diskursiv herausgebildet haben, werden historische Repräsentationen benannt, in denen sich staatliche Vergangenheitsbezüge materialisieren: im GrundgesetzGrundgesetz etwa, in den Staatsymbolen oder – hier nicht selten kontrovers diskutiert – in der Staatsarchitektur (→ Kapitel 5).
Geschichte ist heute längst nicht mehr alleine eine Disziplin der wissenschaftlichen Experten. Dieses Lehrbuch weist deshalb vom Höhenkamm wissenschaftlicher Debatten den Weg immer auch in die vermeintlichen Niederungen des Feuilletons und vor allem der praktischen Politik als potentiellem Berufsfeld für den angehenden Historiker. Das eigentliche politische und staatliche Handlungsfeld im Bereich der ErinnerungskulturErinnerungskultur ist die Gedenkpolitik. Sie wird vor allem mit Blick auf GedenktageGedenktage, Denkmale, Gedenkstätten sowie ForschungseinrichtungenForschungseinrichtungen, MuseenMuseen und außerschulische Bildungsträger dargestellt. Weiter wird herausgearbeitet, wie Politik und Justiz in den vergangenen Jahrzehnten die doppelte Diktaturerfahrung in Deutschland aufgearbeitet haben (→ Kapitel 6).
Dass dem gesprochenen Wort im Rahmen politischen Gedenkens eine besondere Rolle zukommt, liegt auf der Hand und wird deshalb in einem gesonderten Kapitel über politisch-historische RedeRede, politisch-historischen beleuchtet. Es legt als herausgehobener Praxis-Teil dieses Buches den Schwerpunkt auf das RedenschreibenGhostwriting/Redenschreiben (→ Kapitel 7).
Schließlich: Der politische Raum konstituiert sich in der Öffentlichkeit über vermittelnde Medien: Bücher, Presse, Rundfunk und Fernsehen sowie das Internet. Dieser Themenkomplex wird mittels eines Gesprächs mit dem Historiker und Journalisten Sven Felix KellerhoffKellerhoff, Sven Felix sowie mit Fragen an einen Vertreter der Verlagsbranche beleuchtet (→ Kapitel 8).
Die Kapitel führen in den wissenschaftlichen Forschungsstand ein und benennen zentrale theoretische Fragestellungen, sie beschreiben Instrumentarien und geben Hinweise auf notwendiges Basiswissen und Berufsqualifikationen. Infokästen und ein Glossar vermitteln Hintergründe und dienen der Definition von Begriffen. In der Rubrik „3 Fragen …“ beantworten Praktiker aus Politik und Kultur, was sie unter GeschichtspolitikGeschichtspolitik verstehen, und berichten, welche Bedeutung sie in ihrem Arbeitsalltag hat. Das Lehrbuch bleibt zwangsläufig fragmentarisch, es kann das Zusammenspiel von Geschichte und Politik weder in seiner thematischen Bandbreite noch erschöpfend behandeln. Vielmehr ähnelt es einem Rundflug über eine facettenreiche Landschaft. Deshalb geben Verweise auf weiterführende Literatur am Ende jedes Kapitels die Möglichkeit zur Vertiefung skizzierter Fragestellungen, ebenso wie die Bibliografie und eine Liste relevanter Institutionen, die diesen Band komplettieren.