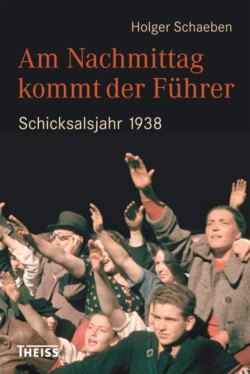Читать книгу Am Nachmittag kommt der Führer - Holger Schaeben - Страница 15
Montag, 7. Februar 1938
ОглавлениеTAGESKALENDER […]. Romuald, morgen Johann v. M., Tageslänge: 9 Stunden 53 Minuten. (Sonnenaufgang 7.21, -untergang 17.03, Mondaufgang 10.02, -untergang 0.08 Uhr. Temperatur heute um 7 Uhr früh minus 3 Grad Celsius).
Salzburger Chronik
Franz Krieger ist seit acht auf den Beinen. Sofort nach dem Frühstück hat er seine Leica genommen und mit einem frischen Film geladen. Er nimmt seine grüne Joppe vom Haken, schlüpft hinein, schlägt den Kragen hoch und verlässt gegen neun die Wohnung. Die Wohnung im zweiten Stock seines Elternhauses liegt gleich neben dem Café Tomaselli. Da will er jetzt erst einmal hin. Er lässt die schwere hölzerne Eingangstür hinter sich ins Schloss fallen und schaut sich um. In dieser Jahreszeit schatten die großen barocken Häuser den Platz noch vor der Sonne ab. Hier und da liegen Reste gefrorenen Schnees. Der Florianibrunnen präsentiert sich winterfest verpackt. Durch die Judengasse quetschen sich ein paar grelle Lichtstrahlen und finden den Weg auf den Platz. Intuitiv nimmt Franz Krieger seine Leica und richtet Blick und Objektiv auf das ihm pittoresk erscheinende Motiv. Aus dem Augenwinkel bemerkt er Walter Schwarz, der als Chef des Kaufhauses gleichen Namens im Begriff ist, die Eingangstür Alter Markt 12 aufzusperren. Krieger drückt nicht ab, lässt die Kamera sinken, wirft ihm einen kurzen Gruß zu.
In Salzburg ist Franz Krieger als der Mann mit der Kamera bekannt. Zur Festspielzeit im Sommer fotografiert er die Stars und Sternchen, lauert der Prominenz auf, wo er nur kann. Erstmalig 1936 und dann erneut im vergangenen Jahr, als er auch Emil Jannings abgelichtet hat: Jannings, ganz Weltmann – Anzug, Krawatte, Gehstock, Hut – auf dem Grünmarkt mit Marktfrauen plaudernd; Jannings, der beleibte Anzugmann im modischen Zweireiher, wie er mit seiner Frau Marold – sie trägt ein Dirndl, das an ihr wenig kleidsam wirkt – vom Universitätsplatz kommend über den Alten Markt spaziert; Jannings mit einem Sackerl voller Einkäufe in der Hand. Den reporterscheuen Stardirigenten Arturo Toscanini hat Krieger gleich mehrfach eingefangen. Auch die Dietrich ist sein Motiv geworden: einmal beim Stadtbummel mit ihrer Tochter Maria und dem Kindermädchen, ein anderes Mal mit ihrem Gatten, dem Regisseur Rudolf Sieber, beim Einkauf in der Schwarzstraße, und dann noch einmal das Paar auf dem Residenzplatz vor seinem sehr grünen Automobil. Das Foto von Attila Hörbiger, dem letztjährigen „Jedermann“, hat Krieger vor dem Tomaseffi-Kiosk auf dem Alten Markt geschossen. Auch auf der Fotojagd nach Hans Albers ist er zum Zug gekommen. Es schaut aus, als würde Albers ihm Modell sitzen: der blonde Hans in Pose – ganz salzburgisch in Janker, Lederhose, Haferlschuhen und mit Trachtenhut – auf dem Geländer am Ufer der Salzach mit der Staatsbrücke im Hintergrund. Dann noch einmal Albers, wie er einer Bewunderin vor dem Trachtenmodengeschäft Lanz in der Schwarzstraße ein Autogramm gewährt. Immer wieder lächeln Größen von Film und Bühne in Kriegers Kamera. Häufig ist es die Leica IIla, manchmal auch eine Zeiss Contax II mit 35 Millimeter Brennweite. Er fotografiert ohne die sogenannten Kanonenrohre zur Vergrößerung der Objekte. „Er musste also an seine ‚Beute‘ möglichst nahe heran, was ihm dank seines adretten, jugendlichen Aussehens und seiner guten Manieren meistens auch ohne große Mühe gelungen sein dürfte.“
Eigentlich fängt Franz Krieger alles mit seiner Kamera ein, was sich an die hiesigen Zeitungen verkaufen lässt. Als er zwölf Jahre alt war, hat sein Vater in ihm das Interesse für die noch junge Kunst des Fotografierens geweckt. Am 2. Mai 1929 fotografiert er vom Dach des elterlichen Hauses aus den Zeppelin über der Salzburger Residenz. Es ist seine erste fotodokumentarische Aufnahme. Er fotografiert beim „I. Internationalen Gaisbergrennen“ am 8. September 1929. Er fotografiert das „Große Salzburger Volksfest“ vom 31. August bis 8. September 1929. Am 6. Oktober fotografiert er einen Aufmarsch der Heimwehr mit sechstausend Teilnehmern, die über die Staatsbrücke marschieren. Und am 1. September 1932 ist er bei den Aufnahmen zum Film „Das unsterbliche Lied – Stille Nacht, heilige Nacht“ mit seiner Kamera dabei. Dann, 1932, beginnt er ein Wirtschaftsstudium an der Hochschule in Wien. Auf einer Fahrt von Salzburg zu seinem Studienort fotografiert er am 10. April 1934 mit seiner 3 x 4 Rollfilmkamera Nagel Vollenda aus dem fahrenden Zug ein Eisenbahnunglück in der Nähe von Wels, das durch einen Sprengstoffanschlag verursacht worden war. Das Bild verkauft er an mehrere nationale und internationale Zeitungen, sogar in Paris ist sein Foto zu sehen. 1934 geht er für ein halbes Jahr nach Sutton Coldfield/Warwickshire, um seine Englischkenntnisse zu vertiefen. Dort entdeckt er den Jazz für sich und wird zum leidenschaftlichen Sammler von Schellacks. 1935, er hat gerade sein Studium in Wien als akademischer Diplomkaufmann abgeschlossen, steht für ihn fest: Er will Fotoreporter werden.
Als er das Tomaselli betritt, hört Franz Krieger noch deutlich das lauter werdende Rattern der „Gelben Elektrischen“, die vom Universitätsplatz kommend durch den Ritzerbogen rollt. Krieger hört sie nur, sehen kann er sie höchstens vor seinem geistigen Auge; wie auch den Fahrer, der mürrisch auf seinem offenen Führerstand steht, wo ihn nur etwas Glas auf Stirnhöhe vor der kalten Morgenluft schützt. Der gelbe Motorwagen 9 durchfährt die Churfürststraße, nimmt die Kurve vor dem Tomaselli und erreicht den Alten Markt, wo er vor dem Tomaselli kurz Station macht, um dann über Kranzlmarkt und Rathausplatz Richtung Staatsbrücke zu verschwinden. Aber da hat Krieger schon längst die Kaffeehaustür hinter sich zugezogen und schaut nach einem freien Tisch.
Das Tomaselli ist das öffentliche Wohnzimmer am Platz. Hier drinnen ist es heimelig warm, und der Duft von Kaffee wirkt wie ein Versprechen: Heute wird ein guter Tag. Mitunter gewinnen aber auch die von den Gästen produzierten Wolken diverser Rauchwaren die Oberhand. Die Nase fühlt sich davon aber nicht gestört. Die Räume des Tomaselli sind mit prächtigen Holzvertäfelungen verkleidet, die kunstvolle Intarsien zeigen. Man sitzt an Tischchen mit weißen Marmorplatten, der Kaffee schwebt auf Silbertabletts heran, und die Ober tragen Smoking und Fliege. Es ist ein typisches Kaffeehaus, wie es in Wien zuhauf zu finden ist. Das Tomaselli ist aber auch das älteste sogenannte Wiener Kaffeehaus in Österreich. Was ein „Wiener Kaffeehaus“ ist – auch in Salzburg –, weiß Stefan Zweig zu berichten, der bis vor vier Jahren in Salzburg gelebt hat und das Tomaselli, aber auch das Bazar, gerne besucht hat: „Es stellt eine Institution besonderer Art dar, die mit keiner ähnlichen der Welt zu vergleichen ist. Es ist eigentlich eine Art demokratischer, jedem für eine billige Schale Kaffee zugänglicher Klub, wo jeder Gast für diesen kleinen Obolus stundenlang sitzen, diskutieren, schreiben, Karten spielen, seine Post empfangen und vor allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen und Zeitschriften konsumieren kann. Täglich saßen wir stundenlang, und nichts entging uns.“
Franz Krieger steuert auf die Zeitungen des Tages zu. Man sieht ihm an, dass er guter Laune ist. Er greift die Salzburger Chronik und das Salzburger Volksblatt vom Haken. Genau wie im Bazar sind sie in ein dünnes Bugholzgestell eingespannt. Er setzt sich an einen der kleinen runden Tische, gibt dem Ober ein Zeichen, bestellt einen Verlängerten und blättert sofort zum Sportteil. Franz Krieger schüttelt den Kopf: Sowohl die Chronik als auch das Volksblatt berichten vom gestrigen Springen auf dem Gaisberg. Aber beide ohne Bild.