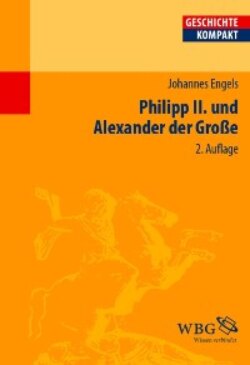Читать книгу Philipp II. und Alexander der Große - Johannes Engels - Страница 9
I. Einleitung
ОглавлениеDer Charakter der Epoche
Im Rahmen der antiken griechischen Geschichte kann man das Zeitalter Philipps II. (circa 382–336) und Alexanders des Großen (356–323 v. Chr.) als eine Übergangszeit zwischen der späten klassischen Polisstaatenwelt des 4. Jahrhunderts und dem frühen Hellenismus charakterisieren. Schon hellsichtige Zeitgenossen hatten ein klares Bewusstsein davon, dass sich zwischen 359 und 323 epochale Veränderungen vollzogen, deren Auswirkungen die ganze östliche Mittelmeerwelt, Ägypten und den Vorderen Orient betrafen. Signifikant für dieses Bewusstsein ist der historiographische Perspektiv- und Paradigmenwechsel, der sich bei griechischen Historikern von Xenophons Hellenika zu Theopomps Philippika und danach zu den frühen Alexanderhistorikern vollzieht. Xenophon hatte in seinen Hellenika den großen Torso der Geschichte des Peloponnesischen Krieges des Thukydides von 411 v. Chr. über das Endjahr dieses Krieges 404 v. Chr. hinaus fortgeführt. Denn das Ringen der bedeutendsten Poleis der polyzentrischen Staatenwelt des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., Athens, Spartas und Thebens, um die hegemoniale Stellung in Hellas war mit dem (vorläufigen) Scheitern Athens, das sich auf den Delisch-Attischen (Ersten) Seebund gestützt hatte, keineswegs beendet. Unerwartet schnell vollzog sich der machtpolitische Wiederaufstieg Athens, das sich bald durch die Neugründung des Zweiten Attischen Seebundes ein politisches und militärisches Instrument schuf, mit dessen Hilfe die Polis bis zum Ende dieser Symmachie 338 v. Chr. und zu dem Verlust der athenischen Flotte 322 v. Chr. in Hellas weiterhin eine bedeutende Rolle spielen konnte. Doch trotz der Wünsche einer Mehrheit des Demos wurde bald erkennbar, dass Athen im 4. Jahrhundert keine Hegemonie mehr über ganz Hellas würde erringen können. Sparta stützte sich in seiner Hegemonialpolitik ebenfalls auf eine hegemoniale Symmachie, den Peloponnesischen Bund. Zwischen 404 und 371 v. Chr., dem Jahr der verheerenden Niederlage von Leuktra, konnten die Spartaner trotz vielfältiger Widerstände eine Führungsstellung im griechischen Raum verteidigen. Doch stürzte auch ihre Vorherrschaft infolge des Egoismus und der Hybris der spartanischen Elite, durch die Inflexibilität und Reformfeindlichkeit des spartanischen Verfassungs-, Herrschafts- und Sozialsystems (seines Kosmos) und weil man die Widerstandskräfte der Gegner Spartas in der griechischen Welt und im Perserreich unterschätzte. Aus heutiger Analyse standen ohnehin Sparta und seiner Symmachie nur zu schwache militärische, demographische und wirtschaftliche Ressourcen für eine dauerhafte Herrschaft auch außerhalb der Peloponnes zur Verfügung. Nachdem die Spartaner die Begriffe der autonomia und eleutheria, der Selbstregierung und Freiheit der Polisstaatenwelt, mehrfach missbraucht hatten, fehlte es ihrer Vorherrschaft über Hellas zudem an einer attraktiven politischen Vision. Nach knapp zehn Jahren fand auch der thebanische Versuch der Errichtung einer Hegemonie, der sich zwischen den Schlachten von Leuktra 371 und Mantineia 362 v. Chr. in Hellas entfaltete, sein gewaltsames Ende. Die Gründe hierfür liegen primär in den mangelnden demographischen, militärischen und ökonomischen Ressourcen Thebens und seines Boiotischen Koinon. Aber auch in diesem Falle fehlte eine attraktive politische Konzeption zur Organisation der griechischen Staatenwelt, da eine bloße Ausweitung des boiotischen Föderalstaates ausschied und Theben während seiner Vorherrschaft auch das Instrument der koine eirene, einer allgemeinen Friedensordnung, nicht entscheidend weiter entwickeln konnte.