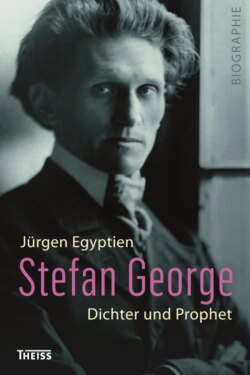Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 13
Reisen durch Europa III: Spanien – das seelenverwandte Land
ОглавлениеIn Paris hatte George den mexikanischen Regierungsbeamten und Arzt Antonio Peñafiel und dessen Söhne Antonio, Julio und Porfirio kennengelernt. Mit ihrer Hilfe frischte er seine Spanischkenntnisse auf, um sich auf die Reise vorzubereiten. George hatte bereits mit elf Jahren in der Bingener Realschule an dieser Sprache Interesse entwickelt. Er habe, so erzählte er noch in seinen letzten Lebensjahren, einen venezolanischen Mitschüler gehabt, der ihm einen Band mit spanischsprachigen Romanzen gegeben habe. Viele lernte er auswendig und konnte noch in hohem Alter ganze Strophen rezitieren. „Klang und Inhalt der Romanzen faszinierten ihn so, dass er begann, Spanisch zu lernen.“47 Wohl am Ende seiner Schulzeit hat George einige Verse aus der Romanze des Abenamar (SW XVIII, 61) sowie das Gedicht Menschen und Kinder (Hombres y niños) des Constantino Gil y Luengo, vielleicht auch schon Das Glocken-Konzert (El concierto de las campanas) von Ramon de Campoamor (SW I, 45f.) übertragen. Bis an sein Lebensende bekundete George ein vitales Interesse an der spanischen Kultur und Sprache. Die Begleiterin seiner letzten Lebensjahre, die er vorwiegend im italienischen Minusio am Lago di Maggiore verbrachte, war die promovierte Hispanistin Clotilde Schlayer. George las gerne in der spanischen Tageszeitung Diario ABC, die Schlayer abonniert hatte, und äußerte sogar den Wunsch, seine Sprachkompetenz im Spanischen wieder durch Konversationsstunden mit ihr aufzufrischen.
Das Interesse Georges an Spanien ging aber weit über Sprache und Kultur im engeren Sinne hinaus. Man könnte vielleicht sogar die These aufstellen, dass George zu keinem Land eine so große seelische Wesensverwandtschaft verspürt habe wie gegenüber Spanien. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass er noch im Februar 1920, also zu einem Zeitpunkt, da doch in seiner Dichtung und seinem ganzen Denken die griechische Antike den eigentlichen Glutkern bildete, im Gespräch mit Edith Landmann bekannte, dass „ihn der Dämon nicht nach Italien getrieben hätte, sondern nach Spanien.“ (EL 104) Spanien sei es gewesen, das auf ihn „formierend“ gewirkt habe. Wenn man berücksichtigt, dass George an dieser Stelle sicherlich mit voller Absicht auf den Goetheschen Begriff des Dämonischen, wie er in dem berühmten Urworte-Gedicht zur Kennzeichnung des tiefsten inneren Wesens entwickelt wird, Bezug nimmt, wird man den Stellenwert ermessen, den George seiner Spanien-Erfahrung zuschreibt. Sie hat wohl beinahe den Charakter einer Initiation oder einer schockhaften Selbsterkenntnis. Friedrich Wolters formuliert sogar, in Spanien habe „ihn das seltsame Gefühl des Wiedersehens mit einer längst entschwundenen Heimat“ (BG 22) ergriffen. Es ist jedenfalls alles andere als eine bloße Äußerlichkeit, wenn George seit dieser Spanienreise im Spätsommer 1889 ein Leben lang eine Baskenmütze tragen wird, allerdings ausschließlich „das echte béret“ (RB II, 35), in das das baskische Wappen am Rand eingewoben ist. Vermutlich hat George sein erstes béret bereits beim Grenzübergang vom französischen Hendaye ins spanische Irún erworben. George dürfte bald nach dem 21. August 1889 Paris verlassen haben. An diesem Tag hatte er noch an der Beerdigung des bedeutenden und auch von ihm verehrten symbolistischen Dichters Villiers de l’Isle Adam teilgenommen, der später im Siebenten Ring neben Verlaine und Mallarmé in Georges poetischem Rückblick Franken namentlich genannt wird. Als George aus Paris aufbrach, hatte er eine Empfehlung von Antonio Peñafiel im Gepäck, die dieser „in seiner Funktion als Directeur General de Estadística de México vom Pariser mexikanischen Konsulat […] an einen befreundeten mexikanischen Regierungsbeamten in Madrid“48 mit der Bitte gerichtet hatte, man möge sich dort um ‚den deutschen Freund Etienne George‘ kümmern. Wahrscheinlich verzichtete George in Madrid aber auf einen mexikanischen Botschafts-Cicerone.
Über seine Reiseroute herrscht keine letzte Gewissheit, die eher spärlichen Überlieferungen aus Gesprächen mit George über seinen Spanien-Trip machen in Kombination den folgenden Verlauf wahrscheinlich. Da Georges erstes Ziel für einen längeren Aufenthalt Madrid gewesen sein dürfte, hat ihn der Weg von der Grenze bei Irún aus wohl über San Sebastian, Vitoria und Burgos geführt. Am 29. August meldete George seinen Eltern seine glückliche Ankunft in Madrid, wo er zunächst im Hotel Navarra, 19 Calle de Alcalá, abstieg. Es war eher eine Pension, die im Obergeschoss eines größeren Gebäudes lag. Clotilde Schlayer schrieb George noch im Juni 1933 aus Madrid, dass sein ehemaliges Quartier noch existiere. George muss dann einige Tage später in das Hotel Victoria, Calle de la Cruz, umgezogen sein. Er nahm an dem Empfang für einen Stierkämpfer teil, desssen „würdig ernste Haltung“ (RB II, 34) ihm imponierte.
Man könnte sagen, dass George in Spanien besonders diejenigen kulturellen Phänomene faszinierten, die eine Art Übersetzung der ästhetischen Merkmale des Symbolismus in das habituelle Gebaren bildeten. Dazu gehörte die formvollendete Durchgestaltung der sozialen Interaktion, das ausgeprägte Gefühl für Eleganz, die zugleich mehr Strenge als Leichtigkeit besitzt, Grandezza und innerer Adel, die mit einer würdevollen und stolzen Haltung einhergehen, Gemessenheit und Distanziertheit. Weiterhin zählen dazu die verfestigten ästhetischen Formen eines uralten Katholizismus, der eine gewisse Tendenz zu Fanatismus und Askese einschließt. Gleichzeitig lauern unter all dieser strengen Geformtheit und Selbstbeherrschung tiefe Glut und Leidenschaft, die in heftigen Gefühlseruptionen ausbrechen können.
Von Madrid aus unternahm George die Weiterreise an die Mittelmeerküste bei Cartagena. Den Süden Spaniens empfand er „ganz afrikanisch – weite Strecken eine Wüste, in der dann noch vereinzelt eine Palme auftaucht – hin und wieder eine Oase.“ (BV 63) Da ihm damals die syrisch-arabische Kultur sehr nahe gestanden habe, fasste er den Plan, von Cartagena aus in den Maghreb überzusetzen, was aber ein Zufall verhinderte. So besuchte er noch Elche und sah dort Europas einzigen Palmenhain und Murcia, an dessen Charakter ihn „die einstige Verbindung des gotischen und maurischen Geistes beschäftigte“ (BG 23). Die übrigen verbürgten Ziele seiner Spanienreise könnte George von Madrid aus in Tagesausflügen erreicht haben. Dazu zählte Toledo, das ihn mit seiner topographischen Lage auf einer Bergnase fesselte. Die Stadt selbst mutete ihn „fremd und seltsam“ (BV 63) an. Hingegen haben offenbar sowohl El Escorial als auch Aranjuez in ganz besonderem Maße bewirkt, das dort in Spanien „ein unheimlicher Tiefenraum der Erinnerung in ihm aufbrach“ (BG 22). Das Gedicht Verjährte Fahrten II aus dem Band Pilgerfahrten von 1891 zeugt von Georges Besuch der Königsresidenz Aranjuez südlich von Madrid. Es evoziert die Atmosphäre eines wie im Zauberschlaf erstarrten Palastes und Parks, in dem alles von ‚grauem Flor‘ überzogen ist. George hat sich selbst in der Gestalt eines ‚Fremden‘ in dieser Szenerie porträtiert, der alleine die verlassenen Pfade wandelt und bei großer Hitze und ‚Fieberdunst‘ nach Spuren eines Prinzen Ausschau hält. Die Königsresidenz Aranjuez war von der Herrscherfamilie allerdings bereits 1885 wegen einer Cholera-Epidemie aufgegeben worden. Nur König Alfons XII. war noch am Ort geblieben, um bei der Versorgung der Kranken zu helfen, starb aber selbst im November an Tuberkulose. Der 1886 geborene Alfons XIII. befand sich in Madrid.
Erfolgreicher verlief Georges Suche nach Prinzen im El Escorial, denn dort war im Jahr zuvor das Panteón de los Infantes eingeweiht worden.49 Es diente als Gedenkraum für alle vor Antritt des Thronerbes verstorbenen Prinzen und war der seit 1654 bestehenden Begräbniskapelle der spanischen Könige, dem Panteón de los Reyes, direkt benachbart. In dem in die Hymnen eingegangenen Gedicht Der Infant hat George seinen Besuch dieses Memorialorts festgehalten und sich insbesondere des im Alter von sechzehn Jahren verstorbenen Prinzen Don Baltasar Carlos angenommen. Seine sterblichen Überreste waren erst 1888 in den Panteón de los Infantes überführt worden. Der Gedenksaal hält die Erinnerung an die verstorbenen Thronaspiranten wie üblich durch Ölgemälde mit ihren Konterfeis und mittels zugehöriger Exponate fest. Don Baltasar Carlos war ein Fan des Ballspiels ‚pelota‘, er starb in Folge einer fiebrigen Erkältung. Das Gedicht erwähnt den „treubewahrten seidenball/Der rosenfarben und olivengrün/Noch schimmert auf der eichenen konsole“ und die „kühle bergesbrise“, die für den Prinzen ein „allzu rauher spieltrabant“ (SW II, 26) gewesen sei. Besonderes Interesse kommt dem Gedicht aber dadurch zu, dass es den Frühverstorbenen zum einen „zwillingsbruder“ nennt, zum anderen ihn dazu beglückwünscht, dass es ihm erspart blieb, „zum finstern mann […]/Wie der und jener an den nachbarmauern“ zu werden.
Hier gehen zwei wesentliche Motive in Georges Vorstellungswelt eine Verbindung ein, die man als ‚Idee vom kindlichen Königtum‘ und als ‚Erwählung zum unschuldigen Tod‘ bezeichnen kann. In Georges Dichtung lassen sich von Beginn an Spuren der besonderen Attraktion, die Gräber von jung Verstorbenen auf ihn ausüben, entdecken. Das wohl im Sommer 1888 in London geschriebene Gedicht Windsor hält den Besuch dieses Palastes fest, von dem es heißt, es „Rührte so mich keine stelle/Als das grabmal in der schlosskapelle.//Ausgeformt in weissem marmor/Liegt dort eines jünglings leiche.“50 Wenige Monate später dürfte das Gedicht November-Rose in Montreux entstanden sein, das im Gefolge des melancholischen Herbstgedichts T’is the last rose of summer von Thomas Moore das lyrische Ich in Reflexionen auf einem Friedhof versunken zeigt. „Auf eines jünglings grab ich stehe:/[…]/Eh ich verwelke eh ich vergehe/Will ich sein frisches grab noch schmücken/Am totentag.“ (SW I, 57)51 Den Tod in jungen Jahren als Indiz göttlicher Erwählung findet man explizit bereits im Gedicht Gräber II, dessen Entstehung sogar bis ins Jahr 1887 zurückreicht. Der Sprecher beobachtet dort, wie „Eine mutter mit feuchtem auge/Vor dem grabe des kindes kniet“, und kommentiert:
Törichte mutter
Die du bei des sohnes
Scheiden aus der erde getümmel
Suchest nach einer schuld –
Weisst du nicht mutter:
Früh ruft der himmel
Zum glanz seines thrones
Wer sich erfreut seiner höchsten huld.
(SW I, 35)
Das korrespondierende Konzept des kindlichen Königtums hat eine autobiographische Wurzel. Zu erinnern ist an den Bericht des Schulkameraden Julius Simon über das fiktive Königreich des neunjährigen George, in dem er die Herrscherrolle für sich reklamierte. Weiterhin sind wir dieser Quelle in der Geheimsprache des Gedichts Ursprünge begegnet, wo ihre Erfindung in die Zeit der Kindheit zurückprojiziert wurde und sie zur magischen Weltbemächtigung diente. Das lyrische Ich, das hier im pluralis majestatis spricht, erinnert sich, wie es „In einem sange den keiner erfasste“ (SW VI/VII, 117) sich in seinem ‚Schilfpalast‘ der wollüstigen Fantasie hingibt, mittels Sprache „heischer und herrscher vom All“ zu sein. Diese imaginäre Rolle baute George zum Konzept des kindlichen Königtums aus, dem er 1895 ein programmatisches Gedicht diesen Titels widmete. In der Gestalt Maximins werden später beide Modelle zusammengeführt und durch die autobiographische Erfahrung beglaubigt.
Aber kehren wir zurück zu Georges Spanienreise. Wenn Friedrich Wolters schreibt, dass vor allem im spanischen Kernland um Madrid und Toledo „die harte, fast unerbittliche Strenge der Landschaft mit den finsterstolzen Königsschlössern gewaltige Bilder einer königlichen Einsamkeit und unnahbaren Größe“ (BG 22) in George wach rief, fällt es nicht schwer, diesen Eindruck nachzuempfinden, wenn man einmal – wie George – an einem hochsommerlichen Tag in flirrender Hitze auf staubigem, steinhartem Grund vor den abweisenden gewaltigen Fassaden der Königsresidenz Philipps II. gestanden hat.
Katharina Mommsen hat in einer instruktiven Deutung von Georges Gedicht Nachmittag aus den 1890 erschienenen Hymnen den Indizienbeweis geführt, dass George den El Escorial besucht hat. Philipp II. hatte den Palast architektonisch in der Form eines Feuerrostes anlegen lassen, da er zu Ehren des Hl. Laurentius errichtet worden war. Laurentius hatte auf einem solchen Marterwerkzeug den Tod gefunden. Georges Gedicht nimmt diese Bauform und die gleichsam ‚glühende Atmosphäre‘ auf:
Sengende strahlen senken sich nieder
Nieder vom wolkenfreien firmamente ·
Sengende strahlen von blitzender kraft.
Die südenklare luft in mittagstille.
Längs den palästen starb der menge wimmeln
Auf der fliesen feuer-bergender fläche.
Mit stummen zinnen und toten balkonen
Die langen mauerwälle starr dastehn
Heisshauchend wie wirkende opferöfen.
In den höfen umragt von säulengängen
Der versiegten brunnen kunst versagt ·
Auf beeten wo der büsche blätter sich krümmen
Halbverdorrter blumen odem lagert.
Sengende strahlen senken sich nieder
Nieder vom wolkenfreien firmamente.
Und dem Einsamen der mit entzücken sie fühlt
Der des gemaches duftender kühle entfloh
Gegenglut für zerstörende gluten suchend
Stetig sie auf scheitel und nacken scheinen
Bis er rettender schwäche erliegen darf
Hingleitend bei eines pfeilers fuss.
Sengende strahlen senken sich nieder.
(SW II, 14)
Das Gedicht, das wohl aus dem Frühjahr 1890 stammt, demonstriert, wie sehr sich George die in Paris entdeckten Techniken des Symbolismus zueigen gemacht hat. Mommsen hat zu Recht darauf hingewiesen, dass „jedes einzelne Detail Bezug auf märtyrerhaft qualvolle Zustände“ hat.52 Es ist nicht zu übersehen, dass George sich als ein von Qualen Verfolgter mit dem Hl. Laurentius identifiziert, wobei die Architektur des ‚San Lorenzo del Escorial‘ und das Motiv von Hitze und Glut zusammenspielen. Dabei lässt sich das Bild von innerer Glut und äußerer Gegenglut auf zweifache Weise verstehen. Zum einen ist es gut vorstellbar, dass mit der ‚zerstörenden Glut‘ im ‚einsamen‘ Sprecher der sexuelle Trieb gemeint ist, der wie schon in zahlreichen Gedichten der Fibel als existentielle Gefährdung erfahren wird. Die äußere ‚heißhauchende‘ Gegenglut wirkt darauf quasi domestizierend ein, indem sie den Körper ermüdet und ‚rettend schwächt‘. Wegen dieses Effekts setzt sich der vom Verlangen Gequälte „mit entzücken“ der sengenden Hitze aus. Eine zweite Lesart hat Mommsen angeboten, indem sie das Märtyrerschicksal des Laurentius als Modell für Georges qualvolle Suche nach dichterischem Ausdruck deutet. Sie meint, dass George so sehr „von der den Martertod des Hl. Laurentius feiernden Baukunst des Escorial ergriffen“ wurde, dass sie ihn zu diesem Gedicht über „das durch die künstlerische Not über ihn verhängte Martyrium“ inspirierte.53 Mommsen rückt die Qual des ‚Einsamen‘ im Nachmittag nicht ohne Grund in den Kontext von Georges Suche nach der ihm gemäßen dichterischen Sprache.
George hatte Spanien Ende September verlassen und war über Paris direkt zurück ins Bingener Elternhaus gefahren. Dass er von seinen Spanischkenntnissen auch in seiner mittelrheinischen Heimat Gebrauch machte, überliefert die Anekdote eines jüngeren Verwandten, die vielleicht ins Frühjahr 1890 fällt. George traf den Knaben auf der Straße und ging mit ihm zur Post, wohin beide unterwegs waren. „Hier gab er mir einen Wink, ging zum Schalter und begann mit dem Postbeamten, wenn ich nicht irre, Spanisch zu sprechen. Französisch war es nicht, Englisch auch nicht. Der Postbeamte verstand keine Silbe. Kaum hätten des Dichters Wünsche, die darnach gingen, einige Freimarken zu erhalten, Erfüllung gefunden, wenn es beim Spanisch geblieben wäre. Aber auf einmal redete der ‚Ausländer‘ in unverfälschtem Binger Dialekt daher. Wer aber aus dem Staunen nicht herauskam, das war der Postbeamte. Er glaubte doch, die Binger Leute zu kennen, und der Mann da mit den langen Haaren und dem scharf geprägten Gesicht war sein Lebtag kein Binger. Woher kannte der eigentlich Bingerisch? Stefan bekam seine Marken, ich erledigte meine kleine Einzahlung, und dann ging Stefan wieder mit mir in die Stadt zurück.“54