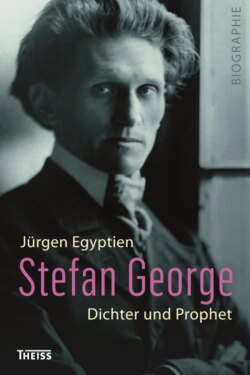Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 14
Die Hymnen und der erste ‚Paladin‘ Carl August Klein
ОглавлениеGeorge blieb indes nur wenige Tage, bevor er nach Berlin aufbrach, um dort sein Studium an der Friedrich-Wilhelms-Universität aufzunehmen. Bereits am 5. Oktober schickte er seinen Eltern eine Karte, um sie zu informieren, wo er untergekommen sei. „Eben komme ich in Berlin an und wohne vorläufig bei Herrn Klein Albrechtstraße 6a N. W.“55 Die Albrechtstraße liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße. Noch im Oktober ist er dann in die Schwedterstraße 30 zu einer Frau Ebermann auf den Prenzlauer Berg umgezogen. George inskribierte sich am 25. Oktober 1889 für deutsche und romanische Philologie, besuchte aber auch Lehrveranstaltungen in der Anglistik, Philosophie und Kunstgeschichte. In seinem ersten Semester nahm er bei Adolf Tobler an der Vorlesung ‚Historische Syntax des Französischen‘ und einer Übung zum ‚Chevalier au lion‘ teil, also zu dem Artusroman über den Löwenritter Iwein des hochmittelalterlichen Epikers Chrétien de Troyes. Bei dem berühmten Germanisten Erich Schmidt hörte er ‚Deutsches Drama im 19. Jahrhundert‘, bei dem Pädagogen und Philosophen Friedrich Paulsen eine ‚Einleitung in die Philosophie‘ und bei dem Begründer der Anglistik Julius Zupitza ‚Shakespeares Hamlet‘.
George spricht in diesem ersten Semester in Berlin privat fast nur Spanisch und Französisch. Gleich Anfang November hatte er wieder Kontakt zu seinen mexikanischen Freunden gefunden, da die drei Brüder Peñafiel sich ebenfalls in Berlin aufhielten. Mit ihnen gemeinsam unternahm er Sightseeing-Touren durch Berlin und nach Potsdam. Für ihn war Berlin samt Umgebung ein neues Terrain, das er sich durch ausgedehnte Gänge erschloss. Die Freundschaft mit den Mexikanern war so eng, dass zwei Brüder George im März 1890 in seinem Elternhaus in Bingen besuchten, wo er die Semesterferien verbrachte. Dem gemeinsamen Freund Maurice Muret berichtete George von Ausflügen an „wunderbar schönen vorfrühlingstagen“ (RB 224), bei denen sie „die ganze umgegend in meilenweitem cirkel abgegrast“ hätten.
Maurice Muret war ein Student aus der französischsprachigen Schweiz, den George in einer Lehrveranstaltung bei Tobler kennengelernt hatte. George hatte sich ihm mit den Worten „Je suis de la même race que vous“56 vorgestellt und parlierte mit ihm fast ausschließlich auf Französisch. Er schlüpfte gegenüber Muret quasi in die Rolle Saint-Pauls gegenüber ihm und führte den Schweizer als ein literarischer Mentor in die Werke des französischen Symbolismus ein. George nahm Muret auch häufig zu Theateraufführungen mit und versuchte bei ihm Interesse für Ibsens Stücke zu wecken. Muret erinnert sich: „Ich begleitete George von der Universität auf seine Studentenbude; er las mir – übrigens sehr gut – nicht nur Mallarmé und Verlaine vor, sondern auch Verse von René Ghil, von Stuart Merrill, von Vielé-Griffin, damals noch sehr wenig bekannten Dichtern. Von der französischen Literatur kamen wir auf die Diskussion der Literatur, die Goethe Weltliteratur genannt hatte. Man begann damals in Deutschland gerade die Werke eines vielbesprochenen Norwegers zu spielen, der den Namen Henrik Ibsen führte. Wir zogen durch die verschiedenen Berliner Theater, wo er auf dem Spielplan stand. Wir leisteten uns sogar den Luxus eines Parkettsitzes zur Premiere eines Ibsenschen Dramas, das den Titel Nordische Heerfahrt führte.“ George war in dieser Zeit ein eifriger Theatergänger. Er war sogar – man staune – Mitglied im Verein ‚Freie Bühne‘ geworden, dessen Mitgliederverzeichnis ihn zum 1. Januar 1890 als ‚stud. Edienne [!] George‘ aufführt. Das Erstaunliche liegt nicht allein darin, dass der passionierte Einzelgänger Stefan George überhaupt einem Verein beitrat, sondern auch in dem Charakter des Vereins. War doch die ‚Freie Bühne‘ ins Leben gerufen worden, um dem ‚modernen‘, das heißt zu dieser Zeit naturalistischen Theater einen der Zensur entzogenen Ort zu schaffen. Der Verein war bei Georges Eintritt noch ganz jung. Er war am 5. April 1889 in Berlin gegründet worden und hatte bis zum Jahresende beinahe die Zahl von tausend Mitgliedern erreicht. Namhafte Gründungsmitglieder waren Otto Brahm, Theaterkritiker und später Intendant des Deutschen Theaters, die Brüder Heinrich und Julius Hart, beide naturalistische Schriftsteller, die jungen Journalisten Maximilian Harden und Theodor Wolff und der Verleger Samuel Fischer, der ein paar Jahre zuvor seinen S. Fischer-Verlag gegründet und 1887 als erstes Werk Henrik Ibsens Rosmersholm herausgebracht hatte. Auch der Verein ‚Freie Bühne‘ startete mit Ibsen. Am 29. September 1889 wurde im Lessing-Theater Ibsens Stück Gespenster aufgeführt, drei Wochen später Gerhart Hauptmanns Vor Sonnenaufgang sogar als Uraufführung den Mitgliedern geboten. Das Stück löste einen Skandal aus. Es muss auf jeden Fall Georges Interesse erregt haben, denn Carl Rouge schickte ihm im April 1890 die (entliehene?) Buchausgabe nach Berlin. Unter dem Gesichtspunkt, dass die ‚Freie Bühne‘ sich für Ibsen einsetzte und in ihrer ‚Proklamation zur Mitgliederwerbung‘ für die Unterstützung einer gegen den erstarrten Theaterbetrieb gerichteten lebendigen Dramatik eintrat, gewinnt Georges Entschluss, sich diesem Verein anzuschließen, auf den zweiten Blick doch eine gewisse Plausibilität.
Muret und George liebäugelten in diesem Frühjahr 1890 sogar mit dem Gedanken, die Brüder Peñafiel am Ende des Jahres bei ihrer Rückreise nach Mexiko mit einem one-way-ticket zu begleiten. Ihre Korrespondenz umkreist dieses Thema mit erkennbarer Ernsthaftigkeit. In diesen ersten Monaten des Jahres 1890 hatte sich Georges Sprachkrise zugespitzt. Es war die Zeit, in der er mit seiner künstlichen lingua romana experimentierte, deren Klangbild den intensiven Umgang mit den romanischen Sprachen dokumentiert. Muret schenkte er in lingua romana abgefasste Abschriften mehrerer Gedichte mit der entsprechenden Widmung: „A meo amico e colegio apreciato Maurice Muret “ (ZT 13). Das Dokument, das den tiefsten Einblick in Georges sozialen Umgang in diesen ersten Berliner Monaten und sein Ringen um einen neuen sprachlichen Weg für sein Dichten bietet, ist ein langer Brief an Arthur Stahl vom 2. Januar 1890, aus dem eine ausführliche Passage zitiert sei. Man begegnet in ihm auch wieder Georges kosmopolitischer Orientierung und seinem kritischen Blick auf deutsche Verhältnisse.
Amico de meo cor! El tono elegico conque partas en tua letra de nostra corespondencia longamente interroupida me ha magis commovido que el vituperio fortissimo.
Um gottes willen wirst du ausrufen in welcher sprache schreibt denn der mensch hier; die hauptsache ist dass Du die verstehst – vom anderen später. […] Ich habe so eine art plan – du weißst das ist mein genre und ich falliere damit nur leider zu oft – ich wollte den plan einer poetischen und kritischen mappe wieder auffrischen – Eh du weiter liest bitte ich Dich nicht zu sehr jene furchtbaren schmierkaractere zu verdammen denn ich komme eben von den Mexicanern bei denen ich sehr starken kaffee trank wodurch zufolge ich scheusslich nervös bin – jene krankheit wenn du es so nennen willst hat sich überhaupt bei mir in letzter zeit gesteigert bis zum excess. […] Ich lebe hier ziemlich zurückgezogen, ich habe auch einen kreis von freunden die ich Dir nächstens detaillieren werde: Darunter Franzosen, Italiener, Mexicaner etc. kurz einen wahren jardin d’acclimatation. […] Unsere deutschen sind im allgemeinen nur Träumer Denker oder auf der anderen seite streberseelen, die viel von philosophie faseln die sich gelegentlich einmal gern totschießen möchten denen aber das jugendlich-kecke und das männlich-wagende zum großen teil abgeht. […] Jetzt noch ein Geständnis das mir schwerer wird niederzuschreiben. Der gedanke, der mich von jugend auf geplagt und heimgesucht hat, der in gewissen perioden sich wieder und wieder aufdrängte hat mich seit kurzem wieder erpackt: Ich meine der gedanke aus klarem romanischen material eine ebenso klingende wie leicht verständliche literatur sprache für meinen eigenen bedarf selbst zu verfassen. Die gründe weshalb ich in meiner deutschen sprache nicht gern schreiben will kann ich dir auf diesem gemessenen raum nicht auseinandersetzen. (Im anfang des briefs hast Du eine probe) Darin liegt auch der grund weshalb ich seit monden nichts mehr verfasse, weil ich ganz einfach nicht weiß in welcher sprache ich schreiben soll. Ich ahne, diese idee wird entweder bei mir verschwinden oder mich zum märtyrer machen. Lebe wohl, Deine hand? Dein Etienne57
In dieser Situation wurde Mexiko ihm zum Idealbild einer neuen Wirklichkeit, einer Art Gegenwelt. Es ist bezeichnend, dass das Bild Mexikos, das ihn lockte, nicht im entferntesten der geschichtlichen Situation Mexikos entsprach, sondern eher ein bloßes Negativ der von ihm als bedrückend empfundenen Zustände in Deutschland bildete. Mexiko trat gewissermaßen als diesseitiges Phantasma an die Stelle des Kalifentums Amhara aus der ersten und an die Stelle des ‚Schilfpalastes‘ aus der zweiten Phase seiner durch selbsterfundene Sprachen vermittelten Weltflucht. Es ist wohl teilweise dem Realitätssinn von Carl August Klein zu verdanken, dass George von seinen Auswanderungsplänen nach Mexiko wieder abrückte. Im Dezember begleitete George die mexikanischen Freunde noch bis zu ihrem Überseedampfer nach Bremen. Es folgten noch einige Grußkarten, dann verlor sich die Verbindung.
George und Klein hatten sich wohl bereits in den ersten Tagen des Wintersemesters 1889/90 in einer Vorlesung bei Tobler kennengelernt. Es mag sein, dass dieselbe Mundart sie einander zuführte, denn Klein stammte aus Darmstadt und hatte ebenfalls das Ludwig-Georgs-Gymnasium besucht, wo er ein Jahr vor George die Reifeprüfung ablegte. Er war soeben aus Heidelberg zum Studium der Neueren Sprachen an die Berliner Universität gewechselt. Carl August Kleins Schilderung ihrer Begegnung liefert eine Art Urszene für viele folgende Erstbegegnungen. Sie ist das Modell einer metánoia, der Verwandlung eines Menschen durch die charismatische Ausstrahlung eines anderen. „Als Stefan George in jenem Hörsaal auf den unfertigen Studenten zutrat, legte dieser zaghaft und beklommen die Hand in die dargebotene Rechte. Nur eine Minute währte die Befangenheit. Ein Etwas, von dem ich mir noch nicht Rechenschaft zu geben wußte, quoll langsam in mir auf, weitete sich rätselhaft, hob sich jach empor und gestaltete sich zu wortloser Seligkeit. In anbetender Bewunderung verharrte ich, gebannt von der Macht eines Blickes, der aus nie geschauten Zonen von einem fernen schönen Sterne zu kommen schien. Ich stand vor ihm, dem die freigebige Gunst würdiger Wanderjahre edelsten Gehalt, vollste Reife verliehen hatte.“ (CAK 13) Klein charakterisiert diesen Moment weiterhin als ‚Erweckung‘ und ‚Weihe‘, die seinem „ganzen Leben Form und Inhalt gab“ (CAK 14). Die Wucht des Erlebnisses stürzte ihn in der folgenden Nacht in einen „Wirbelsturm der widersprechendsten Empfindungen“ (CAK 15) und quälte ihn mit der selbstzweiflerischen Frage, ob er dem ihm zugedachten „neuen Amte“ (CAK 16) gewachsen sei. Klein berichtet in seiner mit Stilisierungen nicht sparsamen Erinnerungsschrift, die auch manche weltanschauliche Züge ihres Erscheinungsjahres 1935 trägt, wie er am folgenden Morgen zu George gestürmt sei, um ihm sein Schwanken zwischen Glückseligkeit und Bangnis vorzutragen. Die Beschreibung von Georges Auflösung der persönlichen Spannung liefert eine weitere Urszene, deren sprachlicher Duktus absichtsvoll biblische Wendungen umspielt. „Überlegen nur lächelte der Meister ob meines Überschwanges. […] Er sprach schlicht und bedeutungsvoll. Er bürge für meine Bewährung. […] Mit hoheitsvoller Gebärde ernannte der Führer den Folger zu seinem Mitstreiter, hatte er mich doch ausersehen zum Herold für das Werk seines Lebens. Mit gütevollem Zuspruch erkor er mich zu seinem ihm allzeit verbundenen Freunde. Sein Wille entschied. Für Bedenken, die triftiger Gründe entbehrten, gab es keine Stätte, wo er gebot. Er sprach, und schon hatte er überzeugt.“ (CAK 16f.)
Die Verwendung der Anredeform ‚Meister‘ und die Bezeichnungen ‚Führer‘ und ‚Folger‘ sind dabei Rückprojektionen Kleins. Sie waren im Herbst 1889 noch nicht in Gebrauch. In der nach dem ersten Berliner Semester einsetzenden Korrespondenz ist von Seiten Kleins der verehrende Ton von Beginn an präsent. Klein spricht George als ‚königlichen Dichter‘ und ‚großen Helden‘ an, der für seine dichterische Passion jedes Leid auf sich genommen habe und weiter auf sich zu nehmen bereit sei. Vom ersten Moment an identifizierte sich Klein mit der ihm zugedachten Rolle eines persönlichen Adlatus und eines Propagandisten der noch zu schaffenden neuen Dichtung. Er sah sich selbst als Georges „Paladin“ (CAK 5). Im Auftreten inszenierten sich sowohl George als auch Klein als Dandys. Das bekannte ‚Messebild‘ von 1892 zeigt beide in eleganter Kleidung mit einem Zylinder, den der Berliner Volksmund ‚Ofenrohr‘ nannte. Klein entwickelte von Beginn an eine enorme Betriebsamkeit, um Georges Lieblingsidee einer eigenen literarischen Zeitschrift Wirklichkeit werden zu lassen. Er fungierte für George als eine Art Scout im literarischen Leben Berlins und lieferte in seinen Briefen detaillierte Autorenporträts, recherchierte als literarische Geheimtipps kursierenden Namen nach und holte Auskünfte über Zeitschriften und Verlage ein.
Neben Kleins Zuspruch dürfte das entscheidende Motiv zum Verbleib in Deutschland aber die Überwindung seiner Sprachkrise im Frühjahr 1890 durch die Wiedergewinnung des Deutschen als Dichtersprache gewesen sein. Es war freilich eine Wiedergewinnung, die für George den Charakter einer Neugewinnung, eines qualitativ neuen Tons hatte. Nach der Phase der lingua romana setzte Georges Produktion deutschsprachiger Gedichte im Frühjahr 1890 erneut ein. Die Besinnung auf das Spezifische der lyrischen Sageweise mündete konsequent in das fundamentale Gebot, die Lyrik solle nur das sagen, was sie allein zu sagen vermag. Die geschärfte poetologische Reflexion forderte die Abstreifung alles bloß Äußerlichen, rein Stofflichen. Für George stellte eine solche Lyrik ganz selbstverständlich die Kunstform dar, von der aus die Dichtungssprache erneuert werden kann. In einem Brief vom 22. November 1890 an Arthur Stahl schreibt er: „Du redest so verächtlich über lyrik als von dem einzigen wozu Du Dich bis jetzt aufgeschwungen hättest. Geht doch von hier aus in erster linie das NEUE aus. Aber mein buch das Du nächstens haben wirst soll für mich sprechen.“58
Dass George davon überzeugt war, mit diesen Gedichten einen entscheidenden Entwicklungsschritt vollzogen zu haben, lässt das programmatische Gedicht Weihe erkennen, mit dem er später seine Hymnen und damit sein ganzes Werk eröffnen wird. Der Text ist ein Musterbeispiel an Formbeherrschung und Klangzauber. George schwelgt hier geradezu in symbolistischen Synästhesien und raffinierten Klangfärbungen. In der ersten Strophe bekommt jede Zeile eine vokalische Imprägnierung:
Hinaus zum strom! wo stolz die hohen rohre
Im linden winde ihre fahnen schwingen
Und wehren junger wellen schmeichelchore Zum ufermoose kosend vorzudringen.
(SW II, 10)
In der Wortfolge von der „glatten fluten dunkelglanz“ in der zweiten Strophe erschafft George sogar einen Klangchiasmus, indem er mit der Abfolge von gla-e-u-e-u-e-gla eine klangliche Achsenspiegelung vornimmt. Das sind verstechnische Feinheiten, die den Kenner symbolistischer Ästhetik mit der Zunge schnalzen lassen.
Weihe gipfelt in der Begegnung zwischen dem lyrischen Ich und einem als Herrin bezeichneten himmlischen Wesen, das den für reif, rein und geheiligt befundenen Sprecher zum Dichter weiht. Dies jedenfalls dürfte der Sinn ihrer Segnung sein, die sich in einem Kuss vollzieht. George stellt damit eine Art Initiationsszene an den Anfang seines Werks, in der das lyrische Ich von einer musenähnlichen Instanz geprüft und in den Dichterstand erhoben wird. Es ist ein Akt poetischer Selbstlegitimation. Von jetzt an zählt der Sprecher zu den Erwählten.
Bis zum Spätsommer entstand in Berlin, Bingen und auf Reisen eine Gruppe von achtzehn Gedichten, die George im Dezember auf eigene Kosten in 100 Exemplaren bei der Druckerei Wilhelm & Brasch als Privatdruck herstellen ließ. Er übergab und schickte sie an Freunde und Familienangehörige, in drei Buchhandlungen in Berlin, Darmstadt und München, wo Arthur Stahl inzwischen studierte, lagen wenige Exemplare zum Kauf aus. Einen festen Preis verlangte George nicht, aber er schrieb Stahl, dass es nicht unter fünf Mark verkauft werden solle.59 Damit signalisierte er eine gewisse Exklusivität. Ende 1891 befanden sich noch 48 Exemplare bei Carl August Klein in Berlin.60
Das Erscheinungsbild dieses Privatdrucks ist von äußerster Schlichtheit. Auf einem Pergamentumschlag steht im oberen Drittel zentriert der Verfassername STEFAN GEORGE in Versalien, der Titel HYMNEN steht in etwas größerem Schriftgrad zentriert in der Mitte, im unteren Drittel der Ortsname BERLIN in etwas kleinerem Schriftgrad als der Name und darunter 1890. Der Innentitel ist gleich gestaltet, wobei Verfassername, Orts- und Jahresangabe einen weniger fetten Druck aufweisen. Die Seitenzählung des Bandes ist eigenwillig. Er besteht aus 26 mattweißen, leicht ins Gelbliche spielenden Büttenpapierblättern mittlerer Stärke. Gezählt ist jeweils nur die rechte Seite, wobei die Zählung beim dritten Blatt einsetzt. Die Zählung erfolgt per Blatt, nicht per Seite, und reicht bis zur Ziffer 25 auf der letzten bedruckten Seite. Ein Inhaltsverzeichnis gibt es nicht. Eine Gliederung der Gedichte erfolgt durch Leerseiten, von denen es bis zu drei aufeinander folgende gibt. Die Überschriften Neuländische Liebesmahle und Bilder, die für jeweils zwei Gedichte gelten, stehen alleine auf einer Seite den Texten voran. Nur diese vier Gedichte beginnen oben auf der Seite, die übrigen vierzehn setzen immer links unten ein, so dass sie wenigstens über zwei Seiten fließen, auch dort, wo eine Seite für ihren Umfang gereicht hätte. Die Schrift ist eine klare schmucklose Antiqua. Ungewöhnlich ist, dass die Gedichte – von den Versanfängen abgesehen – durchgehend Kleinschreibung aufweisen. Nur wenige Worte, außer Eigennamen, sind durch Großschreibung des Wortanfangs hervorgehoben. Das erste, das derart akzentuiert ist, ist die Selbstapostrophe als der „Einsame“ in dem zitierten El Escorial-Gedicht Nachmittag. George greift auch schon in die Orthographie ein, indem er das ‚ß‘ in ‚ss‘ auflöst. Allerdings bleibt das ‚h‘ hier noch in einigen Fällen, wo es später getilgt wird, erhalten. Ungewöhnlich ist das ganze Erscheinungsbild des Bandes allein schon deshalb, weil Gedichtbände in dieser Zeit nicht selten mit aufwendigen Ausstattungen aufwarteten, häufig mit Goldschnitt, mit reich verzierten geprägten Umschlägen, mit verschnörkelten Schrifttypen und diversen ornamentalen Ausschmückungen. Demgegenüber markierten Georges Hymnen in jeder Hinsicht den Gegenentwurf. Sie sind eine programmatische Reduktion aufs Wesentliche, auf den Text.