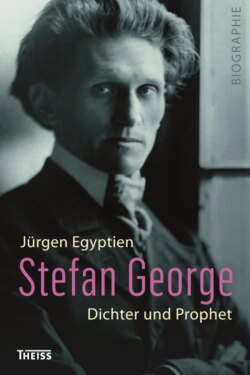Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 16
Freundschaft mit Waclaw Rolicz-Lieder und Werbung um den ‚zwillingsbruder‘ Hofmannsthal
ОглавлениеDie innere Anspannung, von der Edward etwas spürte, brach kurz darauf während Georges Aufenthalt in London aus. Dort hatte er den englischen Dichter Thomas Wellsted aufgesucht, den er bereits bei seinem ersten London-Aufenthalt im Sommer 1888 kennengelernt hatte. Auch ihn dürfte er für seinen Zeitschriften-Plan angeworben haben. Nach nur sechs Tagen reiste George jedoch in großer Erregung wieder ab, nachdem er einen – der Antwort seiner Schwester zufolge – ‚schrecklichen Brief‘ nach Hause geschrieben hatte. George flüchtete nach Paris, weil er sich dort in diesen Jahren am wohlsten fühlte. Er blieb etwa zwei Wochen in Paris und machte eine neue und sehr bereichernde Bekanntschaft, die er vermutlich wiederum dem alten Freund Albert Saint-Paul verdankte. Dieser führte ihn nämlich mit dem polnischen Dichter Waclaw Rolicz-Lieder (Abb. 2) zusammen, der seit 1888 in Paris lebte und an der École des Langues ein Studium der Orientalistik absolvierte. 1893 veröffentlichte er ein Wörterbuch des Arabischen. Rolicz-Lieder war zwei Jahre älter als George und hatte wie dieser Zugang zu Mallarmés exklusivem Dienstagabend-Kreis gefunden. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Gedichtbände in Krakau und einen ebenfalls polnischsprachigen in Paris veröffentlicht. Für diese Veröffentlichungen, die im Nachhinein betrachtet als wesentliche Anstöße für die symbolistische Strömung ‚Jung-Polen‘ gewertet werden können, erntete er nur Hohn und Spott. Rolicz-Lieder reagierte 1892 mit einer kleinen Streitschrift ‚An das polnische Publikum‘, in der er sich über die ‚Unzucht der Zeitungen‘ beschwerte und sich als einen „durch die Warschauer Zensur und die polnische Presse verfemten Dichter“ (RL/G 148f.) bezeichnete. Rolicz-Lieder zog daraus die Konsequenz, seine weiteren Gedichtbände nur noch in einer Stückzahl zwischen zwanzig und sechzig privat drucken zu lassen. Diese Haltung konnte nur Georges unbedingten Beifall finden. Im Dezember 1891 bedankte Rolicz-Lieder sich bei George für die Zusendung von dessen Hymnen. Ihre Bekanntschaft intensivierten die beiden bei Georges nächstem Aufenthalt in Paris im Frühjahr 1892. Es wird wohl in diesen Zeitraum der gemeinsame Gang von Rolicz-Lieder, George und Verlaine über die Boulevards fallen, von dem George später Karl Wolfskehl als Exempel für die Toleranz der Pariser Bevölkerung erzählte. Wolfskehl erinnerte sich später an die Episode: „Lieder und George waren mit ausgesuchter Eleganz gekleidet, auf dem Haupte den Zylinder, und zwischen ihnen schritt – oder humpelte vielmehr – der mehr als nachlässig, beinahe verkommen wirkende Verlaine im berühmten uralten braunen Mantel, in der Hand den Knotenstock, als befremdliche Mitte. Aber keinem der Vorübergehenden kam es in den Sinn, dies merkwürdige Trio zu bestaunen.“ (RB I, 38)
Eine Freundschaft, die zugleich eine Werkgemeinschaft war, entstand ab Mitte 1894, als George daran ging, Gedichte von Rolicz-Lieder zu übersetzen. Insgesamt übertrug er die stattliche Zahl von 32 Gedichten, außerdem ein Prosafragment. Bereits im August 1894 veröffentlichte George fünf dieser Übertragungen in den Blättern für die Kunst.
Die lange Zeit gängige Vorstellung, George habe, wie im Falle anderer Sprachen, auch das Polnische erlernt, um eine ihm wichtige Dichtung in der Originalsprache lesen und aus ihr übersetzen zu können, trifft in diesem Fall sicher nicht zu.81 Wer mit dem Polnischen schon einmal in Berührung gekommen ist, wird bestätigen können, dass für einen Deutschsprachigen mit Kenntnissen früherer deutscher Sprachstufen und des Lateinischen der Spracherwerb hier eine ganz andere Herausforderung bildet als bei vergleichsweise verwandten Sprachen wie dem Italienischen oder Dänischen. Der Vater von Waclaw Rolicz-Lieder, auf den der Namensteil Lieder zurückgeht, stammte aus dem Ermland, einem Teil Ostpreußens, das bis 1945 zum Deutschen Reich gehörte. Rolicz-Lieder sprach daher recht gut Deutsch und fertigte für George Rohübersetzungen ins Deutsche oder deutsche Interlinearfassungen seiner eigenen Gedichte an. Da beide Dichter sehr gut Französisch sprachen, benutzten sie diese dritte Sprache gelegentlich als eine Art Relaissprache, um Missverständnisse oder besondere Verständnisschwierigkeiten auszuräumen. Einige erhalten gebliebene Entwürfe der Übersetzungen zeigen, dass die Handschrift der deutschen Fassungen oft spontaner aussieht als die sorgfältig ausgeführte Interlinearübersetzung. Dadurch entsteht der Eindruck, „dass die deutsche Version hastig aufgeschrieben wurde und vielleicht ein Ergebnis der persönlichen Konsultation bei einem Treffen der beiden Dichter darstellt.“82
Umgekehrt übersetzte Rolicz-Lieder fünfzehn Gedichte Georges ins Polnische. Außer George übersetzte Rolicz-Lieder auch Baudelaire, Gautier, Puschkin und Heinrich Heine ins Polnische. 1897 war er nach Warschau zurückgekehrt und verdiente seinen Lebensunterhalt als Büroangestellter. Er widmete sich sprachwissenschaftlichen Arbeiten, mit denen er ebenfalls wenig Anklang fand. In Polen veröffentlichte er kaum noch neue Gedichte. Er starb 1912.
Georges großes Engagement für Rolicz-Lieder entsprang seiner tiefen Sympathie für den Polen. Er verkörperte für ihn Eigenschaften wie Stolz, Seelenadel, Freiheitsdrang, Ernst und Leidensfähigkeit. Außerdem verfügte Lieder über Diskretion, die George besonders wichtig war. Robert Boehringer überliefert dafür ein Beispiel: „Einmal sah George einen jungen Mann schlafend in Lieders Zimmer, und Lieder sagte, das sei ein polnischer Patriot, dem er auf der Flucht helfe. Das ließ George den Freund noch mehr schätzen.“ (RB 231)
Als sich George im November 1894 in München mit den drei Dichtern Paul Gérardy, Waclaw Rolicz-Lieder und Karl Wolfskehl traf, zeigte sich Letzterer vom inneren Adel und der stolzen Haltung des Polen tief beeindruckt und nannte ihn im Rückblick „eine Gestalt aus den Sagen längst verklungener Tage.“ (RL/G 141) Noch lange nach dem Ende ihres näheren persönlichen Umgangs, der durch Lieders Rückkehr nach Warschau nur noch sporadisch sein konnte, blieb diese adlige Haltung in Georges Erinnerung lebendig. Edgar Salin überliefert eine Situation aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, da er selbst wegen allzu leichtfertiger abwertender Äußerungen über ‚die Slawen‘ von George barsch zurechtgewiesen wurde: „Was ist das für ein alberner Schnickschnack! Mein Freund Waclaw allein reicht aus, um Ihre Phrase zu entlarven. Hätte ich unter Deutschen so viel natürlichen Adel gefunden wie unter Polen und Spaniern, dann müsste ich mir nicht solche Mühe geben, um Euch zu erziehen.“ (ES 261)
Die entscheidende Basis ihrer Freundschaft war natürlich die Dichtung, die Rolicz-Lieder ebenso ‚heilig‘ war wie George. Die gegenseitige Wertschätzung von George und Rolicz-Lieder fand ihren Niederschlag in zahlreichen Widmungen und Widmungsgedichten. Im Andenken an das erwähnte Münchner Dichtertreffen widmete George 1895 seinen vierten Gedichtband Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten gemeinsam ‚Paul Gérardy Wenzeslaus Lieder Karl Wolfskehl‘. Im Jahr der Seele von 1897 findet sich das Widmungsgedicht W. L. mit den Zeilen „schon weil du bist/Sei dir in dank genaht · durch deine hoheit/Bestätigst du uns unser recht auf hoheit/[…] leitstern über jeder edlen fahrt.“ (SW IV, 72) Von den nicht weniger als neun Widmungsgedichten Rolicz-Lieders an Stefan George sei eines aus dem Jahr 1896 zitiert, das sie beide als dioskurenhaftes Dichterpaar imaginiert, das sternenweit von der profanen Welt entfernt ist. Es lautet in Georges und Rolicz-Lieders Tandemübersetzung:
Es schimmerten gleich zwei sternen in frühlingsbläue
Im weltraum unsre beiden leben · Gefährte –
Gleich zwei planeten die über wolken träumen ·
Zwei leben traurige und unerklärte.
Geheimnisse gibt es unter der ewigkeit siegeln:
Dass sterne nach ihrem tode die erde betreten ·
Bevor ihr licht gelangt zu der erde tiefe
Erstarrte oft der eisige tod die planeten.
So ist unser lied voll tönender künstlerhöhe
Verurteilt zu der menschlichen augen truge.
In grabesnähe muss es erst erstöhnen
Eh es die erde berühre mit seinem fluge ·
Da zu hoch oben seine klänge fluten ·
Da menschliche blicke zu schwach sind es zu lesen ·
Da es genährt an der jahrtausende busen
Zu ernst ist für das kindliche erdenwesen.
Einst wenn die trauer unseres sinnens entschlafen
Erblicken die völker zweier sterne schein –
Dies sind dann unsrer entfernten tage strahlen
Die brennen werden über Weichsel und Rhein.
(SW XVI, 93)
Rolicz-Lieder hat das Gedicht in einem Brief an George vom 11. Mai 1896 in seiner astrophysikalischen Bildlichkeit erläutert. Er verglich ihrer beider dichterisches Werk mit entfernten Sternen, deren Licht die Erde erst lange nach ihrem Tod erreichen würde. Ebenso verhielte es sich mit ihren Gedichten. Für die Zeitgenossen seien sie „zu hoch oben“, um bis zu ihnen zu gelangen. Das noch junge „kindliche erdenwesen“ sei noch nicht reif zur Aufnahme dieser Klänge, in denen der Ernst von Jahrtausenden laut werde. So blieben zu ihren Lebzeiten die Geheimnisse ihrer Dichtung versiegelt, und erst nach ihrem ‚eisigen tod‘ könne sie die Erde berühren und den Sinn der Menschen erreichen.
Auch nach Ende der regelmäßigen Zusammentreffen, die in Paris, München, Wien und Bingen erfolgten, ließ George noch bis ins Jahr 1901 Übertragungen von Rolicz-Lieders Gedichten in den Blättern für die Kunst erscheinen und räumte ihm im zweiten Band der Sammlung Zeitgenössische Dichter von 1905 so viel Platz wie keinem anderen ein. Als es 1906 auf einer Deutschlandreise Rolicz-Lieders zur letzten persönlichen Begegnung in Berlin kam, die sie ihre geistige Verwandtschaft erneut spüren ließ, entschied George sich spontan, in die gerade fertig gestellte Druckvorlage seines großen Gedichtbuchs Der Siebente Ring einzugreifen und auf der letzten Seite einen Vierzeiler mit dem Titel Ein Gleiches: An Waclaw einzufügen. Er endet mit den Zeilen „Nun bin ich dankbar dass dies lezte blatt/Doch noch dein ritterlicher schatten quere.“ (SW VI/VII, 187)
Kehren wir zurück in den Herbst des Jahres 1891. Nach dem Aufenthalt in Paris war George unter verschiedenen Adressen einen guten Monat in Berlin. Ende Oktober brach er nach Wien auf und mietete sich in der Garnisongasse 10 ein, wiederum im Bezirk Alsergrund und noch näher an der Universität. Den wichtigeren Ort bildete aber dieses Mal das Café Griensteidl am Michaelerplatz, einer der Hotspots der Wiener literarischen Avantgarde. Hier erwartete George eine Begegnung, die zu den entscheidenden für das kommende Jahrzehnt gehörte, die Begegnung mit Hugo von Hofmannsthal. (Abb. 3)
In zwei Folgen der Modernen Rundschau, dem führenden Organ des Jungen Wien – also der Vertreter der literarischen Moderne wie Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann und Hermann Bahr – war im Herbst 1891 Hofmannsthals lyrisches Drama Gestern unter dem Pseudonym Theophil Morren erschienen. Im selben Jahr hatten Rezensionen und einzelne Gedichte, die unter dem Pseudonym Loris an gleicher Stelle veröffentlicht worden waren, die Aufmerksamkeit der literarischen Öffentlichkeit erregt. Hofmannsthal musste schon deswegen unter Pseudonymen publizieren, weil er zu diesem Zeitpunkt noch Gymnasiast war und es diesen in Österreich untersagt war, mit Veröffentlichungen hervorzutreten. Die wahre Identität von Loris war in Literatenkreisen kein Geheimnis. George dürfte über sie spätestens durch die Übersetzerin Marie Herzfeld aufgeklärt worden sein, an die er sich im November 1891 in Wien gewandt hatte. Sie war ebenfalls Mitarbeiterin der Modernen Rundschau und hat George möglicherweise in Gesprächen über das literarische Leben in Wien auf Hofmannsthals Essay Englisches Leben in einer Dezembernummer hingewiesen. Diese Annahme besitzt eine gewisse Plausibilität, weil Hofmannsthal in diesem Essay in einer Kritik an dem Werk von Laurence Oliphant ex negativo ein poetologisches Programm formulierte, das George als seinen eigenen Bestrebungen verwandt empfinden musste. Hofmannsthal kritisierte nämlich an Oliphant, er schriebe nicht, „um Stimmungen seiner Seele in fein abgetönte und bezeichnende Worte zu kleiden, nicht um subjektive Wahrheiten in prächtigen, bunten Bildern zu offenbaren; – er will nützen, lehren, unmittelbar wirken.“83 Hier begegnen also beim jungen Hofmannsthal Stimmung, sprachliche Nuancierung, subjektive Wahrheit und erlesene Metaphorik als positive Kriterien, didaktische Wirkungsabsicht hingegen als verwerflich. Es leuchtet ein, dass George in Hofmannsthal einen natürlichen Verbündeten im Kampf um eine neue Kunst erkennen musste.
In einem weit zurückblickenden Brief vom 28. Oktober 1922 an seinen Freund Carl J. Burckhardt berichtete Hofmannsthal, dass eines „nachts in einem Stadtcafé im alten Palais Herberstein plötzlich ein unheimlich und gebieterisch aussehender, vielleicht noch sehr junger, vielleicht viel älterer Mensch auf mich zutrat, der Stefan George war und sagte, er suche mich und er sei nur deswegen nach Wien gekommen.“ (G/H 236) Noch in seinem Todesjahr gab Hofmannsthal dem Literaturhistoriker Walther Brecht eine briefliche Schilderung dieser ersten Begegnung mit George im Café Griensteidl. Er schrieb am 20. Februar 1929: „[A]ls ich ziemlich spät in der Nacht in einer englischen Revue lesend in dem Café saß, trat ein Mensch von sehr merkwürdigem Aussehen, mit einem hochmütigen leidenschaftlichen Ausdruck im Gesicht […] auf mich zu, fragte mich, ob ich der und der wäre – sagte mir, er habe einen Aufsatz von mir gelesen, und auch was man ihm sonst über mich berichtet habe, deute darauf hin, daß ich unter den wenigen in Europa sei (und hier in Österreich der einzige), mit denen er Verbindung zu suchen habe: es handle sich um die Vereinigung derer, welche ahnten, was das Dichterische sei.“ (G/H 235)
Die Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelte, spielte sich denn auch in weiten Teilen im Medium der Dichtung ab. Das betrifft sowohl die rezeptive Seite des gemeinsamen Lesens als auch besonders die produktive Verarbeitung ihrer Treffen in Gedichtform. Wie tief die Begegnung mit George auf Hofmannsthal gewirkt hat, bezeugt etwa ein Gedicht, dass er unter dem Eindruck ihrer ersten Gespräche geschrieben und George bereits am 21. Dezember 1891 übergeben hat. Es heißt „Herrn Stefan George – einem, der vorübergeht“ und beginnt mit der Strophe:
du hast mich an dinge gemahnet
die heimlich in mir sind
du warst für die saiten der seele
der nächtige flüsternde wind
(G/H 7)
George war – wie er Hofmannsthal am folgenden Tag schrieb – „tief entzückt“ von diesem „schönen bekenntnis“, schloss aber die Frage an: „aber bleibe ich für Sie nichts mehr als ‚einer der vorübergeht‘?“ (G/H 8)
Man hat aus den beiden Anfangsversen eine Anspielung auf homoerotische Neigungen herauslesen wollen, die in Hofmannsthal latent schlummerten.84 Die Zeugnisse seiner gleichgeschlechtlichen Freundschaften waren in dieser Zeit durchweg von einer spielerischen Erotik gefärbt, ohne jemals die ‚Grenze, wo Sodom beginnt‘ (Leopold Andrian) zu überschreiten. Für Hofmannsthal hat – wie für die modernen künstlerischen Strömungen insgesamt – die Androgynie einen besonderen künstlerischen Reiz besessen. Möglicherweise hat der spielerische Umgang mit dieser Dimension in Hofmannsthals Gedicht George zu weiterreichenden Erwartungen bewogen. In dieser Situation kam es zum Besuch Hofmannsthals in Georges Wiener Wohnung am 24. Dezember 1891. Das Gespräch ging auch diesmal wieder über künstlerische Themen, Hofmannsthal war einiger „Schriftsachen halber“, die George ihm zeigen wollte, zu ihm gegangen. Es dürfte sich um die Oktobernummer der französischen Symbolistenzeitschrift L’Ermitage gehandelt haben, die zwei von Georges Gedichten in der Übersetzung von Albert Saint-Paul enthielt. Es sind Liebesgedichte, und zumindest der Wortlaut des Gedichts Strand ließ auch eine homoerotische Auslegung der geschilderten Liebesbeziehung zu.
Zwei Tage später übersandte George Hofmannsthal ein Gedicht und erhielt im Gegenzug ein Exemplar des Dramas Gestern mit der Widmung „herrn Stefan George in tiefer Bewunderung seiner Kunst“. Gleichzeitig ließ er George mitteilen, er würde Wien über die Festtage verlassen, was jedoch nicht der Fall war. Von dem Gedicht, das George später leicht variiert in den Band Das Jahr der Seele aufnahm, will ich die zweite Strophe zitieren, die auf das „schöne bekenntnis“ mit einem eigenen antwortet und die Bitte um eine Erwiderung enthält.
Du reichst die hand · die segel wehn im porte
Es geht in tollen winden auf ein riff
Bedenke dich und sage sanfte worte
Zum fremdling den dein weiter blick ergriff.
(G/H 10)
Hofmannsthal reagierte auf dieses lyrisch drapierte Drängen nicht mehr offen George gegenüber, sondern durch die Niederschrift des Gedichts Der Prophet, das er – wie es in seinem Tagebuch heißt – aus „wachsender Angst“ und dem „Bedürfnis den Abwesenden zu schmähen“ heraus schuf. Es erschien erstmals 1938 im Anhang zur Erstausgabe des Briefwechsels von George und Hofmannsthal und lautet:
In einer Halle hat er mich empfangen
Die rätselhaft mich ängstet mit Gewalt
Von süssen Düften widerlich durchwallt,
Da hängen fremde Vögel, bunte Schlangen,
Das Tor fällt zu, des Lebens Laut verhallt
Der Seele Athmen hemmt ein dumpfes Bangen
Ein Zaubertrunk hält jeden Sinn befangen
Und alles flüchtet, hilflos, ohne Halt.
Er aber ist nicht wie er immer war.
Sein Auge bannt und fremd ist Stirn und Haar.
Von seinen Worten, den unscheinbar leisen
Geht eine Herrschaft aus und ein Verführen
Er macht die leere Luft beengend kreisen
Und er kann töten, ohne zu berühren.
(G/H 239)
Hofmannsthals Sonett erinnert in seiner exotischen Bildlichkeit an Georges Gedichtband Algabal, der zwar erst im Spätsommer 1892 erschien, dessen Gedichte aber fast alle in der zweiten Jahreshälfte 1891 entstanden sind und daher Hofmannsthal nicht unbekannt gewesen sein könnten. In dem Text manifestiert sich Hofmannsthals ambivalente Haltung George gegenüber, die zwischen die Pole von Faszination und Furcht gespannt ist. Die Begegnung mit dem ‚Propheten‘ ist auf doppelte Weise verfremdet. Sie ist in einer Art Totenreich angesiedelt – „des Lebens Laut verhallt“ – und bekommt durch den „Zaubertrank“ halluzinative Züge. Es ist im übrigen auffällig, dass Hofmannsthal die Begegnung quasi als synästhetisches Erlebnis inszeniert, bei dem alle fünf Sinne von dem gewaltsamen Verführer überwältigt werden: der Geruchssinn durch die „widerlichen düfte“, der Gehörsinn durch das wie eine Gefängnistür zufallende Tor, der Geschmackssinn durch den „Zaubertrank“, der Gesichtssinn durch das bannende Auge und der Tastsinn durch die beengend kreisende Luft, die nicht nur „der Seele Athmen hemmt“, sondern letztlich zu einer Art Erstickungstod in der Aura des fremden Gegenübers, des ‚Propheten‘ führt. Das Sonett gestaltet in einer ästhetisch gelungenen Form die Mischung aus Attraktion und Abstoßung, die Georges Persönlichkeit auf ihn – und nicht nur auf ihn – ausübte. Er vertraute diesen Text allerdings, wie gesagt, nur seinem Tagebuch an, und schwieg mehr als eine Woche nach Empfang von Georges Gedicht.
George wurde daraufhin in der elterlichen Wohnung von Hofmannsthal in der Salesianergasse 12 vorstellig und hinterließ dort eine Nachricht für den Gymnasiasten, der sogar seine Kaffeehausbesuche eingestellt hatte, weil dort „der Symbolist umgeht“.85 George fing ihn allerdings am 6. Januar 1892 am Akademischen Gymnasium in der Lothringerstraße ab und unternahm mit ihm den sogenannten ‘akademischen Spaziergang‘. Einer nicht gesicherten Überlieferung nach habe George durch einen Dienstmann zuvor ein Rosenbouquet an den Schüler Hofmannsthal überreichen lassen. Auch an den Folgetagen wiederholten sich diese Spaziergänge. Schließlich trafen sie sich am 9. Januar wieder im Café Griensteidl, in das Hofmannsthal allerdings in Begleitung des Schriftstellers Felix Salten, des späteren Verfassers von Bambi, kam. Bei dieser Gelegenheit übergab George Hofmannsthal einen umfangreichen Brief, in dem er sehr freimütig über seine Krisensituation und ihre persönliche Beziehung spricht. Ich zitiere eine längere Passage aus diesem Brief, den Hofmannsthal „zurückgeben oder […] sofort vernichten“ sollte.
Lassen Sie sich durch die geheimtuende aussenseite nicht erschrecken! […] Ganz verstehen können Sie zum glück noch nicht da Sie die grosse Trübnis nicht kennen. Sie werden dieselbe noch kennen lernen da Sie ein wahrer künstler sind später – viel später das wünsche ich Ihnen von herzen. Schon lange im leben sehnte ich mich nach jenem wesen von einer verachtenden durchdringenden und überfeinen verstandeskraft die alles verzeiht begreift würdigt und die mit mir über die dinge und die erscheinungen hinflöge · und sonderbar dies wesen sollte trotzdem etwas von einem nebelüberzug haben und unter einem zwang des gewissen romantischen aufputzes von adel und ehre stehen von dem es sich nicht ganz lösen kann […] Jenes wesen hätte mir neue triebe und hoffnungen gegeben (denn was ich nach Halgabal noch schreiben soll ist mir unfasslich) und mich im weg aufgehalten der schnurgrad zum nichts führt. […] Diesen übermenschen habe ich rastlos gesucht niemals gefunden grad so wie jenes Andre unentdeckbare im all.. Das aber raten Sie aus meinen büchern Die grosse seelische krise drohte · Und endlich! wie? ja? ein hoffen – ein ahnen – ein zucken – ein schwanken – O mein zwillingsbruder – · Werden wir wieder vernünftig · das ist vorbei. ich sehe nun deutlicher und ich weiss: In unsren jahren ist die bedeutsame grosse geistige allianz bereits unmöglich Jeder ist bereits in einen gewissen kreis des lebens getreten in dem er hängt […] und wer es in andrer form […] bringen wollte wäre ein eindringling… ich suche zu verbeissen und ich schmähe mich dass ich redete · denn wesshalb? etwa die gemeine beruhigung nachdem man klirrende rasselnde sachen als gläser fenster vasen zerschlagen hat […] Schweigen Sie. Sie sind der einzige der von mir solche bekenntnisse vernahm. Darin bau ich blind auf Sie.“ (G/H 12f.)
George unterschrieb diesen Brief mit Bezug auf das von Hofmannsthal ihm übergebene Gedicht mit der Formel „Einer der vorübergeht“. George spricht hier mit bemerkenswerter Offenheit von einer Produktivitätskrise, die für ihn als Schriftsteller mit einer seelischen Krise verknüpft war. In Hofmannsthal glaubte er nun, einen literarischen und menschlichen Partner gefunden zu haben, der ihm aus dieser Krisensituation heraushelfen könnte. Ja, George ging in seinen Erwartungen an Hofmannsthal sogar so weit, in ihm einen potentiellen „zwillingsbruder“ zu erblicken. Gleichzeitig enthält der Brief aber auch die nüchterne und ernüchternde Einsicht in die doppelte Bindung, der Hofmannsthal unterlag. Trotz seiner knapp achtzehn Jahre war er schon ein eigenständiger Geist, der nicht mehr so umgeprägt werden konnte, geschweige denn wollte, wie George das erhofft hat. Zum anderen zeigte sich aber auch, dass Hofmannsthal anders als George sich seiner gesellschaftlichen Integration nicht ganz begeben wollte. Die radikale antibürgerliche Haltung Georges konnte der Schüler Hofmannsthal sich nicht zu eigen machen – und wird sich auch der spätere Hofmannsthal nie zu eigen machen. Er ist nicht der Typus des poète maudit oder des bindungslosen Vaganten.
Hofmannsthals Antwortbrief zeugt von Irritation und Überforderung. Er sieht in seinem Antwortbrief vom folgenden Tag „keine Schuld und kein Verdienst und keinen Willen der helfen kann, wo Tyche rätselhaft wirkt. Die große Krise soll enden, denn sie will es. will mich Ihr Sinn, der selbst die Wege weiter weiß, mit den Zügen des Heilenden schmücken: er darf wenn er muß und er muß wenn er kann […] aber Sie stehen gerne, wo Ihnen schwindelt, und lieben stolz den Abgrund den wenige sehen können ich kann auch das lieben, was mich ängstet.“ (G/H 14) An diesen Worten wird ein wesentlicher Zug von Hofmannsthal deutlich: einerseits das passive Geschehen-lassen, die Annahme einer Bestimmung durch das Außen, andererseits die Fähigkeit, sich auch Entgegengesetztes assimilieren zu können. Kurt Singer hat in seinem Kommentar zum Briefwechsel nicht zu Unrecht in ihnen den „Ausdruck zweier Grundformen des Dichtertums selbst“86 erkennen wollen, nämlich den Gegensatz zwischen dem bildend-umbildenden, dem gestalterischen Typus, den George verkörpert, und dem allverbundenen, all-eintauchenden, wandlungsfähigen Typus, dem Hofmannsthal angehört.
Angesichts der unentschiedenen Doppeldeutigkeit von Hofmannsthals Antwort drängte George auf ein klärendes Gespräch und fand sich am Abend des 13. Januar bei Hofmannsthal in der Salesianergasse ein. Was sich an diesem Abend zwischen beiden abspielte, lässt sich nur vermuten. Es muss jedenfalls Hofmannsthal zu einem Brief veranlasst haben, der George zutiefst verletzte. Dieser Brief ist nicht erhalten, nur Georges Antwort vom 14. Januar, in der es heißt: „Wenn ich freilich an einen solchen brief gedacht hätte wäre ich am abend nicht zu Ihnen gekommen · eher glaubte ich alles andre annehmen zu müssen Also auf etwas hin und gott weiss welches etwas ‚das Sie verstanden zu haben glauben‘ schleudern Sie einem gentleman der dazu im begriff war Ihr Freund zu werden eine blutige kränkung zu. Wie konnten Sie nur so unvorsichtig sein, selbst jeden verbrecher hört man nach den schreiendsten indizien. Sie sehen ich rede ganz gesezt und wenn Sie nach einigen tagen gelassen denken oder nach jahren so werden Sie mir […] sehr verbunden sein dass ich soviel ruhe bewahrte und nicht sofort das veranlasse was mit Ihrem oder meinem tod endet […] spielen Sie nicht übermütig mit dem leben“ (G/H 15f.). Hofmannsthal reagierte auf diesen Brief mit der panischen Suche nach Beistand. An Hermann Bahr schickte er per Boten folgendes Schreiben: „Der Herr George kommt unaufhörlich in meine Wohnung und schreibt mir Drohbriefe. Meine Eltern sind sehr geängstigt. Ich kann mich doch als Gymnasiast nicht mit einem Verrückten schlagen. Bitte kommen Sie sobald als möglich zu mir!“87 Bahr war jedoch nicht zuhause, so dass Hofmannsthal sich am selben Tag seinem Vater anvertraute, der sogleich an George schrieb und ihn um eine Aussprache über „die unerquickliche Gestaltung seiner [Hugos] Beziehungen zu Ihnen“ bat.88
Was war an diesem Abend geschehen, dass Hofmannsthal glaubte, einen sich distanzierenden, im Ton scheinbar kränkenden Brief schreiben zu müssen, und dass George in seiner Antwort so weit ging, unverhohlen mit einer Duellforderung zu drohen? In einem weiteren Brief vom folgenden Tag spricht George von seiner „zuneigung (die Sie so schmählich auslegten)“ und von dem „schlag“, der ihm jetzt „noch im gesicht brennt“ – kann man also tatsächlich von einer homoerotischen Annäherung an Hofmannsthal ausgehen, derer sich dieser handgreiflich erwehrte? Der Brief, den George am 16. Januar – also zwei Tage später – an Hofmannsthals Vater, der ebenfalls Hugo hieß und Bankdirektor war, schrieb, enthält eine aufschlussreiche literarische Anspielung: „Mögen Ihr hr. sohn und ich uns auch im ganzen leben nicht mehr kennen wollen, […] für mich bleibt er immer die erste person auf deutscher seite die ohne mir vorher näher gestanden zu haben mein schaffen verstanden und gewürdigt – und das zu einer zeit wo ich auf meinem einsamen felsen zu zittern anfing […] Das konnte denn kein wunder sein dass ich mich dieser person ans herz warf (Carlos? Posa?) und habe dabei durchaus nichts anrüchiges gefunden“ (G/H 242). Georges erläuternde Nachbemerkung enthält eine Distanzierung von einer möglicherweise homoerotischen Auslegung seiner Zuneigung, während umgekehrt der Vergleich mit den Figuren Marquis Posa und Don Carlos aus Friedrich Schillers Tragödie Don Carlos diese Bedeutungsschicht aktualisiert. Rieckmann wies darauf hin, dass die Freundschaft zwischen diesen beiden Dramenfiguren „im neunzehnten Jahrhundert von Homosexuellen als erotische Beziehung aufgefaßt und als Code für homoerotisch gefärbte […] Freundschaften verwendet“89 wurde. Als einschlägiges Indiz dafür führt er einen Eintrag im Tagebuch des homosexuellen Dichters August Graf von Platen, dessen sexuelle Devianz Heinrich Heine in seinen Bädern von Lucca auf so indiskrete und denunziatorische Weise auswalzte, an. Platen schrieb nach einer Aufführung von Schillers Don Carlos, die er gemeinsam mit seinem Freund besuchte: „O wie viele, viele Stellen des Don Carlos mahnten mich innig an meine Lage, wie viele Stellen dieses Stücks, worin die Freundschaft keine unbedeutende Rolle spielt. Wie fühle ich alles doppelt an seiner Seite! Mit welchem Vergnügen, mit welcher Sehnsucht sah ich ihn an, wenn mir die Worte Carlos’ oder Posas zu Herzen gingen!“90 Dass George aber auf diese homoerotische Codierung tatsächlich – gerade in einem Brief an Hofmannsthals Vater – hat anspielen wollen, erscheint eher zweifelhaft.
Ob sich zwischen ihm und Hofmannsthal wirklich eine sexuelle Spannung aufgebaut hatte – diese Frage wird weiterhin nur spekulativ beantwortet werden können. Mir scheint, dass George bei dem besagten Besuch in der Salesianergasse Hofmannsthals Freundschaft quasi in einem putschistischen Akt erobern wollte. Ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass George trotz seines Alters von 23 Jahren immer noch keine stabile sexuelle Identität im Sinne einer festen geschlechtlichen Orientierung ausgebildet hatte. In seinem Werk finden sich bis dahin nicht wenige Gedichte, die an Frauen gerichtet sind oder sich mit der Begegnung zwischen dem lyrischen Ich und einem weiblichen Wesen auseinandersetzen. Gleichzeitig kann man beobachten, dass in vielen Gedichten weibliche Sexualität als Gefährdung der eigenen Identität erfahren wird, so wie es überhaupt einen leidenschaftlichen Kampf des Geistes gegen die Leidenschaft der Sinne in ihnen gibt. Man kann für diese Phase von Georges Dichtung und Person von einer Ambivalenz des Erotischen sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass George in dem Moment, da er glaubte, einen ‚Zwillingsbruder‘ gefunden zu haben, der gleich ihm ein ‚Übermensch‘ sei und mit dem er ‚über alle Dinge und Erscheinungen hinwegflöge‘, von einem seelischen Enthusiasmus ergriffen worden ist, der ihn jedes Risiko eingehen ließ. Dagegen, in diesem emotionalen Überschwang so etwas wie ein Coming out sehen zu wollen, spricht alleine schon die Tatsache, dass sich nur zwei Monate später eine Liebesbeziehung zwischen George und Ida Coblenz anbahnte. Man kann bei George beobachten, dass für ihn geistige Nähe und persönliche Bindung eine Einheit bildeten. Hieraus erklärt sich auch ein Stück weit seine intensive Reisetätigkeit. Wo er geistige Nähe zu entdecken glaubte, da wollte er auch körperliche Nähe spüren. Das Geistige, so seine Überzeugung, bedurfte seiner Beglaubigung im Gefühl persönlicher Freundschaft. In diesem Sinne war George ein Dichter des Eros und war das Dichterische zugleich das Erotische. Es ist dabei keineswegs an krud Sexuelles zu denken, vielmehr an ein Verständnis von Eros, wie er in den platonischen Dialogen anklingt.
Die Begegnung mit George hat in Hofmannsthals Frühwerk zahlreiche Spuren hinterlassen. Sie reichen bis in die „Tage schöner begeisterung“, wie George ihr erstes Zusammentreffen im Motto zur Neuveröffentlichung seines Gedichtbands Pilgerfahrten 1898 rückblickend nannte, zurück. Nur Weniges mag hier kurz angedeutet werden. Eine verhüllte Präsenz Georges ist bereits in dem Dramenfragment Der Tod des Tizian zu erkennen, das Hofmannsthal George für das erste Heft der Blätter für die Kunst überlassen hatte. Ein Ergebnis der Gespräche mit George bestand wohl darin, dass Hofmannsthal die ursprüngliche Absicht einer ‚Apotheose der Idee der Vornehmheit‘ durch eine Apotheose der Kunst‘ ersetzt hat. Es ist allerdings auch nicht zu übersehen, dass das Fragment von einer homoerotisch aufgeladenen Atmosphäre erfüllt ist. Die enge Verbindung, die das Fin de siècle zwischen Ästhetizismus und Homoerotik gesehen – oder gezogen – hat, macht sich hier bemerkbar. Die Figur des Gianino etwa, die an Hofmannsthal erinnert, wird ausdrücklich mit mädchenhaften Zügen ausgestattet und teilt ihr Nachtlager mit Tizianello. Es spricht viel dafür, dass der Prolog, kurz nachdem Hofmannsthal den aufgewühlten Brief Georges überreicht bekam, geschrieben wurde, denn in ihm taucht der Schlüsselbegriff ‚Zwillingsbruder‘ wieder auf.
Und aus dem Erker tritt mein Freund, der Dichter.
Und küßt mich seltsam lächelnd auf die Stirn
Und sagt, und beinah ernst ist seine Stimme:
‚Schauspieler deiner selbstgeschaffnen Träume,
Ich weiß, mein Freund, daß sie dich Lügner nennen
Und dich verachten, die dich nicht verstehen,
Doch ich versteh dich, · mein Zwillingsbruder.‘“91
In den Entwürfen zur Fortsetzung des Tod des Tizian, die erst 1982 zugänglich wurden, tritt die genetische Verbundenheit dieses Dramenfragments mit dem ‚Erlebnis George‘ noch deutlicher hervor. Das Gespräch zwischen Gianino und Desiderio ist ein kaum verschleierter Reflex auf Georges Werben um Hofmannsthal und dessen ausweichendes Verhalten. Es ist auffällig, dass Hofmannsthal diesen Teil seines Fragments unterschlug, als er es im Sommer 1892 George für die Blätter für die Kunst überließ. Zuvor hatte er die Publikation des Textes bei der Theater-Revue betrieben und dort den Schlussteil Desiderios Abschied noch bedenkenlos angeboten. Für Georges Zeitschrift muss ihm diese Szene wohl zu verfänglich erschienen sein. Der Dialog zwischen Desiderio und Gianino hat nicht nur das problematische Verhältnis zwischen ihm und George zum Inhalt, er enthält auch direkte Anspielungen auf ihren Briefwechsel und verleiht Desiderio eindeutig Züge Georges. In den Entwürfen wird Desiderio als „der Unverstandene“ und „der Einsame“ bezeichnet und nimmt damit Charakteristika von Georges Selbstverständnis auf, sein sprechender Eigenname weist ihn außerdem als ‚den Begehrenden‘ aus.