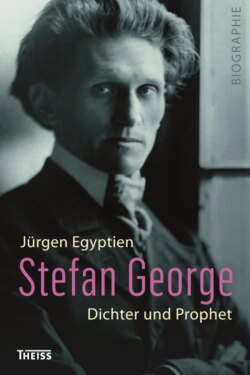Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 15
Im Bann des Ästhetizismus
ОглавлениеGeorge hatte im August Carl Rouge in Bad Kreuznach getroffen und ihm seine neuen Gedichte vorgetragen. Kurz darauf stellte er handschriftlich eine kleinere Sammlung mit zwei Gedichtgruppen zusammen und schickte sie an Rouge, der Ende August mit einem ausführlichen Kommentar reagierte. Dieser Brief enthält auch eine Abschrift, die Rouge von einem Schreiben an Arthur Stahl machte, in dem er auf diese Privatlesung einging. Man kann dieser Passage entnehmen, dass George seiner Rezitation die Erklärung voranstellte, seine Dichtung sei nur für eine bestimmte ‚Sphäre‘ zugänglich, in die man hineingeboren sein müsse. Rouge schreibt dazu an Stahl: „Er scheint eben zu glauben, ohne eine Vorrede ginge es nicht. Er hat nämlich die fixe Idee – oder vielleicht ist es auch mehr als eine fixe Idee – jedes Kunstwerk sei nur für eine bestimmte Sphaere geschaffen, könne nur von dieser richtig gewürdigt werden. Das ist gewiss teilweise ganz richtig, andererseits aber doch wahrscheinlich lächerlich übertrieben, denn wo bliebe da die Kritik? Es wäre vielleicht viel besser gewesen, George hätte mir seine Gedichte ohne jegliche Vorbemerkung zu lesen gegeben, als dass er sie mir mit vielen Praeambeln vorlas, eine Communicationsweise, die vieles verloren gehen lässt.“61 Rouge lässt als das Neue in Georges Gedichten ihre Formvollendung gelten, aber nach der Lektüre der Texte relativiert er ihre Neuheit in stofflicher Hinsicht. Rouge forderte George auf, Arthur Stahl eine Textsammlung zu schicken, da er doch der ‚Sphäre‘ angehören könne. George hatte wohl auch Rouges eigene Zugehörigkeit in Frage gestellt, denn in dem Brief heißt es: „Nun schreibst Du, ich könne nicht ‚mitfühlen in einer Sphaere, die mir unbekannt‘ sei: ich finde wahrhaftig keine unbekannte Sphaere in deinen Gedichten! […] – Ferner protestiere ich recht energisch gegen die Vergleichung mit Voß. Der war ein Pedant (unverzuckerte Pille!). Ich sage dir kurz: Ich werde deine Werke beurteilen nach sich selbst, nicht nach dem, was du darüber sagst.“62 Die folgende Passage aus Rouges Brief mag ein Beispiel für Georges Vergleich seiner Art zu kritisieren mit Johann Heinrich Voß abgeben, der für seine silbenstecherischen Rezensionen in der Zeit um 1800 gefürchtet war. Rouge macht sich hier über das zweiteilige Gedicht Neuländische Liebesmahle her: „Das ‚=ländlich‘ hat gar keinen Zweck, das ‚Liebes=‘ auch nicht – erklären lässt sich freilich schließlich alles! Ferner in der 1. Zeile: ‚rauche‘ ist falsch: Man beträufelt doch nicht mit einem Rauch. – Den ‚Melodienstrom‘ in der 2. Strophe glaube ich schon sonst wo gehört zu haben. Schwerlich könntest Du deutlich sagen, was Du dabei gewollt. Die pars pro toto ‚flechten‘ und ‚haar‘ kommen mir nicht sehr poetisch vor, besonders, wenn sie den ‚einklang stören!‘ Warum ferner ‚blonder‘ Wirbel? Und wer von den Eingeweihtesten der Eingeweihten, wer aus der höchsten und innersten Sphaere wird (wenn sich nicht der Dichter dazu versteht, die Erklärung an den Rand zu schreiben oder drucken zu lassen), wer von ihnen, frage ich, wird von selbst die letzte Zeile des Gedichts enträtseln, wer wird mir sagen, wer die ‚Wissensvolle‘ ist, warum ‚und‘?“63 Nicht zu Unrecht charakterisiert Rouge zusammenfassend die Dinge, die ihn an Georges Gedicht stören, als „romaneske Velleitäten“, womit er die Herkunft dieser Stilmerkmale auf Georges Kontakt zum französischen Symbolismus zurückführen will.
Rouges Stilkritik führte bei George zu der Erkenntnis, dass er sich in seiner dichterischen Entwicklung so weit entfernt hatte, dass eine produktive Verständigung nicht mehr möglich war. In einem Briefentwurf an Rouge vom Herbst 1890, in dem er auf den zitierten Brief antworten wollte, schrieb George: „Und nun vergiss – ich bitte Dich – was ich jüngst dir schrieb als lezte wirre unweise übergangsnote zu klängen in denen ehmals wir uns verstanden. Sie werden nicht mehr kommen. […] Denn auf dem was Dir schlecht ist will ich ja weiterbauen dein gutes als kindlich abstreifen für und für. Und des mannes vollendung in der kunst wird hiernach streben: So sei sein werk dass du es tadelst vom ersten laut bis zum lezten laut. Wie verloren also Deine hinweise besserung und vor allem mühe.“64 George verzichtete wohl darauf, diesen Brief an Rouge zu senden, da er sich dazu entschlossen hatte, einen an Rouge und Stahl zugleich adressierten ‚Absagebrief‘ zu schreiben. Diesen Brief von Ende Oktober 1890 kann man als Abschiedsbrief von der eigenen Jugend und den Jugendfreunden interpretieren. Er beginnt mit den Worten: „Liebe – ehmals – freunde! Ihr seid geblieben wie Ihr wart, was Ihr macht machten wir schon ebenso vor einigen jahren Euch muß ich also nicht erforschen Als ich aus England zurückkam erinnert Euch begann ich eine umwälzung durchzuringen Wenn ich nun sage […] ich suche andere bahnen wie kann geringer Eure aufgabe sein als: hören denken fragen? Freilich ist es ja des haufens deckmantel belachung und verdammung, die mühe zu überlegen ist zu groß, das kann man dem haufen ja auch nicht zumuten – aber freunden? Ich bleibe Eurem andenken treu.“65 Hier spricht sich erstmals ein Selbstbewusstsein aus, das in geradezu rücksichtsloser Weise persönliche Beziehungen in dem Moment aufzukündigen für notwendig und legitim hält, da sie künstlerisch fruchtlos geworden sind. Der Begriff ‚Eure aufgabe‘ ersetzt ein partnerschaftliches Verhältnis durch das Angebot eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Hier kündigt sich also eine Haltung an, die uns später als Organisationsform des George-Kreises noch beschäftigen wird. Auch klingt in der Wendung vom ‚erforschen‘ ein gewisser Stolz auf seine inzwischen geknüpften Verbindungen mit der avancierten zeitgenössischen Literatur an.
George hatte sich in den zurückliegenden Monaten um die Intensivierung dieser Kontakte weiter bemüht. Nach dem Berliner Sommersemester 1890, in dem er die Fortsetzung von Toblers Vorlesung über die historische Syntax des Französischen, die Neufranzösischen Übungen von Stefan Waetzoldt und die Lehrveranstaltung über literarische und historische Kritik des schon hochbetagten Theologen und Philosophen Eduard Zeller besucht hatte, brach George im Juli zu einer Reise nach Kopenhagen auf. Möglich, dass er auf Grund seines Interesses an Ibsen den skandinavischen Kulturraum kennenlernen wollte. In Kopenhagen kam er in flüchtige Berührung mit Stanislaus Rozniecki, der ihn auf Jens Peter Jacobsen, den Verfasser von Niels Lyhne, hinwies. 1893 veröffentlichte George drei Gedichte von Jacobsen in den Blättern für die Kunst in eigener Übertragung.
Im August traf George wieder in Paris ein, wo er sich bis Ende September aufhielt und wo die letzten sechs Gedichte der Hymnen entstanden. Zu ihnen gehört auch das Gedicht Fra Angelico, das George Albert Saint-Paul in einer Handschrift widmete. Der Anlass für die Widmung dürfte darin bestanden haben, dass Saint-Paul ihn auf ihren gemeinsamen Exkursionen durch Paris auch in den Louvre geführt hatte, denn Saint-Paul erinnerte sich: „Eines Tages führte ich ihn in den Louvre. Der Saal der frühen Italiener begeisterte ihn. Giotto, Mantegna, Fra Angelico entzückten ihn durch den Ausdruck ihres kindlich-idealen Strebens, bestrahlt von so lebendigem und klarem Licht, als wäre es erst gestern gemalt. Wir blieben lange in diesem Saal, der, wie ich glaube, damals für ihn allen Reichtum des Louvre in sich begriff. Er sprach mir an den folgenden Tagen wiederholt davon; er kehrte dorthin zurück, und eines Abends las er mir ein Sonett vor, dass er mir widmete und dessen Eingebung er Fra Angelicos Krönung der Jungfrau verdankte.“66
Es lässt sich bei George von jeher ein vitales Interesse an der Bildenden Kunst feststellen, sowohl an der Malerei und Zeichenkunst als auch an der Plastik. Dabei ist allerdings auffällig, dass sein Geschmack ihn auf diesen künstlerischen Gebieten bereits in jungen Jahren in einem eher distanzierten Verhältnis zu den aktuellen Tendenzen zeigte. Als er 1889 erstmals nach Paris kam, führte ihn der Zufall im Hôtel des Américains nicht nur mit Albert Saint-Paul, sondern auch mit dem Maler Paul Herrmann zusammen, der George für die impressionistischen Maler Manet, Monet und Renoir zu begeistern versuchte. Damit erlitt Herrmann jedoch kompletten Schiffbruch. Er musste feststellen, dass George diese Maler ablehnte, weil er in ihnen Repräsentanten des bürgerlichen Zeitalters sah und in ihren Werken nur eine ‚Auflösung der Kunst‘ erkennen konnte.67
Als George sich im Frühjahr 1891 erstmals in München aufhielt, empfahl ihn die Inhaberin der Pension, in der er sein Quartier hatte, einer distinguierten Dame „als den nach ihrer Ansicht besten Betreuer ihrer Tochter“, die gleichfalls dort wohnte. Diese Tochter, in der man das Modell der ‚Schwarzen Madonna‘ eines Gedichts aus den Pilgerfahrten sehen kann, erzählte, „dass sie sehr häufig in der Begleitung d[es] M[eister]s., der damals ausserordentlich elegant auftrat, wie auch sie, die Pinakothek […] aufsuchte und die Schack-Galerie, und dass d. M. besonders die Gemälde von Dirk Bouts, Memling, Angelico und Böcklin gezeigt habe.“68
Über drei der Genannten hat George selbst geschrieben, denn neben dem Fra Angelico-Gedicht gibt es sein späteres Zeitgedicht Böcklin und kleine Prosatexte über eine Pietà Böcklins und über Schmucktrachten auf zwei Gemälden von Dirk Bouts. Die Prosatexte gehören zu einer 1893/94 entstandenen Gruppe, die auch Texte über Radierungen von Maximilian Klinger sowie Gemälde von Cimabue und Quentin Massys umfasst. Man kann diesen kleinen Zyklus als „Wahrnehmungs- und Beschreibungsübung“ verstehen, wobei George den Schwerpunkt „auf die sprachliche Wiedergabe der Farbe und dekorativer Details“ legt, während alle Handlungsmomente des Dargestellten ausgeblendet werden. Der Kunstwissenschaftler Michael Thimann charakterisiert Georges Umgang mit den mittelalterlichen Werken folgendermaßen: „Ganz dem Ästhetizismus des Fin de siècle scheint die Vernachlässigung des ikonographischen Gehalts geschuldet, wodurch das Kunstwerk aus entfernter Vergangenheit rein ästhetisch wahrgenommen wird, ohne es in seinen historischen Bedingungen zu verorten.“ (GHb II, 557) Bei Klinger hingegen betone George den Stimmungsgehalt des „für die Jahrhundertwende typischen ennui“, während er an Böcklin „die Vitalität seiner mythopoetischen Schöpfungen“ (GHb II, 560) schätze, mit der er „die antike Welt der nackten Leiber in die prüde Kultur der Gründerzeit brachte.“ (GHb II, 553) Hinzu kam, dass George in Böcklins Umsiedlung nach Italien eine Abwendung von der Verhässlichung der modernen deutschen Gesellschaft sah und die Flucht in eine Kultur, in der die Idee reiner Schönheit mehr Anklang fand. Wenn mit Ästhetizismus und ennui Stichworte fallen, die für die zeitgenössische Kunst kennzeichnend sind, ist es doch auffällig, dass es im Unterschied zur Literatur bei George so gut wie keine direkte Verbindung zur symbolistischen Malerei gab. 1894 nahm er zwar eine Schwarz-Weiß-Reproduktion des Pastells Mit Georges Rodenbach. Eine tote Stadt des belgischen Symbolisten Fernand Khnopff, das von seinem Stimmungsgehalt her den Roman Die tote Stadt (Bruges – la Morte) von Georges Rodenbach präludierte, in die seltenen Bildbeilagen der Blätter für die Kunst auf, aber das blieb eine Ausnahme. Zudem ist dieses Bild weit entfernt von den ästhetischen Provokationen in Khnopffs symbolistischen Hauptwerken mit ihren Hybridwesen, etwa in seinen Liebkosungen.
Natürlich konnte George der symbolistischen Kunst noch nicht in den Museen von London, Mailand, Madrid und selbst nicht in Paris begegnen. Aber es ist schon seltsam, dass er in Paris offenbar keine Verbindung mit den Malern des Symbolismus suchte. Das ist auch deswegen erstaunlich, weil so gut wie alle seiner Pariser Dichterfreunde dem Maler Gustave Moreau huldigten und ihm ihre Veröffentlichungen und Zeitschriften mit verehrungsvollen Widmungen zuschickten. Nicht wenige ließen sich auch in ihrer poetischen Produktion von Moreaus Bildmotiven inspirieren. Moreau nahm auf dem Gebiet der Malerei den gleichen Rang ein wie Mallarmé in der Literatur. Gerade zwischen diesen beiden bestand eine geistige Verwandtschaft, die sich zum Beispiel in der intensiven Beschäftigung mit dem biblischen Stoff um Salomé und ihre Mutter Herodias manifestierte. Dieses Interesse teilte auch der junge Stefan George. Unter seinen eher wenigen Übertragungen aus dem Werk von Mallarmé nimmt diejenige aus seiner Herodiade eine besondere Stellung ein.
Der 1842 geborene Stéphane Mallarmé bildete von der Generation her die Brücke zwischen der Gründerfigur Charles Baudelaire und der Mehrzahl der symbolistischen Autoren, mit denen der gerade 20-jährige George 1889/90 in Kontakt kam. Mallarmé hatte schon als Jugendlicher gedichtet, 1861 entdeckte er Baudelaires Fleurs du mal, die ihn stark beeindruckten. In der bedeutenden Anthologie der Autorengruppe ‚Parnasse‘ war Mallarmé 1866 mit zehn Gedichten vertreten, woraufhin Paul Verlaine seine Bekanntschaft suchte, 1872 lernte er Arthur Rimbaud kennen und ab 1877 versammelte Mallarmé an seinen Dienstagabenden in der Rue de Rome französische und ausländische Dichter um sich. 1894 wurde er, der im zivilen Beruf Englischlehrer gewesen war, pensioniert und zog sich nach Valvins zurück, wo er am 9. September 1898 starb.
Mitte der 1860er Jahre hatte er mit seinem Herodiade-Projekt begonnen, einer dialogischen Dichtung, die den biblischen Salomé-Stoff zum Ausgangspunkt nahm. Herodias ist im Neuen Testament die Mutter der Salomé, die dieser eingibt, als Lohn für ihren Tanz das Haupt von Johannes dem Täufer zu verlangen. Schon zu dieser Zeit betonte Mallarmé, dass es ihm darauf ankomme, mit dem Gedicht vor allem das Musikalische und das Malerische der Sprache zur Geltung zu bringen. 1876 erschien der von dem impressionistischen Maler Édouard Manet illustrierte Gedichtband Nachmittag eines Fauns (L’après-midi d’un faune). Aus diesen beiden Werken übersetzte George wohl bereits bald nach seiner persönlichen Bekanntschaft mit Mallarmé.
Trotz Georges häufiger Aufenthalte in Paris kam es erst wieder 1896 zu einer persönlichen Begegnung. Gleichwohl gelang es George, den wichtigen Kontakt zu Mallarmé aufrecht zu erhalten. Mit besonderem Stolz erfüllte es ihn, seine Hymnen gleich nach Erscheinen im Dezember 1890 nach Paris zu schicken. Es ist dabei typisch, dass er sie nicht auf direktem Postweg in die Rue de Rome schickte, sondern das Mallarmé zugedachte Exemplar, dem eine Visitenkarte mit den Worten ‚A Monsieur Stéphane Mallarmé un auteur étranger mais daignez familier‘ beilag, durch den gemeinsamen Freund Albert Saint-Paul überreichen ließ. Wo immer es ging, wählte George den persönlichen Weg. Mallarmé dankte ihm brieflich Ende Februar, lobte besonders den Titel und bestätigte George, dass er „einer der Unsrigen und von heute“ sei.69 Knapp anderthalb Jahre später schrieb George Mallarmé wegen der Absicht an, Übersetzungen aus seinem Werk in den geplanten Blättern für die Kunst zu präsentieren (vgl. G/M 89). Mallarmé war damit gerne einverstanden, sofern die Übersetzung von George selbst stamme. So enthielt der zweite Band vom Dezember 1892 Übertragungen aus einem Prosatext und ein Gedicht, wofür sich Mallarmé im Februar 1893 bedankte. Gleichzeitig lobte er die im selben Band befindlichen Gedichte aus Georges Algabal, die ihm, „obwohl ich sie schlecht in einer mir nicht bekannten Sprache entziffere, rein intuitiv sogleich vertraut vorkommen.“ (G/M 91) Auch auf andere Zusendungen Georges reagierte Mallarmé mit ähnlich würdigenden Formulierungen, wenn er aus der Verlegenheit der Sprachunkenntnis heraus seine Zuflucht beim Lob der „gebieterisch sichtbare[n] Melodie“ (G/M 92) oder der Empfindung der „höchsten bildnerischen Musik“ (G/M 95) nahm. Immerhin war Mallarmé von Georges Dichtung und seinem Unternehmen der Blätter für die Kunst so beeindruckt, dass er 1895 in einer Stellungnahme zu den Kulturbeziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im Mercure de France diese Zeitschrift namentlich erwähnte. Persönlich trafen sich George und Mallarmé erst wieder im März 1896, als George vor Beginn der Dienstagabend-Runde in die Rue de Rome kam und seinen Plan eines ‚Albums‘ mit Übersetzungen der zeitgenössischen französischen Dichtung vortrug. Bei dieser Gelegenheit dürfte George von den eintreffenden Gästen auch Paul Valéry kennengelernt haben. Im folgenden Jahr gehörte George dann als einziger Deutscher zu den 23 Beiträgern einer Gabe zu Mallarmés 55. Geburtstag, die aus einer olivfarbenen Dichter-Mappe bestand. Jeder der Beteiligten steuerte ein handschriftliches Gedicht bei, George übersetzte zu diesem Anlass Mallarmés Erscheinung (Apparition) ins Deutsche. Im Januar 1898 besuchte George zusammen mit den bildenden Künstlern Melchior Lechter und Paul Herrmann ein letztes Mal Mallarmé, der im September desselben Jahres verstarb.
Noch 1905 veröffentlichte Stefan George seine Umdichtung der Mallarméschen Herodias in bibliophiler Ausstattung von Melchior Lechter. Die darin mehrfach ausgesprochene Insistenz auf dem Alleinsein, auf einer Art existentiellem Noli me tangere passte zu Georges Anspruch auf Exklusivität. Wenn die unnahbare ‚Schlange‘ Herodias ‚im Schrecken leben‘ will, den ihr Haar ihr bereitet, changieren ihre Züge ins Medusahafte. Nicht zu übersehen sind auch die Übergänge ihres Körpers ins Anorganische. Ihr Auge vergleicht sie einmal einem Kleinod, also einem Edelstein, und ihr Blick wird explizit als ‚klarer demantblick‘ bezeichnet. Ihr Haar besitzt nicht etwa nur einen metallischen Glanz; es wird von Metall in ein starres Wallen gebracht, das heißt, man darf sich ein Ensemble von metallischem Haarschmuck wie Diadem, Reif, Spange oder Fibel vorstellen. Alle Elemente ihrer Beschreibung und ihr ganzes Gebaren und Sprechen stehen im Dienst einer paradoxen keuschen Todeslust, einer eigenartigen Mischung aus Reinheit und Grausamkeit. Damit entspricht Mallarmés Herodias-Gestalt in wesentlichen Aspekten Georges Algabal aus dem gleichnamigen Gedichtband von 1892, der seine am weitesten gehende Annäherung an einen sich der Dekadenz öffnenden Symbolismus markiert.
Auch wenn George sich in seiner Entwicklung seit Mitte der 1890er Jahre zunehmend von der symbolistischen Dichtung entfernte, blieb ihm die Begegnung mit ihr in Paris immer eine besonders wichtige Station auf seinem eigenen Weg. Noch in seinem 1907 erschienenen Gedichtband Der Siebente Ring setzte er ihr ein Denkmal mit seinem Gedicht Franken:
Es war am schlimmsten kreuzweg meiner fahrt:
Dort aus dem abgrund züngelnd giftige flammen ·
Hier die gemiednen gaue wo der ekel
Mir schwoll vor allem was man pries und übte ·
Ich ihrer und sie meiner götter lachten.
Wo ist dein dichter · arm und prahlend volk?
Nicht einer ist hier: Dieser lebt verwiesen
Und Jenem weht schon frost ums wirre haupt.
Da lud von Westen märchenruf ‥ so klang
Das lob des ahnen seiner ewig jungen
Grossmütigen erde deren ruhm ihn glühen
Und not auch fern ihn weinen liess · der mutter
Der fremden unerkannten und verjagten ‥
Ein rauschen bot dem erben gruss als lockend
In freundlichkeit und fülle sich die ebnen
Der Maas und Marne unterm frühlicht dehnten.
Und in der heitren anmut stadt · der gärten
Wehmütigem reiz · bei nachtbestrahlten türmen
Verzauberten gewölbs umgab mich jugend
Im taumel aller dinge die mir teuer –
Da schirmten held und sänger das Geheimnis:
VILLIERS sich hoch genug für einen thron ·
VERLAINE in fall und busse fromm und kindlich
Und für sein denkbild blutend: MALLARMÉ.
Mag traum und ferne uns als speise stärken –
Luft die wir atmen bringt nur der Lebendige.
So dank ich freunde euch die dort noch singen
Und väter die ich seit zur gruft geleitet …
Wie oft noch spät da ich schon grund gewonnen In trüber heimat streitend und des sieges Noch ungewiss · lieh neue kraft dies flüstern: RETURNENT FRANC EN FRANCE DULCE TERRE.
(SW VI/VII, 18f.)
Die letzte Zeile zitiert aus dem hochmittelalterlichen Chanson de Roland, die letzten beiden Zeilen der ersten Strophe spielen wohl auf den nach Italien geflüchteten Böcklin und auf Nietzsche an.
Von seinem zweiten Pariser Aufenthalt kehrte George Ende September 1891 mit einer Zwischenstation im Bingener Elternhaus zu seinem letzten Semester an der Friedrich-Wilhelms-Universität nach Berlin zurück. Er belegte im Wintersemester 1890/91 wiederum bei Stefan Waetzoldt eine Lehrveranstaltung zu Victor Hugo, besuchte die ‚Kunstgeschichtlichen Übungen‘ von Carl Frey und nahm an einer Einführung in die ‚Moderne italienische Literatur‘ des Lektors Giuseppe Rossi teil. Es ist vorstellbar, dass George bei ihm erstmals den Namen Gabriele d’Annunzio hörte. D’Annunzio hatte sich seit Mitte der 1880er Jahre mit mehreren Gedichtbänden und seinen ersten Romanen als Vertreter eines formbewussten Ästhetizismus positioniert. George konnte bei ihm sowohl auf die Beherrschung der Form stoßen, wie er sie bei den Parnassiens und den Symbolisten kennengelernt hatte, als auch auf Themen wie das Ringen mit der Sinnlichkeit und die Gefährdung der Unschuld. Jedenfalls beschaffte Klein ihm im Sommer 1892 eine italienische Zeitschrift, die Gedichte d’Annunzios enthielt. George war von ihrem Ton sofort gefesselt. Schon als Schüler hatte er sich für die italienische Sprache begeistert und sie sich selbst beigebracht. Ein Motiv mag darin bestanden haben, die Gesänge (Canzoniere) des Petrarca im Original lesen zu können. Die Beschäftigung mit Petrarca stand für George zum einen im Zusammenhang mit der Aneignung der Sonettform.70 Zum anderen fand er in Petrarcas Dichtung das Motiv der Berufung zum Dichter durch eine himmlische Geliebte, die ein zukünftiges Zusammenleben im Jenseits in Aussicht stellt. Im März 1889 hatte George auf seiner ersten Italienreise ein Sonett Petrarcas nachgedichtet, in dem dieses Motiv im Mittelpunkt steht.
Die Gedichte, die Stefan George von d’Annunzio übersetzte, entstammen alle dem von 1891 bis 1893 entstandenen Zyklus Poema Paradisiaco. Noch bevor dieser Band 1893 erschien, veröffentlichte George fünf Übertragungen daraus in seiner Zeitschrift Blätter für die Kunst. D’Annunzio war von Georges Übertragungen so angetan, dass er sich über Dritte bemühte, ihn dazu zu bewegen, dass er sein Drama Francesca da Rimini übersetze, aber George tat das nicht. Zu einer persönlichen Begegnung kam es zwischen ihnen nicht, wohl aber zu einem Austausch von Widmungsexemplaren. Später distanzierte sich George von d’Annunzios Werk und äußerte gegenüber Edith Landmann 1926 sogar mit Blick auf d’Annunzios langjährige Geliebte, die international berühmte Sängerin Eleonora Duse: „Sie war nicht so Phrase wie ihr Dichter.“ (EL 162)
Am 26. März 1891 erfolgte Georges Exmatrikulation. Da ist er aber schon lange nicht mehr in Berlin. Im Februar war er zu seinem Bruder Fritz nach München aufgebrochen und schrieb an Gedichten seines zweiten Bändchens mit dem Titel Pilgerfahrten. Es wurde wie die Hymnen als Privatdruck mit dem gleichen äußeren Erscheinungsbild gestaltet und umfasste 21 Gedichte, die sich in vielen Fällen Reisestationen des ersten Halbjahrs 1891 zuordnen lassen. Gedruckt wurden die Pilgerfahrten in Lüttich bei Vaillant-Carmanne, wo auch Albert Mockels Zeitschrift La Wallonie hergestellt wurde. Auch dieses Mal gibt es kein Inhaltsverzeichnis und erfolgt eine Gliederung der Texte durch den Einschub von Leerseiten. Allerdings wird nun jede Vorder- und Rückseite gezählt, so dass der Text bis zur Seite 44 läuft. Auch die Platzierung der Texte fällt konventioneller aus, indem nur noch in drei Fällen das Gedicht links unten beginnt. Dafür lässt George die Gedichte mit einer Initiale einsetzen. Als Erscheinungsort gibt der Umschlag nicht Lüttich, sondern Wien an. Das ist darauf zurückzuführen, dass George von München aus seinen Weg mit einem Schlenker durch Oberitalien nach Wien fortgesetzt hat. Wiederum meldet er sich fast unmittelbar nach dem Eintreffen an seinem Zielort zuerst bei seinen Eltern. Als erstes Quartier hat George eine Familienpension in der Wasagasse 11 gewählt, nicht weit von der Universität im neunten Wiener Gemeindebezirk Alsergrund. Er freut sich darüber, hier ähnlich wie in London sofort Anschluss an die Gastleute gefunden zu haben. „Sosehr ja die freie einsamkeit – ich meine das fürsichsein – seine vorzüge hat in diesem fall wäre sie trostlos. ich bin zufrieden mit meiner wahl für die drei tage die ich hier bin scheint es unglaublich dass ich mich bereits heimisch fühle. In einer so feinen familie bei so feinen tischgenossen die sehr taktvoll es den fremden gar nicht merken lassen dass er ein fremder ist.“71 Im April wohnte George in der Liechtensteinstraße, Mitte Mai zog er in die Harmoniegasse um, die jene mit der Wasagasse verbindet. George blieb länger als ein Vierteljahr in Wien. Neben der Arbeit an den Pilgerfahrten ist er mit den Baudelaire-Übertragungen beschäftigt, die in 25 zinkographierten Exemplaren in Kleins Handschrift im Dezember an Freunde verteilt werden. Außerdem verbrachte George die Zeit bis Anfang Juli mit intensiven Studien in der Wiener Universitätsbibliothek, wenn er sich auch nicht dort inskribierte.
Man kann anhand seiner erhaltenen Exzerpte und Notizen sein Ringen um die Klärung ästhetischer Grundsatzfragen nachvollziehen. Ein Schwerpunkt war das Studium der deutschen Romantik. Sie kann für George wie die französischen Symbolisten gleichermaßen als Bezugspunkt betrachtet werden. Die literaturgeschichtlichen Vermittlungsprozesse sind hier recht kompliziert. Die französische Romantik hatte sowohl weltanschaulich als auch in ihren literarischen Techniken einen völlig anderen Charakter als die deutsche. Daher gelangte das dichtungstheoretische Denken eines deutschen Romantikers wie Novalis erst auf dem Umweg über den Amerikaner Edgar Allen Poe, dessen Werk von Baudelaire übersetzt wurde, in den französischen Sprachraum.72 Die intertextuelle Verflechtung, die auf diesem Weg zwischen der deutschen Romantik, dem französischen Symbolismus und Georges Frühwerk entstand, will ich wenigstens an einem Fall demonstrieren, der häufig als Beispiel für Georges Abhängigkeit von Baudelaire angeführt worden ist. Es handelt sich um das erste Gedicht aus dem Zyklus Im Unterreich aus dem 1892 in Paris in 100 Exemplaren erschienenen Gedichtband Algabal, dessen Texte wohl weitgehend im Sommer 1891 – also zur Zeit der Baudelaire-Übertragungen und des Romantik-Studiums – entstanden sein dürften.
Heliogabal – oder auch Algabal – gehörte zu den Lieblingsgestalten der symbolistischen Literatur. Die historische Gestalt des spätrömischen Kaisers galt als Inkarnation von Prunksucht, Dekadenz und Exzentrik, Algabal war zugleich aber auch ein Virtuose der Selbstinszenierung, ein Transsexueller und agierte jenseits aller Moral, kurzum er eignete sich als Ikone des Ästhetizismus, zu der ihn besonders Huysmans Romanheld des Esseintes formte. Algabal fungierte dort als Vorbild für die radikale Autonomie der künstlerischen Fantasie. Daher exponiert Georges Algabal ihn in genau dieser Rolle.
Ihr hallen prahlend in reichem gewande
Wisst nicht was unter dem fuss euch ruht –
Den meister lockt nicht die landschaft am strande
Wie jene blendend im schoosse der flut.
Die häuser und höfe wie er sie ersonnen
Und unter den tritten der wesen beschworen
Ohne beispiel die hügel die bronnen
Und grotten in strahlendem rausche geboren.
Die einen blinken in ewigen wintern ·
Jene von hundertfarbigen erzen
Aus denen juwelen als tropfen sintern
Und flimmern und glimmen vor währenden kerzen.
Die ströme die in den höheren stollen
Wie scharlach granat und rubinen sprühten
Verfärben sich blässer im niederrollen
Und fliessen von nun ab wie rosenblüten.
Auf seeen tiefgrün in häfen verloren
Schaukeln die ruderentbehrenden nachen ·
Sie wissen auch in die wellen zu bohren
Bei armige riffe und gähnende drachen.
Der schöpfung wo er nur geweckt und verwaltet
Erhabene neuheit ihn manchmal erfreut ·
Wo ausser dem seinen kein wille schaltet
Und wo er dem licht und dem wetter gebeut.
(SW II, 60)
Dieses Eröffnungsgedicht des Algabal scheint wesentliche Motive von Baudelaires Gedicht Traum in Paris (Rêve Parisien) aus den Fleurs du mal aufzugreifen. Es ist ein recht langes Gedicht, aus dem hier nur die Georges Text am nächsten stehenden Strophen zitiert seien. Da George dieses Gedicht interessanterweise nicht übersetzt hat, greife ich auf die Übersetzung von Carlo Schmid zurück.
Der Schlaf ist mächtig Wunderland!
Von einer Laune Spiel betört
Hab ich aus dieser Schau verbannt
Was lebt und drum nicht hingehört,
Und, Maler stolz ob meiner Kunst,
Genoß in meinem Bild ich all
Das Einerlei aus Rausch und Brunst
Von Wasser, Marmor und Metall.
Aus Treppenbogen wuchs ein Bau,
Mein Babel, auf zu weitem Schloß,
Wo Wasserkunst aus reichem Stau
In Flut von mattem Golde schoß;
Und Katarakte hingen schwer Wie Schleiertücher von Kristall In einem Funkelfeuermeer An Mauerzinnen aus Metall.
[…]
Baumeister meiner Fabelwelt
Führt ich, wie es mein Wunsch befahl,
Gezähmten Ozean zum Belt
Durch Bogengänge von Opal.
Und alles, selbst das Schwarze, schien
Vielfarbenflimmernd, hell, poliert;
Das Flüssige fand seinen Sinn
Im Strahl, der sich kristallisiert.73
So offenbar die Übereinstimmungen zwischen beiden Gedichten sind, wäre es doch ein Kurzschluss, dasjenige Georges nur in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Baudelaires zu sehen. Für die Bildlichkeit beider Gedichte könnte man mit guten Gründen auf zwei Stellen in Novalis‘ Romanfragment Heinrich von Ofterdingen zurückgehen, wo im fünften Kapitel der Einsiedler, der im Innern eines Berges lebt, von seinen Reisen erzählt: „An manchen Orten sah ich mich, wie in einem Zaubergarten. Was ich ansah, war von köstlichen Metallen und auf das kunstreichste gebildet. In den zierlichen Locken und Ästen des Silbers hingen glänzende, rubinrote, durchsichtige Früchte, und die schweren Bäumchen standen auf kristallenem Grunde, der ganz unnachahmlich ausgearbeitet war. Man traute kaum seinen Sinnen an diesen wunderbaren Orten, und ward nicht müde diese reizenden Wildnisse zu durchstreifen und sich an ihren Kleinodien zu ergötzen.“74 Noch enger ist vielleicht der Bezug auf den Beginn des Kunstmärchens, das der Zauberer Klingsohr erzählt. Er schildert dort einen Palastgarten, der „aus Metallbäumen und Kristallpflanzen bestand, und mit bunten Edelsteinblüten und Früchten übersäet war.“75
Zu diesen Korrespondenzen auf dem Gebiet der Bildlichkeit und der literaturhistorischen Verknüpfungen kam ein wesentliches autobiographisches Moment. Anfang Juli 1891 hatte George Wien verlassen und war zunächst nach München gereist, wo er wieder bei seinem Bruder Fritz wohnte. Aber schon nach wenigen Tagen brach er zu einer Reise zu den Königsschlössern von Bayerns Märchenkönig Ludwig II. auf. Der Weg führte ihn nach Neuschwanstein und zum Schloss Linderhof. Mario Zanucchi hat zeigen können, dass sämtliche Requisiten des selbstgeschaffenen Unterreichs sich in der dort befindlichen Venusgrotte befanden.76 In die künstliche Tropfsteinhöhle hatte Ludwig II. einen Wasserfall, einen Regenbogen-Projektions-Apparat, eine Wellenmaschine und eine elektrische Beleuchtungsmaschine, die überhaupt Bayerns erstes Elektrizitätswerk war, installieren lassen. So ergibt sich die eigenartige Konstellation, dass Georges scheinbar kompromissloseste Verwirklichung der Idee einer autonomen künstlerischen Schöpfung sich sehr konkret an dem Vorbild der Venusgrotte orientiert. Da sich unter den datierbaren Gedichten aus dem Algabal keine identifizieren lassen, die vor Juli 1891 entstanden sind, kann man nicht ausschließen, dass überhaupt erst der Besuch von Ludwigs „Wunderwerk avanciertester Technik“77 den Anstoss zu Georges drittem Gedichtband gegeben hat.
Auf den Besuch von Ludwigs Schlössern folgte bis Ende Oktober eine rastlos wirkende Reiseaktivität Georges. Zunächst kehrte er Mitte Juli für zwei Wochen ins Bingener Elternhaus zurück. Bereits von Schloss Linderhof aus hatte er seine Ankunft angekündigt und dazu bemerkt, er würde „voraussichtlich etwas verwahrlost“78 eintreffen, da er viel in den Bergen herumwanderte. Den August verbrachte er in Königstein im Taunus. George wird diesen Kurort noch häufig aufsuchen, wobei nicht unbedingt bei jedem Besuch gesundheitliche Probleme als Grund angenommen werden müssen. Bei diesem Besuch im August 1891 liegt jedoch die Vermutung nahe, dass George gezielt nach Entspannung suchte. Jedenfalls enthielt der Brief an die Eltern auch die Mitteilung, dass er „an heftigem seelenkatarrh“ leide. Auf Georg Edward, mit dem er sich während seines Aufenthalts in Königstein verabredet hatte, machte George einen angespannten und reizbaren Eindruck. Georg Edward hatte durch seinen Freund Carl Rouge Einblick in Georges Hymnen nehmen können und einen begeisterten Brief nach Bingen gesandt. Da Edward selbst auch dichtete und schon ab 1888 erste Gedichte von ihm in Zeitschriften erschienen waren, die offenbar Georges Gefallen gefunden hatten, trafen die beiden sich in Gießen, wo Edward lebte. Das Treffen im Hotel Victoria sollte wohl dazu dienen, Edward als potentiellen Beiträger für die geplante Zeitschrift zu gewinnen und im Gespräch auf seine Eignung zu prüfen. George habe ihm sogleich seine Theorie der Dichtkunst entwickelt, die vor allem darauf zielte, alles Erzählende und Reflektierende aus der Dichtung herauszuhalten. Ein Gedicht dürfe nichts schildern wollen, sondern müsse nur über eine Stimmung verfügen. Außerdem schärfte George ihm ein, dass sich die Poesie nur an wenige Auserwählte richten solle, „die vermöge ihrer auf Kultur und Bildung beruhenden Verfeinerung“79 genügend Verständnis dafür aufbringen könnten. Da Edward in seinen eigenen Produktionen eine gewisse Neigung zum Balladenhaften hatte, schien George es wohl für geboten zu halten, den potentiellen Beiträger auf das angestrebte stilistische Profil einzuschwören. Im Laufe des Abends tauchten Bekannte von Edward auf, die sich zu ihnen setzten, worauf George sofort mit Verschlossenheit reagierte und kaum noch ein Wort sagte.
Edward gehörte dann tatsächlich in der Frühphase der Blätter für die Kunst zu den Beiträgern. George ließ ihm über Klein sogar im März 1893 anbieten, einen eigenen Gedichtband im Verlag der Blätter für die Kunst herauszubringen, aber Edward lehnte das in dem richtigen Bewusstsein ab, dass seine Beiträge von allen am wenigsten zum Charakter der Zeitschrift passten. Er schrieb, dass er keine zehn Gedichte hätte, die den ästhetischen Kriterien Georges genügten, da bei ihm das Stoffliche wichtiger sei als Wort und Stimmung.80 Seine Mitarbeit an der Zeitschrift endete denn auch nach vier Gedichten und einer Swinburne-Übersetzung im Januar 1894, weil George, ohne ihn zu konsultieren, massiv in seine Texte eingegriffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lebte Edward bereits in Chicago, wo er zunächst als Korrespondent für deutsche Printmedien arbeitete. Er blieb bis 1931 in den USA. George sah er nur einmal 1911 anlässlich eines Besuchs bei Karl Wolfskehl in München wieder.