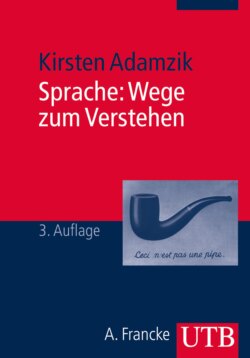Читать книгу Sprache: Wege zum Verstehen - Kirsten Adamzik - Страница 10
Оглавление|►11|
3 Sprache als System
Sprachreflexion
Das Nachdenken über die menschliche Sprache ist – dies zeigen nicht zuletzt die biblischen Berichte – sicher ebenso alt wie die menschliche Sprache selbst. Zum Nachdenken und Sprechen über die Sprache kommt man auf ganz natürlichem Wege schon beim Lernen der Sprache – sei es der Mutter- oder einer Fremdsprache. Und gerade die praktischen Bedürfnisse des Sprachunterrichts haben auch schon früh vielfältige Bemühungen um die mehr oder weniger systematische Beschreibung von Einzelsprachen hervorgebracht.
Linguistik
In diesem Abschnitt soll es uns jedoch um die neuere Zeit gehen, jene Zeit, in der man von wissenschaftlicher Sprachbeschreibung im modernen Sinne spricht und sich die Disziplin der Linguistik, wie es heute meist heißt, etabliert. Welche der verschiedenen Bedeutungen von Sprache und welche Fragestellungen rückten dabei ins Blickfeld?
|11◄ ►12|
Die Ausbildung der Wissenschaft von der Sprache fällt in das 19. Jahrhundert. Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit auf die eben besprochenen
Die historischvergleichende Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts
Sprachverschiedenheiten und den Sprachwandel. In dieser Zeit herrschte nämlich eine Forschungsrichtung vor, die als historisch-vergleichende Sprachwissenschaft oder auch Indogermanistik bezeichnet wird. Was kennzeichnet diese sprachwissenschaftliche Schule? Ende des 18. Jahrhunderts hatte man erkannt, dass nicht nur die meisten europäischen Sprachen miteinander verwandt sind, sondern dass eine Verwandtschaft u.a. auch mit dem Sanskrit vorliegt. Dies ist die Sprache sakraler Schriften des Altindischen, die möglicherweise schon im 2. vorchristlichen Jahrtausend entstanden sind. Nach dieser faszinierenden Entdeckung, dass Sprachen, die sowohl geografisch als auch historisch weit voneinander entfernt sind und sich auf den ersten Blick auch keineswegs ähneln, doch miteinander verwandt sein können, setzte man sich zum Ziel, die Verwandtschaftsverhältnisse und die historische Entwicklung der indoeuropäischen Sprachen insgesamt zu erforschen – und dabei möglicherweise sogar die indogermanische Ursprache zu rekonstruieren. Einen besonderen Aufschwung erlebte diese Forschungsrichtung, als man glaubte nachweisen zu können, dass die Auseinanderentwicklung verschiedener Sprachgruppen und Dialekte durch regel-, ja gesetzmäßige Lautentwicklungen (Lautgesetze) zustandekommt. Um dies systematisch untersuchen zu können, wandte man sich auch den zeitgenössischen Dialekten zu. Im 19. Jahrhundert stehen also Sprachverwandtschaft, dialektale Sprachvariation und Sprachwandel im Zentrum des sprachwissenschaftlichen Interesses.
Saussures Neuansatz
Ferdinand de Saussure, der die Termini langage, langue und parole eingeführt hat, ist in der Schule der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ausgebildet worden und war in Genf seit 1891 als professeur ordinaire de sanscrit et de langues indo-européennes tätig. Die große Bedeutung, die er für die Entwicklung der Linguistik hat, rührt jedoch gerade nicht aus der durchaus wichtigen Arbeit her, die er im Rahmen der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft geleistet hat. Vielmehr ist er dadurch zum Begründer der modernen Linguistik geworden, dass er dieser Forschungsrichtung einen Neuansatz gegenübergestellt hat. Die Überlegungen, die ihn dabei geleitet haben, könnte man grob folgendermaßen zusammenfassen:
Das wichtigste Merkmal der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft besteht darin, dass sie immer mehrere Sprachen und Varietäten zugleich untersucht und z.B. die Frage stellt, wie ein und derselbe Laut (d.h. eine [rekonstruierte] Ausgangsform) sich in verschiedenen Dialekten präsentiert und wozu er sich im Laufe der Zeit entwickelt. Nun ist es aber für einen Sprecher, der jemandem zu einem gegebenen Zeitpunkt irgendetwas mitteilen will, eigentlich gleichgültig, wie die Laute der Einzelsprache, die er benutzen möchte, früher einmal geklungen haben oder später einmal klingen werden. Es ist auch nicht notwendig zu wissen, welche Worte es in irgendwelchen anderen |12◄ ►13| Dialekten seiner Sprache für das gibt, worüber er sprechen will, oder wie gleiche Wörter dort ausgesprochen werden. Alle diese Informationen sind erstens für die praktische Kommunikation kaum von Belang, und zweitens sind sie dem Durchschnittssprecher auch großenteils unbekannt. Und das schadet nichts, denn ein solches Wissen braucht man keineswegs, wenn man sich seiner grundlegenden Sprachfähigkeit (langage) bedienen will. Um effektiv kommunizieren zu können, reicht es durchaus, eine einzelne geografische Varietät einer einzelnen Sprache zu kennen, und zwar in der einen ›Fassung‹, in der sie zum gegebenen Zeitpunkt üblich ist. Ja, es ist sogar in bestimmtem Ausmaß notwendig, dass eine Sprachgemeinschaft sich zu einem gegebenen Zeitpunkt gewissermaßen auf eine bestimmte Ausprägung der jeweiligen Sprache ›einigt‹, dass für die Kommunikation also ein einheitliches Bezugssystem gegeben ist.
langue – das Sprachsystem
Für Saussure ist es nun die zentrale Aufgabe der Linguistik, diese einzelsprachlichen Systeme zu beschreiben, die in den Sprachgemeinschaften die Verständigung ermöglichen. Für ein solches System prägte Saussure den Fachterminus langue. Die langue ist also das (zu rekonstruierende) einzelsprachliche System, das der Produktion von parole zugrunde liegt. Es stellt so etwas wie die Spielregeln dar, nach denen Äußerungen produziert werden können, Spielregeln, die natürlicherweise nur in den Köpfen der Sprechenden existieren. Aus diesem Grund bezeichnet Saussure die langue als eine psychische Größe, während die parole ein konkretes physisches (akustisches oder optisches) Phänomen darstellt.
Beziehungen zwischen sprachlichen Elementen
Um das System der langue zu rekonstruieren, ist es notwendig, die Beziehungen zu untersuchen, die seine einzelnen Elemente – z.B. die einzelnen Laute, Wörter oder grammatischen Regeln – zueinander haben (und nicht die Beziehungen, die diese Elemente zu ihnen entsprechenden Größen in anderen Systemen, anderen Dialekten, Sprachen oder Sprachstadien haben, wie es die Indogermanistik untersucht).
Man muss also z.B. wissen, ob es in einer Einzelsprache Kurzvokale und Langvokale gibt, d.h. ob diese Unterscheidung für das Funktionieren der Kommunikation wichtig ist oder nicht. Man muss aber nicht wissen, ob es in einem früheren Sprachstadium auch Kurz- und Langvokale gab oder sich z.B. die Langvokale aus früheren Diphthongen (z.B. üe, ie, uo etc.) entwickelt haben. – Im Neuhochdeutschen ist die Unterscheidung von Kurz- und Langvokalen übrigens wichtig, denn man muss z.B. erkennen können, ob es las (Imperfekt von lesen) oder lass (Imperativ von lassen) heißen soll. In anderen Sprachen ist diese Unterscheidung dagegen nicht wichtig, d.h. es ist ziemlich egal, wie lang man den Vokal dehnt, der Ausdruck bedeutet immer dasselbe.
Strukturalismus
Die langue ist aufzufassen als eine Summe von Elementen, zwischen denen bestimmte Beziehungen bestehen; diese machen die Struktur |13◄ ►14| des Sprachsystems aus. Um deren Rekonstruktion geht es bei der Beschreibung der langue. Daher hat die von de Saussure begründete sprachwissenschaftliche Forschung den Namen Strukturalismus.
Synchronie und Diachronie
Die langue wird von Saussure als stabiles und homogenes System angesehen, d.h. er sieht dabei von Sprachwandel, dialektaler Variation usw. ab. Der Grund ist folgender: Wenn es darum geht, die Struktur eines Systems zu rekonstruieren, kann man immer nur ein System zur Zeit betrachten, die Struktur gilt nur für dieses eine System (im Nachbardialekt kann es z.B. statt mancher Langvokale Diphthonge geben). Praktisch bedeutet das: Man muss bei einer Systembeschreibung davon abstrahieren, dass die Grenzen zwischen den Sprachen und Varietäten fließend sind und sich die Sprache in Wirklichkeit in ständigem Wandel befindet. Die Entwicklung einer Sprache im Laufe der Zeit bezeichnet man als Diachronie (zu griechisch dia- ›durch‹ und chronos ›Zeit‹). Bei der Betrachtung der langue hält man gewissermaßen den Zeit-Film an, macht einen synchronen Schnitt, eine Momentaufnahme (Synchronie; griechisch syn- ›zusammen‹), und beschreibt dieses Bild. Selbstverständlich sind beide Fragestellungen auch nach Ansicht Saussures völlig legitim; nur war zu seiner Zeit die synchronische noch nicht üblich, und sie sollte von der diachronischen auch klar getrennt werden.
Standardsprache
Dass man überhaupt auf die Idee kommen kann, von Sprachwandel und Sprachvariation zu abstrahieren, hat zweifellos damit zu tun, dass es auch in der sprachlichen Wirklichkeit schon etwas gibt, was zumindest als stabil und homogen gemeint ist, nämlich die Standardsprache. Diese nennt man auch oft Hochsprache, und es handelt sich um die sprachliche Varietät, die in ›verbindlichen‹ Wörterbüchern und Grammatiken normativ festgeschrieben (»kodifiziert«) ist. Die Normierung einer Sprache, die Entwicklung einer Standardvarietät – übrigens im Allgemeinen ein relativ spätes Ereignis in der Geschichte einer Sprache – läuft im Grunde darauf hinaus, Varianten (z.B. dialektale oder umgangssprachliche) als inkorrekt auszuschließen. Wie Textbeispiel 3 zeigt, geht dies meist nicht ohne Konflikte ab. Auch Neuerungen (z.B. Übernahmen aus anderen Sprachen) versucht man vielfach abzuwehren – diese werden dann meist als Sprachverfall gebrandmarkt. Dennoch darf man Standardsprache und langue nicht miteinander verwechseln: Langue bedeutet nur: abstraktes System, das der parole zugrunde liegt. Bei diesem System kann es sich um das der Standardsprache, aber auch um das von Dialekten oder sonstigen Varietäten handeln.
Sprache und andere Zeichensysteme
Linguistik als Beschreibung der langue (auch bezeichnet als Systemlinguistik), also der auf Saussure zurückgehende Ansatz, ist diejenige Forschungsrichtung, die den größten Teil des 20. Jahrhunderts beherrscht hat. Saussure betrachtet die Sprache allerdings vor dem Hintergrund anderer Zeichensysteme: |14◄ ►15|
Textbeispiel 3: Goethe in Leipzig
[…] so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Verhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipiert auf die Akademie gelangt. […]
Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat, und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, faßte ich Mut und wagte, meine sämtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpfte.
Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.
Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Vater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache befliß und uns Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob, und mir dadurch von meinen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Verweis zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt (denn große Flüsse haben, wie das Meeresufer, immer etwas Belebendes), drückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen aus, und bei einer inneren menschenverständigen Tüchtigkeit bedient er sich sprüchwörtlicher Redensarten. In beiden Fällen ist er öfters derb, doch, wenn man auf den Zweck des Ausdruckes sieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr sich anstößig erweist.
Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft. Mit welchem Eigensinn aber die meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeitlang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesetzt. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hofmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung man sich endlich wohl ergäbe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer Charakter sollten aufgeopfert werden. Und diese unerträgliche Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht, deren Überzeugung ich mir nicht zueignen konnte, deren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu können. Mir sollten die Anspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sein, sowie die Benutzung treuherziger Chronikenausdrücke. Ich sollte vergessen, daß ich den Geiler von Kaisersberg gelesen hatte, und des Gebrauchs der Sprüchwörter entbehren, die doch, statt vieles Hin- und Herfackelns, den Nagel gleich auf den Kopf treffen; alles dies, das ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, sollte ich missen, ich fühlte mich in meinem Innersten paralysiert und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden wie man schreibt, und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein für allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eignen Rechte behaupten möchte.
|15◄ ►16|
Die Sprache ist ein System von Zeichen, die Ideen ausdrücken und insofern der Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen usw. usw. vergleichbar. Nur ist sie das wichtigste dieser Systeme.
Man kann sich also vorstellen eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht; […] wir werden sie Semeologie (von griechisch sēmeîon »Zeichen«) nennen. Sie würde uns lehren, worin die Zeichen bestehen und welche Gesetze sie regieren. Da sie noch nicht existiert, kann man nicht sagen, was sie sein wird. Aber sie hat Anspruch darauf, zu bestehen.3
Semiotik
Die hier von Saussure konzipierte allgemeine Wissenschaft von den Zeichen hat sich tatsächlich etabliert und wird heute meist mit dem Terminus Semiotik belegt. Wir wollen uns daher im Folgenden zunächst allgemein der Frage zuwenden, ›worin Zeichen bestehen‹, und später Saussures eigene Überlegungen zur Natur des sprachlichen Zeichens vorstellen.
|16◄|