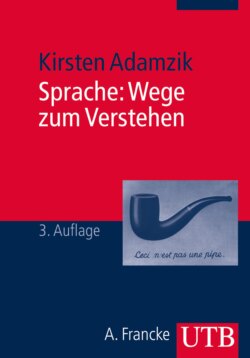Читать книгу Sprache: Wege zum Verstehen - Kirsten Adamzik - Страница 20
Оглавление|►70|
13 Bedeutungsverwandte Ausdrücke: Wortfelder
Das Wortfeld Oberbegriff – Unterbegriffe
Da die valeur eines Lexems sich daraus ergibt, welche anderen Lexeme ihm an der Seite stehen, besteht ein erster Schritt der Rekonstruktion der sprachspezifischen Kategorien in der Zusammenstellung von Lexemen, die einander ähnlich sind, sich eben gegenseitig begrenzen. Solche Gruppen bedeutungsverwandter Lexeme werden mit dem Terminus Wortfeld bezeichnet. Genauer gesagt werden jedoch bei der Zusammenstellung immer nur einzelne Lesarten dieser Lexeme berücksichtigt. Die Fragestellung ist also zunächst onomasiologisch: Welche Lexeme gibt es für diesen Gegenstandsbereich? Für den Gegenstandsbereich ›Behältnisse‹ kommen z.B. neben Sack und Tasche im Deutschen noch in Frage: Tüte, Beutel, Netz, Ranzen, Korb, Mappe, Tornister, Dose, Kiste, Truhe … Alle fallen unter einen Oberbegriff (man benutzt dafür auch den Terminus Hyperonym, zu griechisch hyper- ›über‹), hier: ›Behälter‹. Umgekehrt spricht man von Unterbegriff (oder Hyponym, zu griechisch hypo- ›unter(halb)‹). Mann, Frau, Kind, Junge, Mädchen usw. sind z.B. hyponym zu ›Mensch, Person‹.
Synonymie
Bedeutungsverwandte Ausdrücke sind einander natürlich mehr oder weniger nahe. Eng bedeutungsverwandte Ausdrücke können |70◄ ►71| gleichermaßen auf ein und denselben Referenten angewandt werden. So kann man für einen bestimmten Gegenstand etwa durchaus wählen zwischen Tasche, Tüte und Beutel; auf keinen Fall könnte man dagegen für denselben Gegenstand Dose, Kiste oder Truhe verwenden. Wenn zwei Lexeme ohne jeden Bedeutungsunterschied in jedem möglichen Parole-Akt gegeneinander ausgetauscht werden können, sprechen wir von strenger Synonymie. Ein solcher Fall kommt jedoch nur selten vor, meistens gehören die Ausdrücke nämlich mindestens einer anderen Varietät an: Beispielsweise sagt man im Süden Samstag, im Norden Sonnabend, in Frankreich quatre-vingt-dix, in der französischen Schweiz und Belgien nonante usw.
Das Beispiel der Personenbezeichnungen
Hat man bedeutungsverwandte Ausdrücke zusammengestellt, kommt es weiter darauf an zu bestimmen, was sie inhaltlich gemeinsam haben und worin sie sich unterscheiden. Wir suchen also nach den Differenzierungsmerkmalen. Beginnen wir mit einem ganz einfachen Beispiel, den gängigsten Personenbezeichnungen im Deutschen: Mensch, Kind, Frau, Mann, Mädchen, Junge. Alle diese Lexeme haben eines gemeinsam: Sie bezeichnen menschliche Wesen, daher ist der Ausdruck Mensch der Oberbegriff zu den anderen. Als Differenzierungsmerkmale kommen offensichtlich das Geschlecht und das Alter ins Spiel. Man kann diese Verhältnisse zusammenfassend in der folgenden Tabelle darstellen:
Semantische Merkmale/Seme
Wie man sieht, lässt sich die Bedeutung der sechs Lexeme säuberlich voneinander unterscheiden, wenn man drei Differenzierungsmerkmale berücksichtigt. Diese analytisch unterscheidbaren Bedeutungskomponenten bezeichnen wir von jetzt an als semantische Merkmale oder Seme. Jedes Lexem weist eine andere Kombination von Semen auf. Allen gemeinsam ist das semantische Merkmal ›menschlich‹, das einzige, das bei Mensch spezifiziert ist; daran ist erkennbar, dass dies der Oberbegriff ist. Bei Kind ist das Merkmal Geschlecht nicht spezifiziert, dieses Lexem bildet daher den Oberbegriff zu Junge und Mädchen. Die Bedeutung eines Lexems, den signifié, können wir nun also als ein
Semem: ein Bündel semantischer Merkmale
Bündel von Semen betrachten. Dafür benutzt man den Ausdruck Semem.
|71◄ ►72|
Der Nutzen der Merkmalanalyse
Welchen Nutzen hat eine solche Aufspaltung der Lexembedeutung in Seme? Einerseits kann man auf diese Weise sehr klar die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Lexemen darstellen. Dies ist besonders deswegen möglich, weil Merkmale, die auf den ersten Blick ganz verschieden zu sein scheinen, als verschiedene Ausprägungen ein und desselben Merkmals analysiert werden. So kann man bei Lebewesen etwa zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen unterscheiden, aber auch mit dem Merkmal ›menschlich‹ und den Ausprägungen ›ja/ nein‹ bzw. ›+/ – ‹ arbeiten. Bei Vorliegen von › – menschlich‹ würde man dann auf einer Ebene tiefer mit dem Merkmal ›± tierisch‹ operieren. Ebenso kann man weiblich und männlich zusammenfassen und wahlweise ›männlich‹ als › – weiblich‹ bzw. ›weiblich‹ als › – männlich‹ definieren.
Sprachvergleich
Vor allem erlaubt uns die Methode aber auch, die Lexeme verschiedener Sprachen miteinander zu vergleichen. Sie operieren nämlich häufig mit denselben Semen. Zumindest einige (vielleicht aber auch sehr viele) semantische Merkmale sind bei der sprachlichen Kategorisierung so fundamental, dass wir sogar annehmen können, es handele sich um universale, also in allen Sprachen vorliegende, Merkmale. Dazu gehört höchstwahrscheinlich das Sem ›menschlich‹, denn die Besonderheit der eigenen Gattung gegenüber anderen Lebewesen sprachlich hervorzuheben, entspricht anscheinend einem menschlichen Grundbedürfnis.
Die Semanalyse kann aber vor allem Unterschiede zwischen Einzelsprachen aufdecken, und auch dafür finden wir in unserem einfachen Beispiel schon einen Beleg, für den wir nur das Französische heranziehen müssen. Dort gibt es nämlich kein besonderes Lexem mit der Semkombination: ›menschlich‹, ›männlich‹, ›erwachsen‹, denn homme entspricht ja sowohl Mann als auch Mensch. Man muss also aus dem Kontext entnehmen, welche Lesart gemeint, welches die aktuelle Bedeutung ist, oder sich mit einem komplexen Ausdruck wie être humain bzw. (être humain) adulte (de sexe) masculin behelfen.
Systematisierung des Ansatzes: die Komponentenanalyse
Für die differenzierte Beschreibung des lexikalischen Inventars einer Einzelsprache, aber auch für den systematischen Vergleich des Wortschatzes verschiedener Sprachen wäre es nun sehr nützlich, wenn wir alle Lexeme als Sememe, als Bündel semantischer Merkmale, darstellen könnten. Dabei würden wir dann auch Aufschluss darüber gewinnen, wie ähnlich oder verschieden die vielen Einzelsprachen denn eigentlich sind: Arbeiten sie überwiegend mit denselben Semen und sind nur die jeweiligen Bündelungen, also die Sememe, verschieden, oder gibt es auch (viele) sprachspezifische Seme? Besonders in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man in der Semantik viele Anstrengungen unternommen, Wortfelder nach dieser Methode zu analysieren. Diese Ansätze fasst man unter der Bezeichnung Merkmal-|72◄ ►73| oder Komponentenanalyse zusammen. Ein bekanntes Beispiel8 für solch eine Analyse betrifft Lexeme für Sitzgelegenheiten im Französischen:
Das Beispiel der Sitzgelegenheiten
Wie man sieht, wird hier die oben schon angedeutete Methode angewandt, Inhaltsbestandteile als Ausprägungen von Semen darzustellen. Für die Beispiellexeme reichen die Ausprägungen + oder – ; zusätzlich wird aber oft die Ausprägung ›irrelevant‹ bzw. ›nicht spezifiziert‹ (unser früheres ›unentschieden‹) notwendig, dargestellt meist durch ± oder Ø. Die einzelnen Seme werden mit einem kleinen ›s‹ symbolisiert und durchnummeriert, die gleichfalls durchgezählten Sememe bekommen den Großbuchstaben ›S‹. Gegenüber normalen Bedeutungsumschreibungen, wie wir sie in Wörterbüchern finden, hat die Darstellungsmethode folgenden Vorteil: Sie zwingt uns zu einer expliziten, vollständigen und kohärenten Beschreibung. Alle bedeutungsverwandten Lexeme werden ›im selben Format‹ beschrieben, und zwar vollständig, und erst dies gewährleistet einen exakten Vergleich.
Probleme der Analysemethode
Die Methode wirft aber auch eine Reihe von Schwierigkeiten auf, und tatsächlich sind bislang für keine Sprache größere Ausschnitte des Wortschatzes auf diese Weise beschrieben oder gar zweisprachige Wörterbücher nach diesem System erstellt worden. In neuerer Zeit ist man sogar insgesamt von dieser Methode der Bedeutungsbeschreibung wieder abgekommen. Wir wollen im Folgenden klären, wo ihre Probleme liegen und konzentrieren uns dabei auf zwei Aspekte. Einerseits fragt sich, ob die Komponentenanalyse tatsächlich fein genug zwischen bedeutungsverwandten Ausdrücken unterscheiden kann und alle relevanten Differenzierungsmerkmale erfasst. Andererseits kann man daran zweifeln, dass eine Inhaltskomponente tatsächlich mit Hilfe der Ausprägungen +, – und ± bestimmt werden kann. In traditionellen Wörterbuchbeschreibungen heißt es nämlich stattdessen – und dies ist wahrscheinlich kein Zufall – oft, ein bestimmtes Merkmal sei ›mehr bzw. weniger‹, ›meistens oder selten‹ gegeben und dergleichen. Dies ist auch bei beiden Beispielen aus Kapitel 10 der Fall (vgl. Textbeispiel |73◄ ►74| 11). Bei weiß heißt es u.a. (Lesart 2a) ›sehr hell aussehend‹, bei Sack ›größeres Behältnis‹.
|74◄|