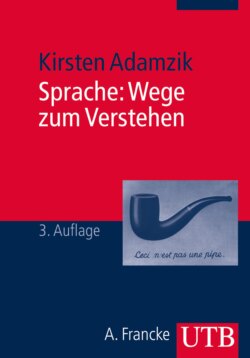Читать книгу Sprache: Wege zum Verstehen - Kirsten Adamzik - Страница 14
Оглавление|►40|
7 Eine Landkarte der Sprachwissenschaft – die Linguistik und ihre Teildisziplinen
Unterschiedliche linguistische Fragestellungen
Nachdem wir die Sprache in ihrer Vielfältigkeit und den Sprachgebrauch in seinem Kontext betrachtet haben, wollen wir uns im Weiteren genauer einzelnen Aspekten zuwenden. Denn um das Funktionieren von Sprache detaillierter zu erläutern, müssen wir uns natürlich jeweils auf bestimmte Elemente konzentrieren und dabei von anderen Gesichtspunkten abstrahieren. Diese Systematisierung verschiedener linguistischer Fragestellungen schlägt sich nieder in einer Aufgliederung sprachwissenschaftlicher Arbeit in verschiedene Teil- oder Subdisziplinen. Eine solche Aufgliederung ist freilich analytischer Art. Jede sprachliche Äußerung und fast jedes sprachliche Phänomen kann man, wenn nicht unter allen, so doch jeweils unter einer Vielzahl von Gesichtspunkten betrachten. Insbesondere sollte man nicht denken, dass es die Grammatik, die sich auf das Formale bezieht, auf der einen Seite und die Bedeutung, die Inhalte betrifft, auf der anderen Seite gäbe. Die Wahl bestimmter grammatischer Strukturen trägt vielmehr ebenso viel zur Bedeutung einer Äußerung bei wie die Wahl bestimmter Wörter. Wenn man sich also auf formale Aspekte konzentriert, so geschieht dies nicht auf Grund einer dem Phänomen innewohnenden Eigenschaft, |40◄ ►41| sondern auf Grund der Entscheidung des Analysierenden. Man kann sowohl Wörter unter formalen als auch Sätze bzw. Satzstrukturen unter inhaltlichen Gesichtspunkten untersuchen. Aber natürlich gibt es unter Linguisten verschiedener Ausrichtung und verschiedener Interessen Streitigkeiten darüber, welche Betrachtung wohl die zentrale, wichtigste, interessanteste … ist. Führen wir uns also vor Augen, welche ›Abteilungen‹ geläufigerweise unterschieden werden.
›Harte‹ und ›weiche‹ Linguistik Systemlinguistik
Es gibt zunächst eine grobe Zweiteilung, zu deren Gegenüberstellung man im Deutschen sogar die alternativen Ausdrücke für die Gesamtdisziplin, Linguistik und Sprachwissenschaft, inhaltlich zu einem Gegensatz aufladen kann und die sich in erster Linie auf den Gegensatz verschiedener Schulen gründet. Zur Linguistik in diesem etwas kämpferisch verwendeten engen Sinn gehören dann nur die Teile, die man auch als ›harte‹ Linguistik bezeichnet. Diese beschränkt sich auf die Untersuchung des Sprachsystems, speziell der formalen Seite, legt größten Wert auf die Formalisierbarkeit ihrer Aussagen und frappiert den Laien dadurch, dass sie ›aussieht wie Mathematik‹. Dem steht gegenüber die so genannte ›weiche‹ Linguistik (bzw. Sprachwissenschaft im spezialisierten Sinn), für die Aspekte der Bedeutung, des Sprachgebrauchs, anwendungsbezogene und interdisziplinäre Fragestellungen (Sprache und Gesellschaft, Sprache und Kultur, Sprache und Medien, literarische Sprache usw.) zentral sind. Die harte Linguistik entspricht also grosso modo dem, was wir früher als Systemlinguistik kennengelernt haben und genießt in Fachkreisen das höhere Prestige – wohl auch deswegen, weil sie weiter entfernt ist vom Alltagsdenken und daher als wissenschaftlicher erscheint. Sie hat aber dieses Ansehen vor allem, weil sie sich herleitet aus den Bemühungen um die Etablierung der Linguistik als autonomer Disziplin, die bevorzugt Fragen auswählt, für die sie und nur sie zuständig ist. Das sind natürlich Fragen, die das Sprachsystem betreffen. Wenn wir uns von dieser tendenziell polemischen Einschränkung der Linguistik auf die ›harte‹ Variante fernhalten – und das ist im Zeitalter der Inter- und Transdisziplinarität wohl angemessen – können wir die auf das Sprachsystem bezogenen Teilbereiche als sprachwissenschaftliche Kerndisziplinen bezeichnen und die anderen als solche mit interdisziplinärer Komponente auffassen.
Was braucht man, um sich eine fremde Sprache anzueignen?
Als Kerndisziplinen kann man die Untersuchung des Sprachsystems deswegen auffassen, weil die Beschreibung der entsprechenden Komponenten genau das erfasst, was zu jemandes Fähigkeiten gehört, von dem man sagt, er beherrsche diese Sprache. Was also kann man, wenn man eine Einzelsprache beherrscht, bzw. was muss man sich aneignen, wenn man eine Einzelsprache lernen will? Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden, versetzen wir uns in die Situation eines erwachsenen Menschen, der seine Muttersprache beherrscht und eine Fremdsprache |41◄ ►42| lernen will. Setzen wir weiter voraus, dass er zunächst nur
Ein Wörterbuch
Grundkenntnisse in dieser Sprache erwerben will, d.h. einfache Texte verstehen und produzieren können möchte. Zu diesem Zweck muss er sich einige tausend Einheiten aneignen, wie sie in einem Wörterbuch der betreffenden Sprache verzeichnet sind – er tut also gut daran, sich ein solches Wörterbuch zu beschaffen; er muss wissen bzw. lernen, wie man die Einheiten ausspricht und was sie bedeuten.
Eine Grammatik
Nun wissen wir allerdings alle, dass man sich, lediglich mit einem Wörterbuch ausgestattet, nicht mit den Sprechern der Fremdsprache wird verständigen können und dass man eine Sprache nicht allein dadurch erwirbt, dass man ein Wörterbuch auswendig lernt. Vielmehr muss man auch wissen, wie die Einheiten aus dem Wörterbuch in einem Satz eingesetzt werden – meistens werden sie dazu in bestimmter Weise abgeändert – und wie man überhaupt Sätze in der jeweiligen Sprache konstruiert. Solche Informationen findet man in einer Grammatik, die der Lernwillige sich also zusätzlich beschaffen sollte. Für Fremdsprachler gibt es elementare Lerner- oder Schulgrammatiken, die lediglich die grundlegenden grammatischen Regeln erklären. Verfügt man über solche Hilfsmittel und möglichst auch noch einen Fremdsprachenlehrer, so kann man sich die gewünschte Sprache – so weit man hier überhaupt einen gewissen Standardwert angeben kann – sicherlich etwa im Laufe eines Jahres in ihren Grundzügen aneignen, wenn man voraussetzt, dass der Lerner regelmäßig etwa eine Stunde pro Tag in die Aufgabe investiert.
Kerndisziplinen der Linguistik Phonetik/ Phonologie Graphetik/ Graphemik
In den Hilfsmitteln – dem kleinen Wörterbuch und der elementaren Grammatik – werden also diejenigen Kenntnisse expliziert, die man haben muss, um sagen zu können, dass man die Sprache in ihren Grundzügen beherrscht. Dazu gehören Kenntnisse verschiedener Art, die wir nun den Teildisziplinen zuordnen wollen. Einerseits muss der Lerner die Lautstruktur der Sprache erwerben, also wissen, welche Laute es in der Sprache gibt, wie man sie miteinander kombinieren kann und welche Schriftzeichen den Lauten entsprechen. Im Deutschen gibt es z.B. nicht das englische th (wie in the thing), das vielen deutschen Sprechern daher auch Schwierigkeiten bereitet. Ein deutsches Wort kann z.B. auch nicht mit ng beginnen oder die Lautfolge prz aufweisen, während das in anderen Sprachen durchaus möglich ist. Die Lautstruktur wird in den Teilbereichen Phonetik und Phonologie behandelt (zum Unterschied zwischen beiden vgl. Kap. 21). Die Verschriftlichung der Laute und Lautfolgen, die (Ortho-) Grafie, fällt in das Gebiet der Graphetik/Graphemik.
Nun haben diese ganz elementaren Bestandteile der Sprache, die Laute und Buchstaben, also a, b, c, d, e usw., für sich keine Bedeutung, genauer gesagt: es ist ein Grenzfall, wenn ein einzelner Laut, in der Regel natürlich ein Selbstlaut (Vokal), zugleich einem Wort entspricht. Im |42◄ ►43| Deutschen etwa setzt man die einfachen Vokale nur als Interjektionen ein, die übrigens meistens mit mehreren Buchstaben wiedergegeben werden: ah!, eh!, iiih!, ooh! uuh! Nur Diphthonge (zu griechisch diphthongos ›zweifach tönend‹), z.B. das Ei und die Au, kommen auch als Substantive vor. Im Französischen dagegen kann ein einzelner Vokal nicht nur als Interjektion, sondern auch in anderer Funktion als Wort erscheinen: à, et, y, eau(x), ou/où. Dennoch sind die entsprechenden Bedeutungen nicht den Lauten bzw. Buchstaben als solchen zugeordnet. Die Wörter Bein, dein, fein, Hain, kein usw. haben ja inhaltlich nichts mit Ei (und auch nichts miteinander) zu tun. Normalerweise sind es also bestimmte Lautfolgen, die Einheiten konstituieren, wie sie im Wörterbuch
Lexikologie/ Lexikografie Semantik
beschrieben werden. Die Kunde der Wortbedeutungen bzw. des Wörterbuchschreibens bezeichnet man als Lexikologie bzw. Lexikografie. Die Disziplin der Bedeutungslehre heißt allgemein Semantik. Als wesentlichstes Teilgebiet (u.a. neben der Satzsemantik) umfasst sie die lexikalische Semantik, das Studium der Bedeutung von Einheiten des Wörterbuchs und der Beziehungen zwischen ihnen (was ist z.B. der Unterschied zwischen Junge, Bub, Bube, Bubi und Knabe?).
Morphologie
Abgesehen davon, dass man die Bedeutung der Wörterbucheinheiten kennen muss, ist es auch noch notwendig zu wissen, welche Gestalt sie annehmen können: Wie wird der Plural von Substantiven gebildet? Wie werden Verben konjugiert? Wie werden Adjektive gesteigert? usw. Diese Fragen fallen in den Bereich der Morphologie (von griechisch morphe ›Form‹), die man früher meist als Formenlehre bezeichnete.
Wortbildungslehre
Die lexikalischen Grundeinheiten können auch noch in anderer Hinsicht als der grammatischen abgewandelt bzw. zu neuen Einheiten zusammengefügt werden. So kann man z.B. aus schön ableiten: Schönheit, Schönling, beschönigen, verschönern, geschönt, und in allen diesen Ausdrücken – anders als bei Ei, Bein, dein usw. – handelt es sich bei dem Bestandteil schön um dasselbe Inhaltselement. Der Untersuchung dieser Phänomene widmet sich die Wortbildungslehre.
Syntax
Als höchste Ebene sprachstruktureller Regularitäten wird nach traditioneller Auffassung der Satz angesehen, dem – als letzte Kerndisziplin – der Teilbereich Syntax gewidmet ist. Hier geht es um Fragen wie die folgenden: Aus welchen Elementen setzt sich der Satz zusammen? In welcher Beziehung stehen die Einheiten zueinander? In welcher Reihenfolge werden die Einheiten angeordnet? usw. In dem Satz In jeder Äußerung eines Menschen – liegt – die Summe seiner sprachlichen Vergangenheit erkennen wir z.B. drei Teile, von denen der erste und dritte aus fünf Wörtern bestehen, der zweite nur aus einem; seiner aus dem dritten Teil bezieht sich dabei auf den Ausdruck eines Menschen aus dem ersten Teil. Tauschen wir die ersten beiden Teile gegeneinander aus, haben wir immer noch einen korrekten deutschen Satz vor uns – allerdings mit anderer Bedeutung, nämlich einen Fragesatz.
|43◄ ►44|
Allgemeine Sprachwissenschaft und Linguistik der Einzelsprachen
Die Kerndisziplinen der Linguistik haben wir ausgehend von der Frage eingeführt, welche grundlegenden Kenntnisse man haben muss, um sagen zu können, man habe eine Sprache gelernt. Wir haben uns dabei also mit den konkreten Aufgaben der Beschreibung von Einzelsprachen vertraut gemacht. An dieser Stelle können wir nun eine zweite Grundunterscheidung linguistischer Arbeitsbereiche einführen. Es ist die zwischen einzelsprachspezifischer Linguistik und allgemeiner Linguistik. Welches sind die Aufgaben der allgemeinen Sprachwissenschaft? Zunächst geht es ihr natürlich um das Phänomen langage, also das, was man über die menschliche Sprache überhaupt aussagen kann – Fragen, wie wir sie schon in den vorangehenden Kapiteln erörtert haben und bei denen Feststellungen zu einzelnen langues (meist dem Deutschen) nur als Beispiele gedient haben. Allerdings beschränkt sich die allgemeine Linguistik keineswegs auf die ganz allgemeinen Fragen, vielmehr ist sie eine notwendige Grundlage für jede auf eine Einzelsprache bezogene Untersuchung, so dass man letzten Endes beide Bereiche wiederum nur analytisch voneinander trennen kann. Aufgabe der allgemeinen Linguistik ist die theoretische Fundierung der Beschreibung von Einzelsprachen, sie muss die Kategorien und Verfahren erarbeiten, die wir bei der Analyse verwenden können. Dass diese Aufgabe überhaupt notwendig ist, ist für Laien nicht unbedingt einsichtig: Ergibt sich die ›richtige‹ Beschreibung nicht unmittelbar daraus, welche Elemente und Regeln es eben in der jeweiligen Sprache gibt? Dass es so einfach nicht ist, können wir uns wohl am besten klar machen, wenn wir daran denken, wie schwierig es ist, einem Fremdsprachler die Regeln unserer Muttersprache oder die genaue Bedeutung irgendwelcher Wörter zu erklären. Wir beherrschen die Sprache, d.h. wir können mit ihr umgehen, aber wir können nicht erklären, was wir da genau tun, welchen Regeln wir folgen, warum wir so und nicht anders sagen oder auch in einem Fall so und in einem anderen anders. Sobald man versucht, eine Regel oder eine Wortbedeutung zu beschreiben, muss man bestimmte metasprachliche Ausdrücke verwenden: Dies ist ein Verb und kein Substantiv und deswegen schreibt man es klein. Im Deutschen ist die Form eines Adjektivs nach dem bestimmten Artikel anders als nach dem unbestimmten: ›Ein schwieriger Fall – der schwierige Fall‹, ›der schwieriger Fall‹ ist also falsch. ›Verb‹, ›Substantiv‹, ›Adjektiv‹, ›bestimmter und unbestimmter Artikel‹ sind keine Phänomene, die unmittelbar gegeben wären, es sind theoretische Kategorien – und wenn sie uns relativ vertraut und ›natürlich‹ vorkommen, so nur deswegen, weil wir alle ein wenig grammatische Theorie in der Schule gelernt haben.
Die Bedeutung wissenschaftlicher Theorien
Die meisten haben allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass sie mit dieser Theorie nicht besonders gut zurechtkommen, dass es manchmal mehr Ausnahmen als reguläre Fälle zu geben scheint usw. Für den Sprachwissenschaftler sind solche Erfahrungen eine Herausforderung:|44◄ ►45| Können wir den Sprachgebrauch nicht so beschreiben, dass wir die Regeln verstehen können, brauchen wir dafür nicht vielleicht andere als die bislang benutzten Kategorien? Und so macht man sich an die Entwicklung von Theorien, prüft an der einen oder anderen oder auch an mehreren Sprachen, ob man mit ihnen wohl erfassen kann, welchen Regeln die Sprecher unbewusst ›tatsächlich‹ folgen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass solche Theorien in Wirklichkeit immer nur Modelle des Sprachsystems sind; welchen Regeln die Sprecher ›tatsächlich‹ folgen, können wir nicht wirklich wissen.
Das Laieninteresse an der Sprache
Wenden wir uns nun den Teildisziplinen der ›weichen‹ Linguistik zu, die übrigens keineswegs per se weniger theoretisch oder einfacher ist. Sie ist allerdings von allgemeinerem Interesse. Die explizite Erläuterung der Regeln einer Sprache ist ja besonders relevant für solche Personen, die diese Sprache im Unterricht lernen. Da Muttersprachler ihre Sprache schon beherrschen – und da dafür theoretische Kenntnisse nicht nötig sind – haben diese im Allgemeinen keinen großen Bedarf an den Erkenntnissen der ›harten‹ Linguistik (vgl. dazu Textbeispiel 9), jedenfalls dann nicht, wenn sie sich nicht gerade als Fremdsprachenlehrer betätigen. Ein großes Interesse an Sprache überhaupt sowie der eigenen Sprache im Besonderen und auch ein Bedarf an sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen ist dennoch vorhanden, wie man an Laiengesprächen über Sprache und Sprechen erkennen kann, nicht zuletzt auch an vielen unserer Textbeispiele, die von Sprache handeln, aber nicht von professionellen Linguisten stammen. Um sich vor Augen zu führen, worauf sich dieses Interesse bezieht, muss man sich lediglich vergegenwärtigen, was dem Sprachlerner, in dessen Lage wir uns bislang versetzt haben, noch fehlt.
Warum man in der Schule Fremdsprachen nur relativ schlecht lernt
Wir hatten oben angenommen, dass man sich eine Sprache in ihren Grundzügen etwa innerhalb eines Jahres aneignen kann. Dem steht nun gegenüber die leidvolle Erfahrung, die die meisten Leser dieses Buches gemacht haben werden: Sie haben nicht nur ein Jahr, sondern oft mehrere Jahre lang in der Schule Fremdsprachen gelernt – auch wenn es weniger intensiv war, auf vierhundert Stunden kommt man allemal! –, müssen aber feststellen, dass sie dennoch nicht in der Lage sind, sich in dem Land, dessen Sprache sie erworben haben, befriedigend zu verständigen. Man will im Alltag, auf Reisen usw. zurechtkommen, wozu doch eigentlich auch schon begrenzte Kenntnisse ausreichen sollten, und doch gelingt gerade dies oft relativ schlecht. Was diesen Fremdsprachlern fehlt, ist natürliche Kommunikationserfahrung.
Dass es gerade im Alltag zu Schwierigkeiten kommt, liegt daran, dass man sich im Alltagsverkehr normalerweise nicht der gepflegten Standardsprache bedient. Dies ist aber die einzige Varietät, die man in der Schule sinnvoll vermitteln kann. Es gibt nämlich für die Sprache des alltäglichen Umgangs und für so genannte Substandardvarietäten
Für natürliche Alltagskommunikation muss man den Substandard kennen
überhaupt keine kodifizierte Norm – das Normale ist vielmehr die Abweichung von der Norm, z.B. nachlässige Artikulation. Außerdem haben substandardliche Varietäten – gerade im Gegensatz zum Standard – eine meist nur eingeschränkte regionale Verbreitung; im Norden Frankreichs ist es eben anders als im Süden, wo sollte man da mit dem Unterricht beginnen? Schließlich wäre eine Vermittlung nichtstandardsprachlicher Formen auch deswegen gefährlich, weil sich Fremdsprachler keineswegs in derselben Weise eine Abweichung von der Norm erlauben dürfen wie Muttersprachler. Tun sie dies doch, so erzeugen sie bestenfalls Heiterkeit, schlimmstenfalls zieht ihr Verhalten soziale Abwertung nach sich. Demjenigen, der ein Jahr lang in seiner Heimat eine Fremdsprache gelernt hat, fehlt also das meiste von dem, was wir in Kapitel 5 als Wissensvoraussetzungen betrachtet haben, die zum Sprachwissen im engsten Sinne hinzukommen und die man nur in natürlicher Kommunikation mit Angehörigen der entsprechenden Sprachgemeinschaft lernt. Das umfasst selbstverständlich auch das Lesen verschiedenster Texte in dieser Sprache oder das Anschauen und Hören von Fernsehsendungen usw., so dass man sich auch außerhalb des Landes sehr viel intensiver mit dessen Sprache vertraut machen kann, als es ein normaler Sprachkurs möglich macht.
|45◄ ►46|
Textbeispiel 9: Wer kann Deutsch?
DAMIS. […] Nein, glaube mir, mein lieber Anton: der Mensch ist allerdings einer allgemeinen Erkenntnis fähig. Es leugnen, heißt ein Bekenntnis seiner Faulheit, oder seines mäßigen Genies ablegen. Wenn ich erwäge, wie viel ich schon nach meinen wenigen Jahren verstehe, so werde ich von dieser Wahrheit noch mehr überzeugt. Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, Französisch, Italienisch, Englisch – das sind sechs Sprachen, die ich alle vollkommen besitze: und bin erst zwanzig Jahr alt!
ANTON. Sachte! Sie haben eine vergessen; die deutsche –
DAMIS. Es ist wahr, mein lieber Anton; das sind also sieben Sprachen: und ich bin erst zwanzig Jahr alt!
ANTON. Pfui doch, Herr! Sie haben mich, oder sich selbst zum besten. Sie werden doch das, daß Sie Deutsch können, nicht zu Ihrer Gelehrsamkeit rechnen? Es war ja mein Ernst nicht. –
DAMIS. Und also denkst du wohl selber Deutsch zu können?
ANTON. Ich? ich? nicht Deutsch! Es wäre ein verdammter Streich, wenn ich Kalmuckisch redete, und wüßte es nicht.
DAMIS. Unter können und können, ist ein Unterschied. Du kannst Deutsch, das ist: du kannst deine Gedanken mit Tönen ausdrücken, die einem Deutschen verständlich sind; das ist, eben die Gedanken in ihm erwecken, die du bei dir hast. Du kannst aber nicht Deutsch, das ist: du weißt nicht, was in dieser Sprache gemein oder niedrig, rauh oder annehmlich, undeutlich oder verständlich, alt oder gebräuchlich ist; du weißt ihre Regeln nicht; du hast keine gelehrte Kenntnis von ihr.
ANTON. Was einem die Gelehrten nicht weis machen wollen! Wenn es nur auf Ihr das ist ankäme, ich glaube, Sie stritten mir wohl gar noch ab, daß ich essen könnte.
DAMIS. Du kannst essen, das ist: du kannst die Speisen zerschneiden, in Mund stecken, kauen, herunter schlucken, und so weiter. Du kannst nicht essen, das ist: du weißt die mechanischen Gesetze nicht, nach welchen es geschiehet; du weißt nicht, welches das Amt einer jeden dabei tätigen Muskel ist, ob der Digastricus oder der Masseter, ob der Pterygoideus internus oder externus, ob der Zygomaticus oder der Platysmamyodes, ob –
ANTON. Ach ob, ob! Das einzige Ob, worauf ich sehe, ist das, ob mein Magen etwas davon erhält, und ob mirs bekömmt. – Aber wieder auf die Sprache zu kommen. Glauben Sie wohl, daß ich eine verstehe, die Sie nicht verstehen?
DAMIS. Du, eine Sprache, die ich nicht verstünde?
ANTON. Ja; raten Sie einmal.
DAMIS. Kannst du etwa Koptisch?
ANTON. Foptisch? Nein, das kann ich nicht.
DAMIS. Chinesisch? Malabarisch? Ich wüßte nicht woher.
ANTON. Wie sie herumraten. Haben Sie meinen Vetter nicht gesehn? Er besuchte mich vor vierzehn Tagen. Der redte nichts, als diese Sprache.
DAMIS. Der Rabbi, der vor kurzen zu mir kam, war doch wohl nicht dein Vetter?
ANTON. Daß ich nicht gar ein Jude wäre! Mein Vetter war ein Wende; ich kann Wendisch; und das können Sie nicht.
DAMIS (nachsinnend). Er hat Recht. – Mein Bedienter soll eine Sprache verstehen, die ich nicht verstehe? Und noch dazu eine Hauptsprache? Ich erinnere mich, daß ihre Verwandtschaft mit der hebräischen sehr groß sein soll. Wer weiß, wie viel Stammwörter, die in dieser verloren sind, ich in jener entdecken könnte! – Das Ding fängt mir an, im Kopfe herum zu gehen!
|46◄ ►47|
Teildisziplinen der Parole-Linguistik
Auch Muttersprachler verfügen allerdings immer nur über einen Ausschnitt solchen Wissens, denn jedermanns Kommunikationserfahrungen sind notwendigerweise begrenzt. Am offensichtlichsten ist, dass wir das ganze Leben lang unseren Wortschatz erweitern (können), nie werden wir ihn vollständig beherrschen. Wörterbücher gehören deswegen auch zu den von Muttersprachlern am häufigsten benutzten Werken über Sprache, und Worterklärungen sind im Alltag besonders oft auftretende Formen der Metakommunikation. Aber auch an geläufigen Formen des Sprachgebrauchs, bestimmten Arten von Texten, lernen wir normalerweise im Laufe des ganzen Lebens hinzu, nicht zuletzt, weil diese sich verändern und vermehren (z.B. die Textsorten der neuen Medien: Teletext, E-Mail, Homepages usw.). Viele Textsorten brauchen wir auch nur in bestimmten Lebenslagen und müssen sie dann lernen: Wie mache ich eine Steuererklärung, wie halte ich eine Rede auf der Hochzeitsfeier meiner Tochter, wie schreibe ich eine Bewerbung, eine Seminararbeit, ein Gutachten …? U.a. um Fragen dieser Art geht es in der Teildisziplin der Text- und Gesprächslinguistik,
Text- und Gesprächslinguistik
die wir allerdings eigentlich zu den Kerndisziplinen hinzurechnen müssen, als Bereich, der sich mit einer weiteren Ebene – oberhalb des Satzes – beschäftigt. Denn auch für den Aufbau von (schriftlichen oder mündlichen) Texten aus Diskussionsbeiträgen, Abschnitten, Sätzen, Satzteilen, Wörtern, gibt es allgemeine und sprachspezifische Regularitäten.
|47◄ ►48|
Soziolinguistik
Die Untersuchung der Varietäten und ihres Einsatzes – wer spricht/ schreibt wo wann wie und warum? – fällt in den breiten Bereich der Soziolinguistik, des Studiums der Sprache im gesellschaftlichen Kontext. Da jedwede Äußerung in irgendeinem gesellschaftlichen Kontext steht, ist der Gegenstandsbereich dieser Teildisziplin nicht sehr gut abgrenzbar. Dazu rechnen können wir sowohl die Untersuchung des Sprachverhaltens bestimmter sozialer Gruppen, Berufsgruppen, subkultureller Gruppen, als auch des Sprachgebrauchs in den Medien, in Institutionen, in der Politik, der sprachlichen Verhältnisse in mehrsprachigen Gesellschaften, der Unterschiede des Sprachverhaltens von Stadt- und Landbevölkerung, von Männern und Frauen, Kindern, Jugendlichen, Rentnern, der nationalen Varietäten BRD-/West-, DDR-/ Ostdeutsch, Österreichisch, Schweizerisch usw. Auch die Dialektologie,
Dialektologie
die ihre Aufgabe lange darin sah, die ›reinen, unverfälschten‹ Dialekte zu beschreiben (und zu bewahren), ist heute soziolinguistisch orientiert und geht auch den Fragen nach, welche regional gekennzeichneten Formen – einen ausgeprägten Dialekt oder eine abgeschwächte Form oder eine landschaftlich gefärbte Umgangssprache… – wer wann
Historiolinguistik
wie einsetzt. Dasselbe können wir für die Historiolinguistik feststellen, denn selbstverständlich sind auch die einzelnen Sprachstadien nicht homogen, sondern sozial geschichtet und sie spiegeln die gesellschaftliche Struktur einer geschichtlich umgrenzten Kommunikationsgemeinschaft. Eine scharfe Abgrenzung der Soziolinguistik ist auch nicht möglich gegenüber der Teildisziplin, die als Pragmalinguistik
Pragmatik
oder Pragmatik (von griechisch pragma ›Handlung‹) bezeichnet wird und die Sprechen als eine Form menschlichen Handelns begreift. Dass eine Abgrenzung zur Soziolinguistik kaum möglich ist, ergibt sich daraus, dass, wer sprachlich handelt, natürlich als soziales Wesen handelt. Mitunter – besonders in der Forschung der DDR – sprach man in diesem Zusammenhang auch von kommunikativ-funktionaler Sprachbetrachtung. Über solche Begriffe wie auch über eine ohnehin nicht mögliche saubere Abgrenzung dieser Disziplinen lohnt es jedoch nicht zu streiten. Am sinnvollsten ist es, hier zusammenfassend von der Linguistik des Sprachgebrauchs, der Parole-Linguistik zu sprechen, so wie man die Kerndisziplinen, die langues beschreiben, als Systemlinguistik zusammenfasst.
Damit soll die Übersicht über linguistische Subdisziplinen abgeschlossen werden. Die ›Landkarte‹ ist allerdings nicht vollständig, sondern zeigt nur die größten Kontinente, mit denen wir uns auf unserer kleinen Erkundungsfahrt begnügen müssen. Die folgenden Kapitel sind nun nicht für jeweils einen dieser Teilbereiche reserviert, vielmehr wollen wir von einzelnen Phänomenen und Fragestellungen ausgehen und auf theoretische und methodische Fragen sowie auf Aspekte der Beschreibung der Sprache und ihres Gebrauchs immer dort eingehen, |48◄ ►49| wo es sinnvoll erscheint. Wir beginnen bei dem, was für jeden Sprachteilhaber am leichtesten zugänglich ist, nämlich einzelne sprachliche Zeichen, und wollen zunächst – wie oben angekündigt – Saussures Modell des sprachlichen Zeichens vorstellen.
|49◄|