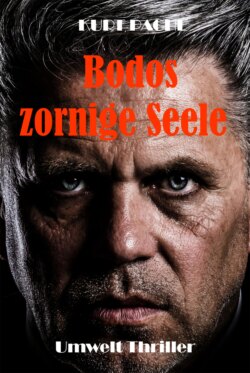Читать книгу Bodos zornige Seele - Kurt Pachl - Страница 14
Kapitel 12
ОглавлениеDer Kampf sollte bereits am darauffolgenden Tag in die nächste Runde gehen.
Marco war ein wenig darüber verärgert, dass Bodo ihn bat, hier in den beiden Hotels die Stellung zu halten, wie er es nannte.
Doch wenn der IT-Spezialist gewusst hätte, wie der Ausflug dieser Crew verlaufen würde, wäre er Gott dankbar dafür gewesen, sich hier in den Hotels zu langweilen.
Unmittelbar nach dem Frühstück brach eine streitbare Crew mit Bradlys Yacht auf: Bradly, Bodo, Ole, Nuncio, Umberto, Paco, Tajo und Julio.
Ihr Ziel war die kleine Stadt Venice im Mississippi-Delta. Sie wollten erkunden, wo im Delta sie am Sonntag oder spätestens am Montag Hilfe leisten konnten. Allen Berichten zur Folge würde dann die braune Brühe in das Delta vorgedrungen sein.
Der Sturm sollte so stark werden, dass alle ausgebrachten Barrieren wie Spielzeuge weggeschleudert würden. Am Dienstag sollte es allerdings wieder windstiller werden.
Als Marco sah, was Bradly und Ole in die Yacht schleppten, war er beruhigt und beunruhigt zugleich. Er kannte die Futterale von der Aktion in Labrador. Dieses Mal waren sie allerdings in Tarnfarben gehalten. Für ihn gab es keinen Zweifel: In einem dieser Futterale befand sich wieder eine todbringende M82.
Bradly hatte, wie nicht anders zu erwarten war, von der Fahrt abgeraten.
»In Venice wird die Hölle los sein«, hatte er gewarnt.
Während der Fahrt waren die Männer schweigsam. Ole brauchte die drei Maschinenpistolen nicht erklären. Einen Schalldämpfer für die M82 konnte Bradly in der Kürze der Zeit nicht organisieren.
An die restlichen Männer wurde je eine Pistole verteilt; Kaliber 22 lang, 15 Schuss im Magazin; leider auch ohne Schalldämpfer.
Bradly hatte nicht übertrieben. Das sonst so verschlafene Städtchen Venice, verkehrstechnisch am äußersten Zipfel des Mississippi-Deltas gelegen, kochte und war in heller Aufruhr.
Überall standen schimpfende Fischer und weinende Frauen. Zum Wochenende sollte für Louisiana der Notstand ausgerufen werden. Das schloss ein Fischereiverbot mit ein. Der US Fish- und Wildlife Service hatte mitgeteilt, dass 20 Naturschutzgebiete bedroht seien. Am Wochenende müsse man mit dem Schlimmsten rechnen.
Der Mineralöl-Konzern hatte große Hinweisschilder mit der Aufschrift »Informations-Zentrum« aushängen lassen.
Sie suchten händeringend nach Fischern mit Booten. Diese sollten dabei helfen, Ölbarrieren auszubringen. Dafür zahlte der Konzern bis zu 1 200 Dollar pro Tag. Gleichzeitig konnte man Ansprüche wegen Umsatzausfall geltend machen. Viele liefen mit einem Scheck aus diesen Büros. Das Wort »Teilvergleich« auf diesen Schecks las oder verstand niemand. Mittlerweile waren einige Fischer von weit draußen zurückgekommen und in Krankenhäuser eingeliefert worden. Sie waren mit der Ölbrühe, vielleicht versetzt mit Corexit oder den Rückständen der Abfackel-Aktionen, in Berührung gekommen. Wer wusste das schon so genau?
Viele Einwohner von Venice liefen nun mit großen Schildern durch die Straßen. »Sie töten unsere Zukunft«, war zu lesen.
Bradly stapfte voraus und zwängte sich durch die wütende Menge. Bodo und die anderen Männer versuchten, den Anschluss zu halten.
»Dort«, sagte der Mann aus Biloxi, und zeigte auf ein Haus, welches eher einer Baracke ähnelte.
Über dem Eingang war ein Schild mit der Aufschrift Coast Guard angebracht; eine Außenstelle von Grand Isle, hatte Bradly zuvor berichtet. Ole wies mit fast nicht zu erkennenden Handbewegungen Julio und Tajo an, sich vor dem Eingang zu postieren. Sie wollten für einige Minuten nicht gestört werden.
In der Baracke standen zwei Schreibtische. Hinter beiden Tischen saßen uniformierte Beamte.
»Hallo Henry«, begrüßte Bradly einen schlanken Mann mit schütterem Haar. Bodo schätzte ihn auf sechzig Jahre. Er hatte seine Uniformjacke ausgezogen, und über die Stuhllehne gehängt. Seine Krawatte war leicht geöffnet, und der obere Knopf des blauen Hemdes war offen.
Mit raschen Blicken musterte der Angesprochene die vier Männer, welche den Inhaber des »Let’s go« begleiteten. Er hielt es für angebracht, mit einem »Guten Tag Mr. Bryant« zu antworten.
Der zweite, etwa Dreißigjährige, musterte mit seinem Frettchengesicht verschlagen jeden der Eingetretenen ausführlich. Das Frettchen roch den Ärger. Instinktiv zog er seine Krawatte zurecht, ohne jedoch zuvor den obersten Knopf zu schließen.
»Okay Sergeant Monfort«, begann Bradly nun betont höflich. »Meine Freunde hier sind Umweltschützer, die helfen wollen. Sie sind alle ausgewiesene Experten für Ölunfälle. Spätestens bis zum Sonntag wird hier jede Hand gefragt sein. Wir wollten Sie ….«
Der Sergeant unterbrach ihn barsch.
»Wir haben genug Experten. Am Wochenende wird hier eine ganze Armada anrücken. Denen könnt ihr euch anschließen. Ihr bekommt sogar Geld dafür.«
»Mein Freund kennt sich hier gut aus«, versuchte Bodo, freundlich das Wort zu ergreifen. »Wir möchten Sie bitten, uns Ausweise auszustellen und uns ein Gebiet zu nennen, welches auch aus Ihrer Sicht besonders schützenswert ist.«
Montforts Gesichtsausdruck wurde finster.
»German?«
»Ja, Mister Montfort«, fuhr Bradly fort. »Und die anderen Herren kommen aus Italien und Spanien.«
Der Sergeant sprang auf. Angriffslustig beugte er sich nach vorn.
»Ihr Umweltfuzzis glaubt wohl, dass wir Typen aus Europa brauchen.« Er starrte Bodo bösartig an.
»Noch dazu einen Nazi.«
Bodo hatte aus seinem Augenwinkel beobachtet, dass das Frettchen mit der rechten Hand sich Millimeter für Millimeter an sein Handy herantastete. Bodo blickte Ole an und stellte fest, dass dieser den Vorgang ebenfalls beobachtet hatte. Dieser flüsterte nun Nuncio etwas ins Ohr, der daraufhin rasch den Raum verließ.
Bodo hob beide Hände.
»Bitte verzeihen Sie. Wir dachten, dass Sie daran interessiert sind, ihre Heimat möglichst professionell zu schützen«, versuchte er es mit seiner ausgesucht ruhigen und freundlichen Stimme. Mit diesen Worten trat er einige Meter nach rechts. Montfort sollte damit signalisiert werden, dass er fortan ruhig sein würde. Bodo stand nun genau vor dem Schreibtisch des Frettchens. Jetzt konnte er das Namensschild auf dem Schreibtisch lesen.
Das Frettchen hieß Sam Bourquoi – und es machte den Fehler, eine Taste seines Handys bedienen zu wollen. Blitzschnell packte Bodo den hageren Beamten, und zog ihn über den Schreibtisch, als sei er eine Puppe. Sam Bourquoi flog in hohem Bogen zunächst bis zur Mitte der Baracke. Dort überschlug er sich, donnerte gegen die Holzwand, und blieb zitternd und mit aschfahlem Gesicht am Boden liegen.
Montfort blieb mit aufgerissenen Augen einige Sekunden wie angewurzelt stehen. Erstaunlich schnell glaubte er, die Situation erkannt zu haben, und versuchte nun zum Revolver zu greifen.
»Stopp!« Bodos Stimme war laut und befehlend. »Lassen Sie diesen Unsinn.«
Der Sergeant behielt seine Hand am Revolvergriff.
»Du Nazi. Willst du mir etwa drohen?«
»Ja«, sagte Bodo und nickte.
»Wenn es sich um wichtige Dinge handelt, bin ich völlig humorlos.«
Wie von Geisterhand hatten Paco und Ole plötzlich ihre Pistolen in den Händen. Die Schalldämpfer der Pistolen waren auf Montfort gerichtet.
Blitzschnell nahm der Sergeant seine Hand vom Revolvergriff und hob beide Hände in Brusthöhe.
In diesem Augenblick betrat Nuncio die Baracke. Er hatte eine rote Schwimmbarriere geschultert, die er auf den Boden krachen ließ.
Umberto trat rasch hinzu. In wenigen Sekunden hatten sie die Barriere in zwei Teile geschnitten. Nuncio breitete eine Hälfte in der Mitte der Baracke aus. Das Frettchen begann zu zittern. Es schien förmlich zu riechen, dass diese Vorbereitungsarbeiten Unheil bedeuteten; großes Unheil.
Der Sergeant starrte mit großen Augen zunächst auf Nuncio und dann auf Umberto. Danach blickte er Bodo fragend an. Ihm war inzwischen klargeworden, dass Bodo diese Gruppe befehligte – und, wie dieser gerade gesagt hatte, völlig humorlos zu sein schien.
Ole zog sich theatralisch gummierte Handschuhe an. Dabei blickte er Nuncio kurz an, und schloss für zwei Sekunden seine Augen. Mit raschen Schritten stand Nuncio plötzlich bei dem jungen Beamten und packte ihn mit einer Hand an dessen Uniform. Mit einer kräftigen Bewegung zog er ihn hoch, und stellte den schlotternden Mann auf die Mitte der ausgebreiteten Schwimmbarriere.
»Ich habe Familie«, wimmerte Sam.
Im Raum entstand Stille. Die Geräusche von Venice wehten durch ein halboffenes Fenster herein.
Ole bewegte sich nun auf Bodo zu. Dabei musste er am Schreibtisch von Montfort vorbei. Dieser hielt seine beiden Hände noch in Brusthöhe. Mit bleichem Gesicht sah er nun, dass Ole fast an ihm vorbeiflog. Mitten in diesen drei großen Sätzen hatte dieser plötzlich etwas in der Hand. Und dieses Etwas fühlte Montfort nun um seinen Hals. Der Graumelierte sackte in die Knie, und versuchte vergeblich mit beiden Händen unter die Schlinge der Garrotte zu greifen. Seine Augen waren vor Schmerz und Angst weit aufgerissen. Seine Zunge rutschte aus dem Mund.
Nuncio zog anerkennend die Augenbrauen hoch. Umberto schaute interessiert. Bodo verzog keine Miene, während Bradly unwillkürlich an seinen Hals griff. Er wusste inzwischen, wie sich eine Garrotte anfühlte.
Der junge Beamte war im Begriff, vor Entsetzen zu schreien. Doch Nuncios Klinge war schneller. Die beiden Beamten der Küstenwache starben gleichzeitig.
Während das Team Bradly und Nuncio sowie Paco und Umberto die beiden Leichen in die rote Folie wickelten, verstaute Ole die Garotte in eine kleine mitgebrachte Plastiktüte, die er dann in seiner Gesäßtasche verschwinden ließ. Anschließend sah er sich zusammen mit Bodo prüfend im Raum um. Es durften keine Spuren zurückbleiben. Alle Aktivisten waren angewiesen worden, keine Gegenstände zu berühren. Ole nickte schließlich zufrieden.
Bradly und Paco warfen die roten Plastikbündel über ihre Schultern. Bradly hatte sich beim Hinausgehen eine gelbgrüne Schirmmütze mit dem Konzernlogo geschnappt, und zog diese tief ins Gesicht. In Venice kannten ihn viele Fischer. Aber heute war ihnen nicht nach einem Plausch zumute.
Bodo, Nuncio, Umberto und Tajo gingen voraus und bahnten sich einen Weg. Bradly und Paco wurden mit ihren Paketen in die Mitte genommen. Julio und Ole bildeten die Nachhut. Ole hatte inzwischen seine Handschuhe abgestreift und eingesteckt. Mit raschen Bewegungen hatte er zuvor ein kleines Stückchen Tuch aus seiner Jackentasche gezogen, um damit die innere und äußere Türklinke abzuwischen.
Stoisch, den Blick nach unten gerichtet, stapfte die seltsame Kolonne ruhig zur Yacht zurück. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass sich später jemand an die acht Männer erinnern würde. Dass man gegenwärtig rote Schwimmbarrieren geschultert hatte, war eine alltägliche Szene.
Nach zehn Minuten waren sie auf der Yacht. Kurz hinter Venice in Richtung der East Bay blickte Bradly vom Steuerrad auf.
»Das Mississippi-Delta bringt uns kein Glück. Lass uns am Sonntag zu den Breton Islands fahren - zu deiner Insel. Auch dort braucht man unsere Hilfe. Denke an die vielen Braunen Pelikane. Was hältst du davon, wenn wir dort kurz vorbeifahren? Es ist ja kein Umweg.«
Bodo nickte. »Gute Idee. Einverstanden.«
Zwei Stunden später ging Bradly an der gleichen Stelle vor Anker, an der sie vor einigen Tagen übernachtet hatten. Unterwegs hatten sie sich auf offener See der beiden Bündel entledigt.
Am Freitag hatte sich der Wind gedreht. Stürme peitschten auf das Land zu. Die viele hundert Kilometer langen Ölsperren tanzten auf den Wasserkronen. Der Ölteppich schwappte über die Sperren und über die Boote mit tausenden von Fischern und Helfern hinweg. Es war unerheblich geworden, dass man es nicht geschafft hatte, über tausende von Kilometer keine Ölsperren auszubringen. Die Nationalgarde errichtete mit einer großen Anzahl Bagger riesige Dämme. Sandwaschanlagen versuchten, den Sand aufwändig zu reinigen; 50 Tonnen verölter Sand pro Stunde. Die Wasserläufe, Inseln und Marschen dahinter wurden hermetisch abgeriegelt; vorläufig zur absoluten Sperrzone erklärt. Auf die Chandeleur Inseln mit den Breton Island National Wildlife Refuge dahinter arbeitete die wütende See in wenigen Stunden einen Ölteppich heran: 202 x 112 Kilometer zähflüssige, stinkende Brühe. Und die See brüllte immer lauter und bedrohlicher.
Als sich am Tag darauf der Sturm gelegt hatte, versuchte die Küstenwache mit fünfzehn sogenannten kontrollierten Bränden, das Öl an der Oberfläche abzufackeln. Die Rauchsäulen waren hundert Kilometer weit zu sehen. Fieberhaft versprühten die Lockheeds ununterbrochen Corexit; über zehn Millionen Liter. Sie nahmen keine Rücksicht darauf, dass 275 Schiffe mit Helfern Öl abschöpften. Tage später machten die Hubschrauber der Fernsehstationen 5 300 Schiffe und Boote aus, von denen entweder Öl abgeschöpft wurde oder man hastig versuchte, Ölbarrieren auf eine Länge von weiteren 3 000 Kilometern auszulegen. An den Stränden und später auf den Inselchen und in den Marschen sollten nun über 40 000 Helfer so rasch wie irgend möglich die Ölrückstände beseitigen. Sie waren zum Teil aus dem Landesinneren herangekarrt worden; Junge, Alte, Arbeitslose, Studenten. Sie stopften die großen Ölklumpen in große, weiße Plastiksäcke, walzten unkontrolliert durch die Marschen, und steckten alles, was eine braune oder dunkle Farbe hatte, in diese Säcke. In vielen Säcken war noch deutliches Leben zu erkennen – doch nicht mehr lange.
Spezialisten achteten darauf, dass keine Film- und Fotoaufnahmen gemacht wurden. Helfer von Umweltorganisationen wurden vor allem durch die Küstenwache, aber auch dem US Fish- und Wildlife Service, daran gehindert, sich langsam und überlegt in die sensiblen Gebiete vorzuarbeiten. Es war Brutzeit, und Millionen von Wasservögel brüteten gerade. Bodo war zornig auf Ronald, den Chef des Wild- und Wildlife-Service. Er kam aus Greetsiel in Deutschland. Er hatte nicht den Mumm, sich gegen die Ölmafia und deren Helfershelfer durchzusetzen. Aber - was sollte letztlich ein Einzelner gegen diesen Sumpf ausrichten, der sich im Laufe von Jahrzehnten wie ein bösartiges Krebsgeschwür ausgebreitet hatte? Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns. Diesen Satz kannte Bodo zur Genüge. Dem Innenministerium war auch die wichtige Rohstoffbehörde MMS, der Mineral Management Service, unterstellt. Sie vergaben Lizenzen an die großen Ölkonzerne. Ihre Aufgabe sollte es sein, wichtige Vorschriften zu erarbeiten - und diese letztlich zu überwachen.
Das Deepwater-Desaster brachte Wochen und Monate später einen Sumpf an Bestechung, Korruption und Dekadenz ans Licht, der jegliches Vorstellungsvermögen sprengte.
Der Vorstandsvorsitzende des englischen Ölkonzerns hatte die Aktienkurse in schwindelerregende Höhen getrieben. Die wichtigen Mitarbeiter der MMS ließen sich über Jahre bestechen, und schauten über die laxen Vorgaben und Einhaltungen von Sicherheitsbestimmungen des Konzerns hinweg. Oder sie halfen sogar dabei, bestehende Vorschriften zu umgehen. Sie vereinnahmten die wichtigsten Beamten der Küstenwache und anderer Organisationen. Es war nur eine Frage der Zeit, wann diese Bombe hochgehen musste.
Die Leiterin der MMS trat zurück, und übernahm alle Schuld der Vorgänger. Der Vorstandsvorsitzende des englischen Ölkonzerns ließ sich seinen Rücktritt mit einer millionenschweren Abfindung und einem lebenslangen jährlichen Pensionsanspruch von 600 000 Dollar pro Jahr versüßen. Bereits ein Jahr später gründete er mit einem türkischen Milliardär ein Unternehmen, um im Norden des Irak Öl zu fördern. Einen zweiten Job erhielt er als Chairman eines Schweizer Rohstoffriesen; mit einer jährlichen Vergütung von einer Million Dollar; wie der SPIEGEL berichtete. Und nebenher engagierte er sich als Experte und Berater für eine US-Finanzfirma. Im Golf von Mexiko hinterließ er einen Scherbenhaufen. Allein die Fischerei in dieser Region hatte einen vorläufigen Schaden von 2,5 Milliarden Dollar. Der Tourismus-Bereich verzeichnete ein Minus von über 3,0 Milliarden Dollar, und Ende 2010 rechnete man damit, dass bis zu 100 000 Arbeitsplätze verloren gegangen waren oder noch würden.
Dieses Desaster war so gigantisch, dass der kurz-, mittel- und langfristige Verlust für die Schöpfung fast völlig ins Hintertreffen geriet. Wie hätte man auch den Verlust von vielen Delfinen, Millionen Vögeln und Billionen von Lebewesen im Golf von Mexiko beziffern und bewerten können? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wer misst und wer bewertet alle übrigen Lebewesen?
Drei Monate vor seinem Rücktritt sagte der Vorstandsvorsitzende des Ölkonzerns in einem Interview, dass es im Golf von Mexiko immer noch mehr Wasser als Öl gäbe. Er bestritt vehement, dass sich unter Wasser riesige Ölschwaden durch das Corexit gebildet hatten. Wissenschaftler wiesen bereits damals auf eine Unterwasser-Wolke von 16x6 Kilometer hin. Die Küstenwache überwachte sorgsam, dass keine ungenehmigten Untersuchungen angestellt werden konnten. Wissenschaftler auf der einen und die Lobby der Ölmafia incl. der MMS und der Küstenwache auf der anderen Seite stritten über die genauen Mengen Rohöl, welche immer noch aus dem Bohrloch in 1 500 Meter Tiefe herausschossen. Dem Konzern gelang es zu verhindern, dass Wissenschaftler entsprechend aussagefähige Messmethoden anstellten.
Später wurde bekannt, dass mindestens 700 Millionen Liter Rohöl in den Golf von Mexiko geflossen waren.
Einen Großteil dieser braunen Brühe hatte man mit Erfolg daran gehindert, bis an die Oberfläche zu gelangen. Dies war nur möglich gewesen, da mindestens sieben Millionen Liter Corexit ausgebracht worden waren. Die Hälfte davon wurde in der Nähe des Bohrloches verteilt, so dass das Öl tief unten im Golf von Mexiko dispergierte, um daraus Wolken aus monoaromatischen Kohlenwasserstoffen entstehen zu lassen.
Ein Unterwasserfahrzeug der WHOI machte Ende Juni 2010 in einer Tiefe von 1 100 Metern eine solche Wolke aus; mit einer gigantischen Ausdehnung von 35x1,9 Kilometer und einer Höhe von 200 Metern; nur eine von unendlich vielen Wolken dort unten.
Marco hatte Bodo in den letzten Tagen mit großer Sorge beobachtet. Nachdem er lange mit sich gerungen hatte, setzte er sich schließlich mit Iris in Verbindung, um sie um Rat zu fragen.
Sie hatte bereits den Koffer gepackt, und wollte eine Stunde später zum Flughafen Frankfurt fahren. Iris hielt es vor allem für sinnvoll, Bodo nicht mit weiteren Daten und Fakten zu versorgen. Stattdessen war es dringend geboten, ihn mit anderweitiger Arbeit einzudecken oder abzulenken.
Darüber sollte Marco auch mit Ole sprechen.
Bodo wollte wieder die Aktivisten vom Flughafen Biloxi abholen. Die einhundert Helfer hatten ein Anrecht darauf.
Die kommenden Tage oder Wochen würden schwer genug werden.
Bradly hatte zwei Omnibusse organisiert. Für einen Bus war er und für den anderen Bodo zuständig.
Doch kurz vor der Abfahrt hielt es Marco für sinnvoller, die Aufgabe mit Bradly zu tauschen. Er gab vor, die meisten der Ankommenden besser zu kennen. Bradly schmollte.
Bodo wurde, wie von Marco erwartet, zunächst von einigen Frauen umringt. Es war die IT-Expertin Alisha Caldwell, welche sofort mit einem »Boodooo« an dessen Hals hing.
Sie und die hübsche Biologin Mary-Jane Owen kannten sich von den Eco Warriors.
Beide Amerikanerinnen waren lange Zeit in einem Little Guantanamo für Frauen malträtiert worden.
Die Amerikanerin Ann Chandler leitete inzwischen die größte Psychiatrie in New York. Sie begnügte sich nicht mit einem Küsschen auf die Wange, sondern gab Bodo einen herzhaften Kuss auf die Lippen.
Iris registrierte diesen Vorgang aus der Ferne, wurde jedoch sofort von Marco in Beschlag genommen.
Die amerikanische Crew wurde komplettiert durch den Psychologen Travis Bullock, vom IT-Guru Ad McCoy und vom Sicherheits-Experten Gabe Whitley. Sie alle waren in Little Guantanamo inhaftiert gewesen.
Danach bahnte sich die deutsche Mannschaft einen Weg durch die große Zahl der angekommenen Aktivisten, um vor allem Bodo zu begrüßen:
Bodos langjährigste Wegbegleitern, die Biologin Simone van Zween, Nils Ruffuß, und die Ärztin Sylvia Wollstedt, welche inzwischen die rechte Hand von Iris geworden war.
Aus Frankreich waren angereist: Die Psychologin Solange Colin, der Biologe Pierre Montfort, der IT-Spezialist Yves Desjardins und der Sicherheits-Mann Vince Mauriac. Sie alle kannten Bodo von vielen Umweltrettungsaktionen.
Die Biologin Malvina Haddock aus England bat im Namen von Peggy Fairchild um Entschuldigung. Peggy wurde durch einige schwierige Patienten an ihre Psychiatrie gebunden.
Malvina ist noch hübscher geworden, dachte Bodo. Ihr sah man die Einundvierzig nicht an. Mit Duncan Drake, dem IT-Spezialisten, korrespondierte Marco fast wöchentlich.
»Dein Freund flirtet mit dieser hübschen Dame da hinten«, begrüßte Duncan Drake seinen Freund Bodo.
»Das ist Iris Saß aus Frankfurt.«
»Soso, das also ist deine Iris.«
Bodo hätte gerne gefragt, was Duncan mit dieser Bemerkung gemeint hatte. Doch die große Hand von Errol Dennehy auf seiner Schulter ließ ihn leicht zusammenzucken.
Errol war ein athletischer Sicherheits-Experte aus England. Er hatte Bodo bereits bei zwei Aktionen gegen japanische Walfänger begleitet.
»Endlich kann ich Sie persönlich kennenlernen«, begrüßte Bodo die Biologin und Indianerin Awanasa Archambeau.
»Sage bitte Awa zu mir. So nennt mich auch Amaro. Sonst könnte ich nicht Bodo zu dir sagen.«
Bodo gab Awa einen Kuss auf die Wange. Das also war die Frau von Amaro Nguyen, mit dem er so lange in Little Guantanamo eine Zelle geteilt und der ihn vor zwei Wochen bei der Aktion gegen die Robbenschlächter begleitet hatte.
Auch Priscilla Evrard, eine Ärztin aus Kanada, lernte Bodo erst heute kennen. »Mayana, meine mexikanische Orchidee.«
Bodo umarmte Mayana Robles. Sie hatte die südamerikanische Zelle der Friends oft the Earth aufgebaut; zusammen mit der Biologin Rosabella Talamantes aus Brasilien.
»Das ist Cristobal Ycayo aus Ecuador«, sagte Rosabella.
»Er wollte dich unbedingt einmal persönlich kennen lernen.«
Der 160cm große Indio mit tiefschwarzen, fransigen Haaren streckte Bodo die Hand entgegen. Er sah Bodos fragenden Gesichtsausdruck.
»Ich spreche fließend Englisch, habe studiert und schieße noch perfekt mit dem Blasrohr«, sagte der Mann aus Ecuador mit einem breiten Grinsen.
»Es würde mich glücklich machen, wenn Sie in den nächsten Tagen eine halbe Stunde Zeit für mich hätten.«
Bodo ergriff die Hand des Indios mit seinen beiden Händen.
»Bitte sag »Bodo« zu mir. Selbstverständlich nehme ich mir so viel Zeit, wie wir brauchen. Ich habe mich über die Probleme in deinem Land auf dem Laufenden gehalten. Und ich verspreche dir, dass ich, sobald es mir zeitlich möglich ist, nach Ecuador reisen werde.«
Er legte seine Hand auf Cristobals Schulter.
»Dann bringst du mir bei, wie man mit dem Blasrohr schießt. Abgemacht?«
Der Akademiker aus den Sümpfen Ecuadors schüttelte nun mit seinen beiden Händen die von Bodo.
»Ich freue mich. Danke Bodo. Danke.«
Zum Schluss begrüßte Bodo die äußerst gepflegte Biologin Amaya Avenalleda, die ihn anhimmelte, und darauf bestand, ihm ein zartes Küsschen auf die Wange zu hauchen. Dazu musste sich Bodo zu ihr herunterbeugen. Amaya schlang kurz ihre Arme um Bodos Nacken.
Die Umstehenden lachten und klatschten.
Bodo löste sich von der Gruppe und ging mit raschen Schritten zu Iris und Marco, die etwas abseitsstanden.
»Was, um alles in der Welt, habt ihr so lange zu quasseln?«
Mit diesen Worten wollte Bodo Iris einen Kuss auf die Wange geben. Doch sie nahm ihn in die Arme und drückte sich für einige Sekunden an ihn. Sie versuchte, einen Augenkontakt herzustellen.
Mit Interesse verfolgten einige Damen diese Szene.
»Wir haben Hunger«, rief Ann Chandler laut, und machte dabei einen sehr säuerlichen Eindruck.
Bodo löste sich rasch von Iris und winkte.
»Wir haben zwei Busse direkt vor der Türe stehen. Wenn wir einige von diesen Schönheiten schon vor einer halben Stunde gehabt hätten, wäre es billiger geworden, diese Plätze zu reservieren.«
Gegen Abend hatten sich alle Aktivisten im Speiseraum des Nachbarhotels versammelt. Der Frühstücksraum in Bradlys Hotel wäre für 110 Personen zu klein geworden. Trotzdem musste die bunte Truppe eng zusammenrücken. Aber vielleicht kam gerade deshalb eine gute Stimmung auf. Viele hatten sich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen. Es war das erste Mal, dass Aktivisten aus so vielen Ländern zusammenkamen. Einige waren völlig neu in dieser großen Gruppe. Darüber freute sich der Gastgeber besonders.
Bodo hatte Bradly gebeten, zwei Männer vor dem Hotel zu postieren. Weitere drei kräftige Männer aus Biloxi patrouillierten auf der gegenüberliegenden Straßenseite, von wo aus beide Hotels überwacht werden konnten; unauffällig.
Bevor das Essen und die Getränke serviert wurden, wollte Bodo eine Ansprache halten. Als er aufstand, und an sein Glas klopfte, wurde es schlagartig ruhig im kleinen Saal. »Das hier ist unser Freund Bradly«, begann er gutgelaunt, und legte seinen Arm auf Bradlys Schulter. »Im gehört das Hotel nebenan. Und diesem Burschen gehören auch unzählige Frauenherzen in dieser Stadt. Also Ladys: Passt auf eure Unschuld auf.«
Alle lachten, und der stämmige Bradly grinste zufrieden und leicht verlegen.
Danach wurde Bodos Gesichtsausdruck rasch ernster.
»Danke meine lieben Freunde, dass ihr hierher, an den Golf von Mexiko, gekommen seid. Es scheint unser aller Schicksal zu sein, dass wir uns immer nur dann zusammenfinden, wenn unserer Mutter Erde wieder einmal Leid zugefügt wurde. Es fällt mir zunehmend schwerer, sagen zu müssen, dass uns nur, wie so viele Male, eines übrigbleibt: Wir müssen wieder einmal retten, was zu retten ist. Auch diese Tragödie konnten wir im Vorfeld leider nicht verhindern.«
Er schluckte kurz. Eine einzige Träne rollte über seine rechte Wange. Einige Anwesende, die nur wenige Meter von ihm entfernt saßen, zuckten unwillkürlich zusammen. Auch Iris, die sich auf jedes Wort, jede Mimik und jede Gestik konzentrierte, hatte diese Träne ebenfalls gesehen.
»Verdammt. Ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich mir Sorgen um unsere Schöpfung mache … und dass mich das zunehmend mehr bewegt.«
Bodo machte eine Kunstpause und lächelte Hachiko an.
»Hachiko mein Freund. Fünfundsechzig Tage hast du es in dreißig Metern Höhe ausgehalten. Tag und Nacht. Auch im Regen. Der riesige Mammutbaum, tausende Jahre alt, durfte weiterleben. Wer weiß … vielleicht wird er noch stehen, wenn es keine Menschen mehr auf dieser Erde gibt.«
Er blickte wieder in die Runde.
»Dafür haben sie Hachiko nach Little Guantanamo verfrachtet - und ihn dort fast jeden Tag verprügelt. Hier unter uns sind fünfzehn weitere Öko-Krieger, die durch die Hölle von Little Guantanamo gegangen sind. Ich war auch einer von diesen sogenannten Öko-Terroristen.«
Nun blickte er zu Ole.
»Ole mein Freund. Um ein Haar hätten dir die japanischen Walschlächter den Garaus gemacht. Was würde ich ohne dich machen?«
Bodo breitete nun beide Hände aus.
»Und mit den meisten Freundinnen und Freunden hier im Raum habe ich schon oft im kalten und stinkenden Ölschlamm gestanden: In Wales, in der Bretagne, wo über dreihunderttausend Seevögel jämmerlich verendeten. Wir konnten nur einen kleinen Teil retten. Oder an der spanischen Westküste, wo sich über siebenhundert Helfer ärztlich behandeln lassen mussten. Wir haben gemeinsam gefroren. Wir haben geflucht. Wir haben gebetet. Und fast jeder von uns kennt dieses Gefühl: Dieser Vogel - von den vielen Hunderttausenden - dieser eine Vogel, den wir über eine Stunde gereinigt, und den wir gestreichelt hatten … Der wird und der muss überleben. Und dann - dann sackt trotzdem das Köpfchen nach unten. Immer dann kroch eine dumpfe Ohnmacht in uns hoch. Viele Aktivisten, die von den Einsätzen oder aus Gefängnissen wieder nach Hause kamen, wurden in Krankenhäuser oder Psychiatrien eingeliefert.«
Die anschließende Pause dauerte viele Sekunden. Alle Aktivisten im Raum schienen den Atem anzuhalten. Stille. Mit leiser Stimme fuhr er fort.
»Einige konnten die grausamen und quälenden Bilder nicht mehr ertragen - nicht mehr aus ihren Köpfen bekommen. Sie sind heute nicht mehr unter uns.«
Bodo schaute nach oben. Dann hob er beide Hände flehend gen Himmel.
»Wir werden euch nicht vergessen! Ihr werdet immer unter uns sein! Eure Seelen sind in uns! Sie geben uns Mut, weiter zu machen. Sie spornen uns an, das Richtige zu tun. Doch - seid mir nicht böse, ihr Seelen da oben, wenn ich eure Mitstreiter heute bitte … «
Bodo blickte stumm in die Runde. Er versuchte, jedem einzelnen Aktivisten in die Augen zu schauen.
»Ihr hier … in diesem Raum … Ihr seid zu wichtig … Ihr seid zu kostbar … für unseren Kampf. Euer Leben ist kostbar! Helft euch gegenseitig, wenn euer Herz zu schwer wird … und eure Seelen vor Schmerzen weinen.«
Nach einer erneuten Kunstpause schwoll seine Stimme an. Die Mimik und Gestik folgte seinen Worten.
»Die Schöpfung braucht uns. Mehr denn je. In den nächsten Tagen oder Wochen werden wir wieder bis an unsere Grenzen geführt werden. Wir werden wieder wütend sein - und voller Zorn. Wir hatten in der Vergangenheit nicht nur helfen wollen, sondern gehofft, zumindest einen Teil der Menschen durch unsere Aktionen zu sensibilisieren und aufzurütteln. Doch die Mächtigen - mit ihren ekelhaften und verlogenen Worthülsen - diese Pharisäer. Sie waren sich nicht zu schade, von Werten, von Demokratie, von Ethik und von Moral zu sprechen. Sie haben von ihrer Verantwortung für die Zukunft gesprochen. Sie haben uns Bilder von vielen Arbeitsplätzen und Sicherheit an die Wand gemalt. Und in Wirklichkeit haben sie immer nur daran gedacht, wie sie ihre Macht ausweiten konnten; wie sie ihr Kapital vermehren konnten; wie sie es schaffen konnten, die Aktienkurse nach oben zu katapultieren und Geld zu scheffeln … ohne Rücksicht auf Verluste – seelenlos, charakterlos, schändlich, hassenswert. Ja, ich hasse sie, diese gierigen Bosse der großen Konzerne. Ich hasse diese ekelhaften Hasardeure und Zocker. Ich hasse diese charakterlosen Politiker, die sich kaufen ließen. Ich hasse diese Lobbyistenschweine, die sehr wohl wissen, was sie mit ihrem Tun anrichten. Ich hasse dieses gesamte kranke System, diese Helfer der Hölle, die Totengräber an unserer aller Zukunft. Dieser Brut fehlt es an jeglicher Empathie - nicht nur für ihre Mitmenschen, sondern vor allem auch für diese herrliche Schöpfung. Sie wagen es, sich in Kathedralen zu setzen und so zu tun, als würden sie beten. Ihr Gott ist das Gold. Niemals können sie mit Gott den meinen, der diese Erde mit allen Lebewesen erschaffen hat oder hat entstehen lassen. Ich habe mir viele der riesigen und blutenden Wunden auf dieser Erde angeschaut; in Europa, in den Staaten, in Russland, in China, in Indien, in Indonesien und Australien, in Japan und vor allem auch in Afrika. Diese Schöpfung stirbt in einer rasenden Geschwindigkeit. Was in hunderten von Millionen Jahren entstanden ist - diese scheinbar unzähligen Arten an Säugetieren, Vögeln, Insekten, Fischen, Korallen und Pflanzen - wird in zum Teil wenigen Jahrzehnten vernichtet … für immer … für ewige Zeiten … unwiederbringlich. Wenn es einen Gott, einen Schöpfer, gibt … und den gibt es! … muss er die Seelen dieser Untiere dereinst abweisen. Sie sollen, nein sie müssen, in der Hölle schmoren - für immerdar, bis in alle Ewigkeit.«
Bodo hatte sich in seine Ansprache hineingesteigert. Einige Worte schossen wie Pfeile aus ihm heraus; laut und akzentuiert. Es gönnte sich keine Pause, in der er sich seine Schweißtropfen von der Stirn hätte wischen können. Die Tropfen rannen über seine Nase, über seine Wangen und seinen Hals. Er stieß erkennbar an die Grenze seiner Kraft.
Die nachfolgenden Sätze fielen deshalb leiser und weniger emotionsgeladen aus.
»Gerade hier, in diesem dekadenten Land, rennen unzählige Menschen irgendwelchen pseudoreligiösen Heilsbringern hinterher. Sie glauben daran, dass Gott diese herrliche Schöpfung in wenigen Wochen erschaffen hat. Die meisten von diesen Menschen sind Pharisäer und verlogene Individuen. Wenn sie wirklich an Gott und wirklich an einen Schöpfer glauben - und wenn sie wirklich Angst vor dem Jüngsten Gericht haben - wie ist es dann zu verstehen, dass sie nicht innehalten? Das kleine Häuschen mit den großen Schulden ist ihnen wichtig! Das große Auto mit dem hohen Spritverbrauch ist ihnen wichtig! Die Wolkenkratzer und die hellerleuchteten Häusermeere sind ihnen wichtig! Luxus ist ihnen wichtig! Sie wollen viel Fleisch auf ihren Tellern haben. Immer mehr. Sie fragen nicht nach den unsäglichen Qualen, die damit einhergehen. Sie haben einen unstillbaren Energiehunger. Sie wissen sehr genau, wie viele Kriege nur deswegen geführt wurden - und weiterhin geführt werden. Unsere Welt ist heute gläsern. Niemand kann und darf sagen: Das habe ich so nicht gewusst. Richtig ist, dass die meisten dieser Wesen kein Gefühl mehr haben; für ihre Mitmenschen, für die Zukunft und letztlich für die Schöpfung.
Natürlich gibt es Ausnahmen, wenige Ausnahmen - Gott sei Dank.«
Erst jetzt machte Bodo eine Verschnaufpause. Er kramte nach einem Taschentuch und stellte fest, dass dieses sofort durchnässt war. Stille herrschte im Raum. Es hatte den Anschein, dass es niemand wagte zu atmen. Keiner räusperte sich. Keiner griff nach seinem Glas, um seine trocken gewordene Kehle zu befeuchten.
»Gehet hin und mehret euch und macht euch die Erde untertan.«
Bodo schüttelte mit dem Kopf und verzog verächtlich den Mund.
»Was für eine Blasphemie klingt aus diesem Satz, den Gott im Alten Testament, also im wichtigsten Buch der drei Neuen Religionen, gesagt haben soll. Der gleiche Gott und Schöpfer, der all diese unendlich vielen und schönen Geschöpfe und Pflanzen erschaffen hat oder entstehen ließ, soll den ersten Menschen auf diesem Planeten den Auftrag gegeben haben, sich diese, seine Schöpfung, untertan zu machen?! Vernichtet diese Schönheiten, wie es euch beliebt, soll er gesagt haben?! Mehret euch bis in alle Unendlichkeit, soll er gesagt haben? Vernichtet damit nicht nur mein gesamtes Werk, sondern euch mit dazu, soll er gesagt haben? Vernichtet die Wälder? Rottet eure Mitgeschöpfe aus? Verwandelt blühende Landschaften in riesige Krater oder Sümpfe aus Öl und Müll? Das soll er gesagt haben?!«
Bodo hob einen Zeigefinger und blieb lange in dieser Haltung.
»Er, der Schöpfer, hat bei der Menschwerdung Intelligenz entstehen lassen. Wenn es der Schöpfer war, der auch die Intelligenz geschaffen hat, so hat er den Menschen damit eine Verantwortung über sein gesamtes Werk erteilt. Liebet eure Mitgeschöpfe, achtet sie und schützt mein Werk - muss er damit gesagt haben.
Und das müsste sich in der Bibel widerspiegeln. Wer etwas anderes denkt, sagt oder meint - der verhöhnt diesen Schöpfer. Wer diese Schöpfung mit Füssen tritt, verhöhnt unseren Schöpfer ebenfalls. Sie machen sich zu Handlagern des Teufels. Sie sagen sich damit von Gott, unserem Herrn und Schöpfer, los. Das sind Gottlose. Ihnen droht ewige Verdammnis. Wer den Geist dieser schönen Schöpfung in Frage stellt und missachtet, müsste deshalb bereits auf Erden unter Strafe gestellt werden. Ich verachte und hasse deshalb diese Wesen, die nun wieder einmal ein Stück der Schöpfung vernichtet haben – oder vernichten werden. Wir haben, so gesehen, eine göttliche Aufgabe. Wir müssen möglichst viele Geschöpfe retten und erhalten. Das sollte uns in den nächsten Tagen beseelen. Wir kommen hierher, um zu helfen. Zumindest wir wissen, warum und wofür wir dies tun.«
Bodo öffnete seine Hände und streckte sie nach vorn.
»Wir helfen damit auch den Menschen hier in dieser Region. Wir kämpfen vor allem für unsere Freunde - die vielen, schönen Vögel, die gerade brüten, für die restlichen Tiere und Pflanzen auf den unzähligen kleinen Inselchen, in den Schilfgürteln, den Auenlandschaften und in den Marschen, für die unglaubliche Vielzahl der Tiere und Pflanzen auch unter Wasser.«
Bodo machte eine Kunstpause. Immer noch herrschte atemlose Stille im kleinen Saal.
»Bei meinem letzten Atemzug will ich zu mir sagen können: Bodo, du hast deinen Beitrag geleistet. Mehr konntest du nicht tun. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr ähnlich denkt und fühlt. Ihr seid Kinder des Schöpfers. Ich liebe euch.«
Erst jetzt fielen seine hart gewordenen Gesichtszüge wie eine Maske von ihm. Mittlerweile war er in Schweiß gebadet. Ein leichtes und nun auch zufriedenes Lächeln verteilte sich über sein Gesicht. Mit lauter und fester Stimme sagte er schließlich:
»Ich wünsche euch und uns allen einen schönen Abend. Lasst es euch schmecken. Lebt, trinkt, liebt und singt. Die nächsten Tage werden wieder einmal hart. Danke liebe Freunde.«
Iris rätselte, warum Bodo nach dieser Rede keine Anstalten machte, sich wieder auf seinen Stuhl zu setzen. Er blieb stehen und schaute in die Runde.
Weitere lange Sekunden ruhte Stille im Raum. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Ein Großteil der Anwesenden hing noch immer an Bodos Lippen. So hatten sie ihn noch nie gesehen. Solche Worte hatte er bislang noch nie gefunden. Bislang war er lediglich einer von ihnen. Manchmal auch ein Fels in der Brandung. Doch heute Abend? Soeben?
Plötzlich begann der Erste rhythmisch in die Hände zu klatschen. Weitere fielen ein. Wie auf ein geheimes Kommando standen alle auf und klatschten. Die ersten begannen,
»Bodo! Bodo!« zu rufen.
Hachiko stürmte plötzlich nach vorn, fiel vor Bodo auf die Knie, umarmte dessen Beine, und begann laut zu schluchzen.
Ole, der wie immer in unmittelbarer Nähe seines Freundes zu sitzen pflegte, stand auf. Fast theatralisch nahm er Bodos rechte Hand, um sie zu küssen.
Weitere Anwesende stürmten auf Bodo zu. Viele wollten ihn umarmen, ihm die Hand reichen oder ihm zumindest nahe sein. Der Lärm war ohrenbetäubend. Niemand schien sich plötzlich diesem Zauber entziehen zu können.
Nur Iris blieb sitzen. Sie ließ dieses Schauspiel auf sich einwirken.
Als sie Bodo beruflich kennengelernt hatte, war er ein introvertierter, achtzehnjähriger Naturliebhaber. Sie war vier Jahre älter. Und trotzdem: Nach nur wenigen Minuten war sie unsterblich in den älter wirkenden, gutaussehenden und muskulösen Hünen mit den stechend wasserblauen Augen verliebt.
Heute, nach achtzehn Jahren, war sie immer noch in ihn verliebt - wie am ersten Tag. War es diese Liebe, welche es ihr in den letzten Jahren erschwerte, oder gar unmöglich machte, Bodo mit der Brille einer Psychologin zu betrachten? Seit vielen Jahren leitete sie eine private Psychiatrie, die weit über die Grenzen von Frankfurt bekannt war; vornehmlich in der Mittel- und Oberschicht. Ja, er war reifer geworden. Sein Weg, den er sich selbst ausgesucht hatte, war steinig gewesen. Und viele Eindrücke, die sie leider nicht kannte, hatten sich offensichtlich tief in seine Seele eingefräst. Sie hatte die Befürchtung, dass Bodo sich zum Fanatiker entwickelt hatte und weiterhin entwickeln würde. Bodo hatte es ihr verwehrt, Einblick in seine Seele zu nehmen. Aber was war plötzlich mit diesem Mann passiert? So wie vorhin hatte sie Bodo noch nie wahrgenommen. Seine ganze Wortwahl war neu.
Als weithin geachtete Psychologin durfte sie seinen heutigen Auftritt nicht mehr mit dem Begriff »Charismatiker« allein abtun. Die Grenzen zwischen einem Charismatiker, einem Psychopathen oder gar einem Schizophrenen verliefen mitunter fließend.
»Oh Gott«, dachte sie plötzlich. Ihre Hände begannen zu zittern.
»Bin ich krank? Wie kann ich so etwas überhaupt in Erwägung ziehen? So darf ich noch nicht einmal ansatzweise denken! Damit würde ich Gefahr laufen, Bodo zu verlieren. Für immer!«
Vor drei Jahren … nach so langer, langer Zeit … hatte es ausgesehen, als ob ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen würde. Doch vergebens. Zu mehr als Gesprächen und einigen Streicheleinheiten war es nicht gekommen. Bislang gab es allerdings auch keine Hinweise darauf, dass Bodo sich anderweitig orientiert hatte. Simone himmelte ihn an und schmuste mit diesem stattlichen Mann. Doch Simone war lesbisch. Das hatte man ihr zugetragen. Daran gab es mittlerweile keine Zweifel mehr. Diese Begrüßungen am Flughafen von Biloxi … und diese Blicke, mit denen die meisten der zum Teil überaus attraktiven Frauen Bodo verschlangen … War es vorstellbar, dass sie in der Vergangenheit „erfolgreich“ bei Bodo waren?
Und plötzlich … Plötzlich blickte Bodo sie an. Sein erster Blick schien mit der Frage verbunden zu sein:
»Warum sitzt du so allein da hinten?!«.
Konnte er zum Schluss ihre Gedanken lesen?!
Jetzt löste er sich von den Menschen, die ihn umringten. Er kam auf sie zu. Sie fühlte, wie nun auch ihre Beine zu zittern begannen.
Und da stand Bodo vor ihr. Seine starken Arme zogen sie sanft nach oben. Er drückte Iris an seine Brust.
»Dir muss ich besonders danken. Du hast immer an mich geglaubt. Du warst immer da, wenn meine Seele besonders traurig war. Wie kann ich das je wieder gut machen?«
«Indem du mir einen Kuss gibst«, hauchte sie.
Bodo gab Iris einen langen und zarten Kuss auf die Lippen.
Die Männer klatschten. Doch Carlotta de la Mora und Ann Chandler hassten in diesem Moment diese Frau. Sylvia, Ärztin und Iris‘ engste Vertraute, hatte Bodo bislang lediglich als einen »verdammt gut ausgestatteten« Mann eingestuft. Sie empfand plötzlich Neid und Eifersucht. Es war ihr, als spürte sie in diesem Moment seine Kraft in ihren Lenden. Sie sehnte sich nach seiner Nähe – und seiner mit Sicherheit teuflischen Kraft.
Verdammt. Er hat aber noch andere Kräfte, schoss es durch ihren Kopf. Und diese Kräfte sind unendlich gefährlicher. Auch ihre Hände und Beine begannen nun zu zittern. War es angebracht, Angst vor diesem Mann zu haben?
»Um Gottes willen nein«, schrie sie in sich hinein. »Niemals darf ich mich gegen ihn stellen. Niemals!«
Bradly hatte zwei Freunde überreden können, mit ihren Booten an der Aktion teilzunehmen. Der Ölkonzern hätte ihnen zusammen über 2.000 Dollar pro Tag gezahlt. Freundschaft zählte in den Südstaaten immer noch mehr als schnöder Mammon. Gute Freunde würden bleiben. Doch die Ölkarawane würde wieder weiterziehen; irgendwann. Der Wind hatte etwas nachgelassen, und es regnete leicht. Bodo hatte damit gerechnet, dass auf der Wasseroberfläche ein dicker Ölfilm weiter in Richtung Norden ziehen würde. Doch dem war nicht der Fall. Stattdessen fuhren sie durch eine raue See, auf der ab und zu große, braunschwarze Ölklumpen schaukelten. Der »Corexit-Einsatz« war demnach erfolgreich gewesen. Das an sich primitive Konzept der Manager des Ölkonzerns ging vorerst auf. Strafzahlungen wurden nur für sichtbare Einleitungen erhoben.
Der Konvoi passierte die Gulf Islands National Seashores. Auf der kleineren East Ship Island ankerte ein Boot. Eine Mannschaft von knapp zwanzig Personen war damit beschäftigt, die Ölklumpen in große, weiße Plastiksäcke zu verstauen. Es war seltsam still. Lediglich Raubmöwen hielten Ausschau nach Beute.
Bradly tuckerte mit gedrosseltem Tempo, damit seine Freunde mühelos den Anschluss halten konnten. Ihre beiden blauen Boote waren älteren Datums. Maurice war Austernzüchter und Jaques hatte sich bislang auf die Shrimps- und Krabbenfischerei spezialisiert. Er zählte bislang zu den wichtigsten Lieferanten der fleischigen Blaukrabben in dieser Region.
Fast eine Stunde fuhren sie an der langgestreckten, schmalen Hauptinsel der Chandeleur Islands entlang. Das Wetter hellte sich langsam auf, und schließlich zwängte sich die Sonne vorsichtig durch die Wolkenbänke. Alle drei bis vier Kilometer sahen sie kleine Trupps an den großen Sandstränden. Da die Sonne langsam zum Vorschein kam, sah Bodo, dass der Strand seltsam hell war. Der Sand war zwar nicht so berauschend weiß, wie er ihn in Erinnerung hatte. Nur vereinzelt waren größere, schwarze Ölklumpen auszumachen. Es war irgendwie gespenstisch.
Die Sonne zog nun nahezu alle Aktivisten an Deck der Yacht. Es schien, dass vor allem die Frauen schlagartig mitteilsamer wurden.
Der gestrige Abend war lang geworden. Einige hatten Bodos Vorschlag sehr ernst genommen, und zwei Glas Wein zu viel getrunken. Viele hatten Bodos Vorschlag, sich zu lieben, ebenfalls in die Tat umgesetzt. Bei den Zwei- bzw. Dreibett-Zimmern war Improvisationstalent gefragt. Iris und Sylvia teilten sich ein Zimmer.
Jetzt, nachdem die Sonne auf den hellen Strand von Chandeleur Island schien, wurden ihre Lebensgeister wieder geweckt und es kam fast so etwas wie Urlaubsstimmung auf.
Das beginnende Blau des Himmels spiegelte sich nicht, wie sonst im Wasser wider. Ein fast geschlossener, dünner Schlierenteppich hatte die Wasseroberfläche in Beschlag genommen. Es war keine dicke, braune oder schwärzliche Ölschicht. Es waren dünne, ekelhafte Schlieren. Als sich diese Schlieren durch die Sonne erwärmten, vermischte sich dieser süßlich-herbe Geruch mit der bislang frischen Frühlingsluft. Dieser dünne Teppich, der auf dem Wasser lag oder tanzte, schimmerte und leuchtete in tausenden Regenbogenfarben; wie ein abstraktes Gemälde.
Bodo schoss einige Aufnahmen.
Es machte keinen Sinn, sich in schlechte Laune zu verkriechen. Das hier war die Realität; eine abschreckende Realität. Und diese galt es festzuhalten. Er hatte sich vorgenommen, viele Details fotografisch einzufrieren, wie Ewald oft zu sagen gepflegt hatte. Seine künftigen Artikel sollten unter die Haut gehen - und abschrecken; ein fotografisches Fanal darstellen. Er würde den Verlagen zwei Möglichkeiten einräumen. Entweder sie konnten sich mit seinen Texten anfreunden und bekamen dafür diese Aufnahmen. Oder sie mussten sich ein flacheres Thema von anderen Fotografen leisten – und er würde künftig mit anderen Verlagen arbeiten. Die Zeit der Kompromisse war für ihn vorbei.
Endgültig.
Unmittelbar nach der langgestreckten Hauptinsel bogen die Yacht und die zwei Boote nach rechts; westwärts. Im Schutze der Chandeleur Islands lagen zehn kleinere Inseln, welche ebenfalls zur Breton National Wildlife Refuge zählten. Die südlichste und größte dieser Inseln war Bodos Ziel. Für ihn war es seine Pelikan-Insel; sein kleines Paradies. Doch diese Insel begann mit einer Enttäuschung.
Von weitem sah er, dass sie nicht allein für dieses Paradies zuständig sein würden. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Leiter der Gruppe war Bodo positiv überrascht. Der etwa fünfzigjährige Balduin kam aus Greetsiel in Nordfriesland und war ein enger Freund von Ronald, der in diesem kleinen Städtchen aufgewachsen war. Sie kamen überein, dass Bodo mit seiner weitaus größeren Mannschaft für den Südwesten und den Westteil zuständig sein sollte. Danach wollten sich die beiden Teamleiter wieder zusammensetzen, um weitere Vorgehensweisen zu besprechen.
»Ich habe vorhin mit Ronald telefoniert«, begann Balduin.
»Er hat auch keine Erklärung, warum es hier so gespenstig ruhig ist.«
Bodo lauschte angespannt. Außer den Stimmen der Helfer in den verschmierten, weißen Overalls waren nur wenige Vogelstimmen zu vernehmen. Vor allem Raubmöwen kreisten und kreischten.
»Sie haben recht«, sagte Bodo erschrocken.
»Vor knapp zehn Tagen waren wir hier. Da war ein ohrenbetäubender Lärm. Wie sieht es dort oben aus?«
Hinter dem Strandhafersaum begann eine Buschvegetation und dahinter erstreckte sich Wald; vornehmlich Nadelwald.
Der Mann aus Greetsiel schüttelte mit dem Kopf.
»Wir sind seit gestern Spätnachmittag hier und haben zunächst mit dem Sandstrand begonnen.«
Bodo legte seine Hand freundschaftlich auf Balduins Schulter.
»Sobald wir weiter westwärts geankert haben, werde ich umgehend nachschauen, was da los ist.«
Auf dem Weg zum Ankerplatz wurde eine genaue Arbeitsteilung festgelegt. Bodo und die Biologen Simone, Pierre, Zola und Carlotta würden einzeln eine Bestandsaufnahme im Inselinneren durchführen, und sich in einer Stunde wieder am Ankerplatz treffen. Der Rest der Crew sollte die Zelte errichten, und alles für die Säuberungsaktionen vorbereiten. Dreißig Helfer sollten unverzüglich damit beginnen, den Strand nach links und rechts von den Ölklumpen zu säubern. Die großen, weißen Plastiksäcke sollten sie verschließen und einfach stehen lassen.
Die beiden blauen Fischkutter hatten drei Beiboote geladen. Darin sollten die Säcke in Schlepptau genommen werden. Das Boot von Maurice war mit einer Vorrichtung versehen. Mit dieser konnten die beiden Quads auf den Strand gesetzt werden. Ein Quad war sogar mit einer kleinen hydraulischen Gabel ausgestattet, mit welcher die Säcke oder weitere schwere Gegenstände mühelos angehoben werden konnten.
Nach zwanzig Minuten gingen sie vor Anker. Alle hatten mit einer weitaus größeren Verschmutzung gerechnet. Vereinzelt lagen tote Vögel am Strand oder trieben im Wasser; Sturmtaucher, Tölpel, einige Pelikane und vor allem Aztekenmöwen. Bodo betrachtete einige Vögel etwas genauer. Sie wiesen nur kleinere Verölungen auf. Aber an diesen klebrigen Verunreinigungen waren sie ganz bestimmt nicht verendet.
»Hast du eine Erklärung für den Tod dieser Vögel?«, fragte Bodo Simone.
Die blonde Biologin zuckte mit den Schultern.
»Dass es das Öl allein nicht gewesen ist, hast du mit Sicherheit bereits festgestellt.« »Bin gespannt, wie es da drin aussieht«, sagte Bodo, und deutete in Richtung Wald. »Geh du voraus. Ich muss hier noch einige Aufnahmen machen.« Simone nickte.
Bodo entnahm einen Fotoapparat aus einer größeren Umhängtasche, die er geschultert hatte. Er begann konzentriert Aufnahmen zu machen; vor allem Nah- und Makroaufnahmen. Es war Ewalds Fotoausrüstung. Immer wenn Bodo durch den Sucher sah, dachte er an Ewald. Was er wohl zu diesem Horror gesagt hätte? Bodo war immer wieder überrascht über sich selbst. Sah er schlimme Szenen mit seinen eigenen Augen, drangen diese Eindrücke viel tiefer. Doch sobald er durch den Sucher der Kamera schaute, war er damit beschäftigt, die richtige Blende einzustellen, den geeignetsten Blickwinkel auszusuchen, und achtete akribisch auf alle technischen Details. Tiere oder Pflanzen waren in diesem Moment Objekte. Erst bei oder nach der Bildbearbeitung – vor allem, wenn er Motive heranzoomte - kam der Schock, die Trauer und der Zorn – wie ein Hammerschlag. Der Strandhafer, die vielen zum Teil seltenen Grasarten und das Schilf hatten Trauerkleidung angelegt. Sie waren wie mit einem braunen, klebrigen Film überzogen. Der starke Sturm hatte die Gischt mit dem Ölfilm weit ins Landesinnere getragen. Die Nester der Strandläufer und weiteren seltenen Bodenbrütern waren mit diesem Film überzogen. Die Eier in den Nestern waren ebenfalls mit dieser klebrigen Masse versehen. Auf einem Gelege hockte die tote Mutter, die vergeblich versucht hatte, die Jungen zu hudern; sie vor dieser tödlichen Brühe zu bewahren. Vergeblich. Tote Jungvögel hingen aus den Nestern im Schilf oder lagen im Gras. Spätestens bei diesem Anblick musste sich Bodo zwingen, Aufnahmen zu machen.
Fast wie in Trance tastete er sich weiter landeinwärts. Hier waren die ersten großen Nester der Pelikane. Auf dieser Insel legten sie ihre Nester halbhoch in kompakten Büschen oder in kahlen Bäumen an. Der Sturm hatte einige Nester heruntergeweht. In allen Nestern, die Bodo einsehen konnte, waren bereits Jungvögel; zwei bis drei Wochen alt. Sie waren alle tot. Von den Altvögeln war weit und breit nichts zu sehen. Bei den Braunen Pelikanen wechselten sich die Eltern im Brutgeschäft ab.
Für Bodo gab es nur eine Erklärung:
Nachdem einer der Altvögel nicht mit Futter im Kehlsack zurückkam, und die Jungen laut und hungrig bettelten, sah der am Nest wachende Elternteil keine andere Möglichkeit, als sich auf Futtersuche zu begeben. Die Evolution hatte dies so programmiert. Nur wenige erwachsene Pelikane waren zurückgekehrt und lagen tot am Boden. Einige hingen in den Zweigen; waren kraftlos aus dem Nest gefallen.
Noch vor zwei Wochen waren die Braunen Pelikane in Scharen gekreist und wie auf ein Kommando aus zehn Metern oder gar aus zwanzig Meter Höhe mit angewinkelten Flügeln ins Wasser geschossen. Diese Pelikane unterschieden sich von ihren weißen Kollegen dadurch, dass sie tauchend jagten. Und ihre Rufe, bevor sie sich fallen ließen - dieses Kreischen, diese Lebensfreude ….
Diese Bilder … diese verdammten Bilder … dieses verdammt schöne Konzert … Und plötzlich diese verdammte Stille – und diese verdammten Eindrücke.
Nun stand Bodo mit hängenden Schultern inmitten dieser grauenhaften Szenerie. In seinem Leben hatte er bereits hunderttausende toter Wasservögel gesehen; viele von ihnen waren mit einem dicken Ölfilm überzogen gewesen. Sie hatten hilflos im Wasser gerudert oder lagen total ermüdet und am Verhungern am Strand. Nur ein verschwindend kleiner Teil hatte mit riesigem Aufwand gerettet werden können. Warum also gingen ihm diese Bilder heute so an die Nieren? Er hatte keine Erklärung. Seine Beine waren wie Blei. Hilflos stand er da - und begann zu weinen. Er setzte sich müde ins ölverschmierte Gras. Um ihn herum war es still; totenstill.
Es war ihm nicht bewusst, wie lange er mit schweren Gliedern im Gras kauerte. Doch urplötzlich kam die Kraft wieder zurück.
Du musst stark sein, sagte er zu sich. Du musst kämpfen. Das hast du doch gestern zu einhundert Aktivisten gesagt. Das hier muss Konsequenzen haben. Und fast wie ein Roboter fing er an, erneut Aufnahmen zu machen; von den Pelikanen, die in den Zweigen hingen, von den kleinen Küken, die mit dieser hässlichen braunen Brühe überzogen waren, von den verölten Gräsern, von Schmetterlingen und Libellen mit einer feinen Ölschicht überzogen; vom Tod - von der hässlichen Seite des Energiehungers.
Diese Bilder waren grauenhaft. Und sie sollten schlimmer als tausend Worte sein. Sie sollten die fetten Herzen wie Geschosse durchschlagen, und in ihrer verdammten Seele stecken bleiben. Das sind Bilder, vor denen diese ekelhaften Söldner der großen Konzerne eine Scheißangst haben, dachte er. Gegen solche Bilder sind auch Richter und Schöffen hilflos.
Iris sah ihn zuerst. Sie hatten Ausschau nach Bodo gehalten. Schließlich wollten sie sich alle nach einer Stunde wieder am Zeltplatz treffen. Der große und muskulöse Mann war nur noch ein Schatten seiner selbst. Dieses Mal wirkte er nicht wie ein kraftstrotzender charismatischer Hüne. Man sah, dass ihm jeder Schritt schwerfiel. Sein Gesicht war aschfahl. In seiner rechten Hand hielt er einen Pelikan. Dessen Kopf baumelte bei jedem seiner Schritte.
»Wir haben uns schon langsam Sorgen gemacht«, sagte Simone leicht vorwurfsvoll. Carlotta und Zola starrten Bodo mit riesigen Augen an. Mittlerweile hatte sich eine kleine Gruppe um den Mann mit dem toten Pelikan gebildet. Die deutsche Psychologin versuchte die Situation zu retten.
»Hallo, hallo«, schnarrte sie ärgerlich, und blickte in die Runde. »An die Arbeit. Lasst Bodo ein wenig verschnaufen. Los, los.« Mit hastigen Handbewegungen scheuchte sie die Neugierigen auseinander. »Ab, ab, hier gibt es nichts zu sehen«. Sie verfiel in einen leicht hessischen Dialekt. Grummelnd entfernten sich die Aktivisten.
»Simone, Sylvia«, sagte Bodo mit matter Stimme und winkte sie mit einer schwachen Handbewegung zu sich heran. »Bleibt bitte.«
»Brauchst du mich dabei?«, fragte Iris leise.
»Nein. Danke.« Bodo blickte sie dankend an.
Simone und Sylvia setzten sich zu Bodo. Simone hob müde eine Hand.
»Sag nichts. Wir haben wohl die gleichen Bilder gesehen. Pierre, Zola und Charlotta sind auch geschafft.«
»Aber wo sind die Altvögel?«, fragte Bodo. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich schätze, dass hier mindestens vierhundert Pelikane gebrütet haben. Ein großer Teil davon müsste doch irgendwo zu finden sein.«
»Wir stehen vor einem Rätsel«, seufzte Simone.
Der Hüne legte den mitgebrachten Pelikan auf seine Oberschenkel.
»Schaut euch diesen Vogel einmal genauer an. Vor allem hier oben am Kopf.«
Der Kopf war weiß und der Hals ging in einen weiß-gelblichen Ton über. Es waren keine deutlichen Ölrückstände zu sehen. Das übrige Gefieder sah gesund aus, hatte eine braune und zum Teil silbergraue Farbe. Der Vogel war nicht älter als drei bis vier Jahre. Er war knapp 1,20 Meter groß und wog schätzungsweise drei Kilogramm. Die Braunen Pelikane waren schlanker und wogen weitaus weniger als ihre weißen Verwandten. Kurz oberhalb der Ruderfüße klebten hässliche, jedoch kleinere Ölklumpen.
»Sollen wir ihn genauer untersuchen?« Sylvia hatte bislang nur zugehört.
Bodo legte seine Hand auf Sylvias Arm.
»Bitte. Es interessiert mich brennend, woran dieser Vogel gestorben ist.«
Sylvia fiel auf, dass Bodo nicht „verendet“ gesagt hatte, wie man dies bei Tieren zu sagen pflegt.
»Vielleicht solltet ihr Priscilla und vor allem Awanasa mit hinzuziehen«, sagte der hünenhafte Biologe müde. »Ich habe sie beide in Kanada und Alaska arbeiten sehen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Fracking-Thema haben sie viele Erfahrungen gesammelt. Es liegt mir daran, dass ihr euch bei dieser Gelegenheit besser kennen lernt.«
Sylvia nickte kurz und nahm den Vogel von Bodos Oberschenkel. Im übernächsten Zelt war die Krankenstation. Dort war auch ein kleines Labor eingerichtet.
Die vier Frauen in diesem Zelt waren absolute Experten auf ihrem Gebiet. Vor allem auf Simone konnte sich Bodo verlassen.
Sie hatte zunächst ein Biologie-Studium begonnen. Zusätzlich belegte sie noch das Fach Chemie. Genau diese Kombination war jetzt gefragt.
Sylvia wollte ursprünglich Tierärztin werden und sattelte später zur Allgemeinmedizinerin um. Hierbei lernte sie Iris kennen. Die junge Ärztin aus Darmstadt war einige Jahre in der Uniklinik Frankfurt tätig gewesen. Dort wurde sie zur Expertin für neue Medikamente und für Tropenkrankheiten ausgebildet.
Als sie wegen einer unerfüllten Liebe einen Selbstmordversuch unternahm, wurde sie von ihren Eltern in die Privat-Psychiatrie am Nordrand von Frankfurt gebracht. Dort stand Iris damals kurz vor der Übernahme der Leitung dieser Klinik. Zwischenzeitlich verband die beiden Frauen, eine äußerst enge Freundschaft.
Priscilla war Ärztin und die Indianerin Awanasa eine anerkannte Biologin. Awanasa belegte zusätzlich ein Studium zur Tierärztin.
Beide Frauen waren vor allem leidenschaftliche Ornithologinnen. Inzwischen ticken die beiden wie Vögel, hatte einmal der Halbindianer Amaro zu Bodo gesagt. Seit einigen Jahren war dieser mit Awanasa glücklich verheiratet.
Die einhundert Aktivisten waren fleißig gewesen. In Abständen von fünf Metern standen die großen, weißen Plastiksäcke im Sand, und warteten auf den Abtransport. Sie hatten damit begonnen, das Buschland von den toten Vögeln und Kleinvögeln zu säubern, bevor diese anfingen zu verwesen. Diese Plastiksäcke standen am Waldrand im Schatten. Einige Stunden später besuchte Bodo die Frauen im Labor-Zelt.
»Wir sind mit der ersten Auswertung fertig«, wollte Sylvia beginnen. Trotz eines großen Vorzeltes war es im geräumigen Kranken- und Laborzelt etwas stickig.
»Setzen wir uns ins Vorzelt«, bat Bodo rasch.
»Awanasa und Priscilla waren uns wirklich eine sehr große Hilfe«, flüsterte Simone. In diesem Moment stapfte Bradly mit hochrotem Kopf vorbei. Er hatte die Sitzgruppe im Vorzelt nicht bemerkt, und zuckte leicht zusammen, als er Bodos Stimme hörte.
»He Bradly, seit wann lässt du so hübsche Frauen verdursten?
»Verdammt. Jetzt weiß ich endlich, was mir die ganze Zeit gefehlt hat«, brummte der Trinkfreudige aus Biloxi. ´
»Meinst du den Whiskey, oder meinst du die Frauen?«, sagte Simone lachend.
»Jaja, lästere du nur hier im Schatten«, knurrte Bradly, und wischte sich den Schweiß von der Stirn, um rasch hinzuzufügen: »Ich bringe sofort etwas Kühles.«
Als er wenige Minuten später mit einem Karton angestapft kam, und die Getränke verteilt hatte, zeigte Bodo auf einen freien Stuhl.
»Setze dich zu uns. Das wird dich auch interessieren. Simone hat gewartet, bis du auch da bist.« Er blickte seine langjährige Wegbegleiterin an.
»So, Simone. Wir hören.«
»Eines steht unzweifelhaft fest«, begann die Biologin. »Der Pelikan ist erstickt. Die genaue Ursache ist noch unklar. Wir haben den Magen, den Darm, die Innereien incl. Herz und vor allem das Blut genau untersucht. Darüber hinaus war es für uns wichtig, die Augen und das Gefieder einer genauen Untersuchung zu unterziehen.« Simone machte eine Pause und blickte Sylvia an.
»Im Kehlsack befanden sich noch fünf Fische«, führte nun die Ärztin aus Frankfurt weiter aus.
»Nach Lage der Dinge war der Pelikan wohl bereits geschwächt angekommen. Er kam nicht mehr dazu, die Jungen zu füttern. Die Fische im Kehlsack und den Mageninhalt haben wir ebenfalls eingehend untersucht. Also: DDT, das Hauptproblem der letzten Jahrzehnte für die Pelikane, scheidet aus. Ebenso artähnliche Pflanzenschutzmittel. Wir haben zwar solche Spuren nachgewiesen, aber diese sind erstaunlich gering. An den Fischen, die er gefressen hatte, ist er nicht gestorben. Obwohl - die Fische wiesen eine recht hohe toxische Dosis auf. Über Tage hinweg hätten sich diese Gifte im Pelikan so stark angereichert, dass er voraussichtlich daran eingegangen wäre. Die Kiemen der Fische waren stark verunreinigt. Das Blut des Pelikans wird noch untersucht. Der Schlund des Pelikans war stark verätzt. Wir vermuten, dass dies letztlich die Ursache des Erstickens war. Bis morgen Mittag wissen wir mehr.«
»Wodurch wurden die Verätzungen hervorgerufen?«, schnaufte Bradly.
»Das kann viele Einzel- und viele kumulative Ursachen haben«, begann Simone weiter zu referieren.
»Wir wissen, dass man viele Fischer nach dem Abschöpfen des Öls in Krankenhäuser eingeliefert hat. Bei diesen armen Burschen stellte man in erster Linie Verätzungen der Atemwege sowie Probleme im Magen- und Darmbereich fest. Bei der kontrollierten Abfackelung des Öls hat die FOSC angeblich allergrößten Wert darauf gelegt, dass die Bevölkerung nicht gefährdet wurde.« Sie blickte kurz auf.
»Aus dieser Wortwahl allein muss entnommen werden, dass es dabei zu Freisetzungen von chemischen Prozessen kommt, die man offensichtlich für bedenklich gehalten hat. Völlig unklar ist, was die Rückstände der Abfackelung in Verbindung mit dem Wasser, mit der speziellen Ölsorte hier und vor allem mit dem Corexit in der Kumulation bewirken. Der sogenannte Potenzierungsgrad ist völlig unbekannt. Wir wissen allerdings auch nicht, ob es sich bei dem versprühten Corexit
um eine Weiterentwicklung der uns bekannten Substanz handelt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Wirkungsgrad, und damit die Giftigkeit, angehoben wurde. Wenn wir davon ausgehen, wie lasch das MMS und weitere Organisationen bislang ihre Überwachungspflichten wahrgenommen haben, muss sich diese Frage förmlich aufdrängen.«
Simones Ausführungen wurden im September 2011 durch eine Expertengruppe zum Teil bestätigt. Selbst der US Fish & Wildlife Service musste zugeben, dass eine vollständige Erfassung der Folgen nicht stattfand, und auf Vorgabe von oben auch nicht angestrebt wurde. Eine Zahl ließ jedoch aufhorchen: Nur 25 Prozent der registrierten Vögel wiesen Verölungen auf. 62 Prozent der tot gefundenen Vögel zeigten keine äußerlichen Verunreinigungen auf. Die Studie der innerlichen Verölungen und Verätzungen ist öffentlich nicht zugänglich, hieß es lapidar.
»Die Auswirkungen durch das Fracking in den Staaten und in Kanada werden diese Werte langfristig bei Weitem übertreffen«, fügte Priscilla hinzu.
»Vor allem wird es mehr Menschenleben kosten, wenn die Rückstände sich im Grundwasser festsetzen, oder ins Meer gespült werden, um sich in Fischen und anderen Lebensmitteln anzureichern. Das ist ausschließlich nur eine Zeitfrage.«
Bodo stand auf.
»Zunächst einmal danke, meine Damen. Für mich war das äußerst interessant. Haltet mich bitte auf dem Laufenden, wenn weitere Auswertungen vorliegen. Wir werden diese irgendwann sinnvoll einsetzen; mit Sicherheit auch in meinen Artikeln. Da freue ich mich schon auf die Resonanz der netten Herren.«