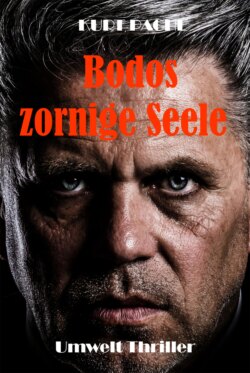Читать книгу Bodos zornige Seele - Kurt Pachl - Страница 9
Kapitel 7
ОглавлениеEine Woche später war Bodo wieder in Deutschland.
Sein erster Weg führte ihn zu Mama Falland; Ewalds Mutter.
»Ich war stolz gewesen, zwei Söhne zu haben. Jetzt habe ich nur noch einen«, seufzte sie leise und klammerte sich dabei mit ihren knochigen und rauen Händen an Bodos Arme. Mamma Falland verlor dabei keine Tränen.
Doch Tränen rollten zwei Wochen später über ihre zerfurchten Wangen, als Bodo sie in ihr neues Zuhause brachte.
In diesem Heim, wo nur wohlhabende Betagte residierten, hatte sie stundenweise als Putzfrau gearbeitet. Neid hatte Mamma Falland nie gekannt. Das wäre mit ihrer Wesensart nicht vereinbar gewesen.
Und jetzt sollte sie hier wohnen, auf dem Balkon sitzen, und in die herrliche Parklandschaft blicken. Sie würde das Essen serviert bekommen. Die kleine, vom Leben und der vielen Arbeit gezeichnete Frau blickte zu Bodo hoch.
»Kannst du dir das überhaupt leisten?«, flüsterte sie kopfschüttelnd.
Bodo bückte sich zu ihr hinunter und gab ihr einen Kuss auf die Stirn.
»Ganz bestimmt«, erwiderte er. »Und ich werde dich so oft wie möglich besuchen.«
Die alte Dame tätschelte Bodos Hand.
»Das wäre schön«, hauchte sie. Und dabei kullerten wieder dicke Tränen über ihre runzeligen Wangen.
Am Tag darauf hatte Bodo einen Termin in Taunusstein.
Frau Dr. Römhorst war eine äußerst attraktive Schönheits-Chirurgin.
Sorgfältig musterte sie das Foto von Ewald, welches ihr Bodo übergeben hatte. Danach blickte sie Bodo prüfend an.
»Das einzige Problem sind die Augen. Sie haben herrliche, wasserblaue Augen - wenn ich das sagen darf. Ihr Freund hatte zwar auch blaue Augen, aber die Strukturen der Iris sind doch recht unterschiedlich. Mit entsprechenden Kontaktlinsen können wir das weitestgehend kaschieren. Bei der Nase, den Backenknochen und den Ohren sind lediglich kleine Korrekturen notwendig.«
»Und das wird reichen?«, fragte Bodo ungläubig.
Die Chirurgin drehte daraufhin den Bildschirm auf ihrem Schreibtisch in Richtung Bodo. Er sah eine Aufnahme von sich, welche die Ärztin kurz zuvor gemacht hatte. »Sehen sie … Das ist ihr Gesicht nach drei Eingriffen«, sagte sie, nachdem sie auf eine Taste des PCs gedrückt hatte.
Bodo war plötzlich wie erstarrt.
»So, und jetzt machen wir alles komplett«, erklärte die Chirurgin und drückte jeweils zum nächsten Bild.
»Das sind sie mit einem Dreitagebart. Das sind sie, wenn sie sich das Haar dunkelblond färben und etwas länger tragen. Und das sind sie mit einer Brille, wie sie ihr Freund getragen hat.«
Bodo entfuhr ein »Wow«, worauf Frau Dr. Anette Römhorst noch einmal auf eine Taste drückte. Darauf waren zwei Gesichter nebeneinander zu sehen.
»So, jetzt dürfen sie sich aussuchen, wer von den beiden netten Herren sie sind«, lachte die Chirurgin. »Selbst bei den modernen Gesichtserkennungs-Scannern dürfte es schwer werden, einen Unterschied auszumachen.« Sie lehnte sich nach vorn und lächelte dabei Bodo an. Ganz offensichtlich kokettierte sie mit den Reizen ihrer wohlproportionierten Oberweite. Sie trug den weißen Arztkittel offen. Ihr sicher teures Kleid hatte einen großen Ausschnitt, aus dem ihre beiden Brüste nun auf Bodo zugequollen.
»Ich habe ihnen den Gesamtbetrag bereits überwiesen, den sie mir genannt hatten«, versuchte Bodo die Situation zu überspielen. »Ich bin total begeistert. Gerne dürfen sie den Betrag noch einmal nach oben korrigieren.«
Der Gesichtsausdruck der Schönheits-Chirurgin verriet für den Bruchteil einer Sekunde den Anflug von Enttäuschung. Bodos Reaktion war für diese aparte Frau sicher eine völlig neue Erfahrung. Rasch fing sie sich jedoch wieder. Sie lehnte sich zurück und faltete die Hände vor ihrem Dekolleté.
»Haben sie eine Tonbandaufnahme, aus der ich die Stimme von Ewald analysieren könnte?«, fragte sie. »Wenn sie immer Ewald sein wollen, könnte ich zu neunzig Prozent gewährleisten, dass man keinen Unterschied feststellt. Aber das ist ja nicht ihr Ziel, wenn ich sie richtig verstanden habe.«
Einen Monat später blickte Bodo anerkennend in den Spiegel und beglückwünschte Frau Dr. Römhorst zu ihrem Meisterwerk. Sein HNO-Arzt händigte ihm drei Wochen später ein kleines Fläschchen mit einer Sprühdosierung aus. Falls es notwendig werden sollte, könnte Bodo innerhalb weniger Minuten eine schwere Erkältung simulieren.
Diese Ereignisse lagen nun zehn Jahre zurück.
Seit einigen Stunden blühte Bradly förmlich auf. Er schnupperte Heimatluft. Sie fuhren an der Ostküste Floridas entlang. Gerne hätte er in Palm Beach geankert. Doch Bodo verabscheute diesen Rummel. Deshalb legten sie bereits am Kai von Fort Pierce an. Das war am Spätnachmittag des 19.4.2010.
In den letzten Tagen hatten sie sich Zeit genommen, und gemütlich die gesamte Ostküste der Vereinigten Staaten passiert. Allen war nicht nach einem Landgang zumute gewesen.
Am 16. April war ein kleines Gewitter aufgekommen, weshalb es Bradly für sinnvoll gehalten hatte, im Gateway Nat. Rec. Area zwischen New York und Perth Amboy im Schutze des Sandy Hook zu ankern.
Einen Tag später genossen sie den Pamlico Sound hinter den Outer Banks östlich von Washington und ankerten am Strand von Lola.
Am 18. April schipperten sie besonders langsam zwischen Georgetown und Charleston. In einer Bucht bei Bird Key Stono Heritage gingen sie vor Anker, wenige Kilometer südlich von Charleston.
An den Spätnachmittagen und den Abenden angelten Bradly und Ole um die Wette. Bradly war nicht nachtragend. Die Wunde am Hals war weitestgehend verheilt. Sein Anglerglück war ihm hold gewesen. Und am späten Abend genehmigte er sich einen Schlummertrunk; einen klitzekleinen, wie er betonte.
Marco hatte inzwischen im Internet gesurft und die regionalen Zeitungen von Kanadas Osten und Nordosten gespeichert. Die sechs Robbenfänger waren inzwischen beigesetzt worden. Den Angehörigen wurden allerdings nur sechs Urnen übergeben. Die Behörden entschuldigten sich in aller Form für das Missverständnis. Nach der Beerdigungsfeier gab es ein großes Besäufnis, welches in Handgreiflichkeiten übergegangen war und durch die Polizei geschlichtet werden musste. Die Ursachen für den Tod sollten weiterhin untersucht werden, war die lapidare Verlautbarung gewesen. Aufgrund von Wrackteilen hatte man die Absturzstelle des Wasserflugzeuges ausfindig gemacht. Da die Wrackteile weiträumig verteilt waren, musste es sich um eine Explosion gehandelt haben.
Bodos Freunde schüttelten ungläubig den Kopf. Die letzten Tage war Bodo fast nur damit beschäftigt gewesen, unzählige Aufnahmen zu machen. Unter Ewalds Namen tauchten viele Fotoreportagen auf. Die Redakteure der renommierten Zeitschriften hatten gegen Ende 2000 mit dem Gedanken gespielt, die Zusammenarbeit mit Ewald zu beenden, da die Qualitäten der Aufnahmen das bislang Künstlerische vermissen ließen. Beeindruckt waren die Abonnenten der Fachzeitschriften jedoch von den Textbeiträgen. Deshalb versuchten die Verlage, Ewald noch deutlicher in den Vordergrund zu stellen. Doch Ewald lehnte Einladungen zu Podiumsdiskussionen und ähnlichen Veranstaltungen generell ab. Das hatte ihn schließlich noch interessanter gemacht. Diese Foto-Reportage entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten würde sich gut verkaufen lassen. Außerdem musste er seine Glaubwürdigkeit als Ewald festigen, sollte er wider Erwarten in Biloxi in die Fänge der Polizei geraten.
Vom Wasser herkommend in die Staaten einzureisen, hielt Bodo für weniger risikoreich. Seit der Inhaftierung in Little Guantanamo waren er und Marco zur persona non grata erklärt worden, und durften nicht mehr in die USA einreisen. Ewald hatte sich als Naturfotograf und Reiseberichterstatter in den letzten Jahren einen Namen gemacht, und war auch den Geheimdiensten gegenüber nicht negativ aufgefallen. Das traf auf den Namen Bodo ganz und gar nicht zu. Folglich entschied sich Bodo, als Ewald aufzutreten. Doch dafür würde er sich den offiziellen Stellen gegenüber Zeit lassen; möglichst viel Zeit.
Am späten Abend verwandelte er sich langsam in Ewald. Die Haare waren zwar noch nicht so lange, wie er sich dies gewünscht hatte. Doch als er diese hellbrünett, fast blond, färbte, fand er das Ergebnis passabel. Er setzte Ewalds Hornbrille mit der relativ breiten Fassung auf, und ging an Deck.
Bradly war gerade im Begriff, Marco in die Funktion einer Hochsee-Angel einzuweisen. Vor Schreck entglitt Marco die Angel. Sie krachte auf die hochwertigen Holzplanken der Yacht. Bradly, der mit dem Rücken zu Bodo stand, fauchte: »He, das ist eine teure Ausrüstung. Pass doch auf.« Marco stand wie angewurzelt und starrte mit aufgerissenen Augen Bodo an. Das veranlasste Bradly, sich rasch umzudrehen.
»Hallo, was wollen Sie …?« Weiter kam er nicht. Ihm fiel ein, dass sie auf See waren, und niemand hätte an Bord gelangen können. In diesem Moment tauchte Ole auf der Reling auf. Er erschrak nicht, als er Bodo in Ewalds Outfit sah.
»Verdammt«, stammelte er mit einem anerkennenden Gesichtsausdruck. »Als ob Ewald leibhaftig vor mir stehen würde. Nicht schlecht.« Sein Blick fiel auf Bradly, der den Mann mit der auffälligen Hornbrille noch immer mit offenem Mund anstarrte.
»Darf ich vorstellen«, sagte er nun an Bradly gerichtet. »Das ist Ewald, Ewald Falland. Gewöhne dich an sein Gesicht und vor allem an seinen Namen. Ewald … kapiert?!«
Als die vier Männer am Morgen des 20. April 2010 auf dem eleganten Achterdeck Oles Frühstück wieder einmal lobten, und auf die Fortanlage von Fort Pierce blickten, ahnten sie noch nicht, dass sich eine Katastrophe über dem Golf von Mexiko zusammenbraute. In einer halben Stunde wollten sie aufbrechen.
Der gutgelaunte Bradly erklärte seinen Gästen noch einmal die Route:
»An Palm Beach, Fort Lauterdale und Miami vorbei. Um die Keys ist es zu weit. Wir nehmen den Intracoastal Waterway, dann durch die Florida-Bay, und danach an der Westküste entlang.«
»Aber wir machen doch einen kurzen Abstecher in die Everglades? Die lassen wir uns nicht entgehen«, unterbrach ihn Marco lächelnd.
Der Südstaatler blickte säuerlich. Bodo und Ole lachten. Jetzt hatte es Bradly plötzlich eilig. Er schien den Duft der attraktiven und herrlich anstrengenden Frauen förmlich zu riechen.
»In der Nähe von Clearwater geht es dann Richtung Nordwest.«
Ole sprang aus seinem Stuhl, und zeigte mit dem Finger nordwestlich und sagte in einem kommandoähnlichen Ton:
»Schnurgerade nach Biloxi. Ihr vielen Nixen dort – wir kommen.«
Alle lachten. Bradly schloss mit einem »Genau« seine Reiseroute ab.
Bodo schlug die Beine übereinander, hob den Zeigefinger der rechten Hand und sagte mit einem leichten Lächeln: »Aber ich will die kommenden Tage noch in die Everglades, in den Ocala National Forest, in den Lower Suvannee National Wildlife Park und in den Okefenokee.«
»Ist ja schon gut.« Bradly fuchtelte mit beiden Händen in der Luft herum. »Aber zunächst zeige ich euch ...«
Er kam nicht weiter. »Biloxi«, unterbrach ihn Marco lachend.
»Mit euch kann man sich nicht vernünftig unterhalten«, fuhr Bradly gespielt säuerlich fort. »Ich meine natürlich den De Soto National Forest, den Black- und den Red Creek und natürlich die Gulf Islands National Seashores. Und später müssen wir unbedingt in das unwahrscheinlich schöne Mississippi-Delta.«
Er wandte sich zu Bodo.
»Dort hörst du bestimmt nicht mehr auf zu fotografieren. Versprochen.« Anschließend zeigte Bradly, wie viel Power in seiner Yacht steckte.
Allerdings kamen sie erst am späten Nachmittag im Hafen von Biloxi an. Im Intracoastal Waterway und in der Florida-Bay, an den vielen kleinen Inseln entlang, durften sie nicht schnell fahren.
Bereits kurz nach dem Verlassen der Yacht war es unübersehbar, wo Bradly bislang den Schwerpunkt seines Seins gesetzt hatte.
Er wurde sofort von Frauen umschwärmt; äußerst attraktive Frauen, aufgetakelte Frauen, Frauen fast jeden Alters. Eifersucht schien keine der Frauen zu kennen. Entweder winkten sie Bradly auffällig zu, oder sie fielen ihm jauchzend um den Hals. Einige hauchten ihm zarte Küsschen auf die Wange, während andere ihm unverblümt einen herzhaften Kuss auf die Lippen drückten. Eine Dunkelhäutige mit einer Figur, für die man eigentlich einen Waffenschein gebraucht hätte, verschlang den Mann aus Biloxi mit einem langen Zungenkuss.
Die Umstehenden klatschten Beifall. Bradly genoss diese Begrüßungen.
»Ihr werdet hier ganz bestimmt nicht allein bleiben. Habt ihr gesehen, wie sie euch angeschaut haben. Diese Frauen hier stehen auf starke Männer«, frohlockte Bradly mit vielsagender Miene.
Bodo blickte hilfesuchend in die Wolken.
»Ich sehe schon, dass ich allein in die Sümpfe gehen muss.«
Bradly klopfte Bodo auf die Schulter.
»Ein bisschen Ablenkung würde dir auch nicht schaden. Dir ist doch mit Sicherheit nicht entgangen, wie dich die Rothaarige angehimmelt hat«, schmunzelte er. »He, die hat dich bereits mit den Augen vernascht.«
»Aber die war doch bereits … mindestens …«, lästerte Marco grinsend. Weiter kam er nicht.
»Was verstehst du schon von Frauen«, unterbrach in Bradly. »Madeleine wird dir heute Nacht zeigen, dass die Frauen hier im Süden gerade in diesem Alter höllisch anstrengend sein können.« Er grinste spitzbübisch. »Vor allem dann, wenn ich ihr ins Ohr geflüstert habe, welche Befürchtungen du gehabt hast.«
»Ich werde mich hüten, dir deine Schönheiten in Beschlag zu nehmen,« erregte sich Marco gespielt entrüstet.
»Nix da,« lachte Bradly. »Daran wirst du dich noch auf deinem Totenbett erinnern, und grinsend in Jenseits gehen. Die werden dich dann fragen, woher zu kommst. Und wenn du sagst, dass du aus Biloxi kommst, werden sie freudig nicken. Wetten?«
Bradlys Reich war gewachsen. Es hatte sich gravierend verändert, seit Bodo ihn vor sechs Jahren besucht hatte.
Vor fünf Jahren war der Hurrikan Katrina auch über Biloxi und dem benachbarten Gulfport hinweggefegt. Nahezu siebzig Prozent aller Häuser waren dabei zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen worden. Entlang der Küste waren sogar über neunzig Prozent der Häuser unbewohnbar geworden. Stadtrat und Gouverneur hatten damals beschlossen, die Stadt und das Hinterland durch eine Hurrikan-Schutzzone zu sichern. 17 000 Hausbesitzer waren abgefunden worden, um südlich des Highways 90 ein Industriegebiet und eine noch größere Flaniermeile zu errichten. Wieder aufgebaut waren vor allem die vielen Casinos; ein Rückgrat der Stadt.
Das Unternehmen des lebenslustigen Mannes war inzwischen weit über die Grenzen hinaus ein Anziehungspunkt für Angel-, Tauch- und Wandertouren geworden. Der Tourismus entwickelte sich für Biloxi mittlerweile zu einem unverzichtbaren Standbein. Früher hatten die relativ einfachen Schuppen genau zwischen dem Industriegebiet und dem angrenzenden Vergnügungsviertel gelegen. Zum Wiederaufbau ergatterte Bradly Zuschüsse und ein äußerst zinsgünstiges Darlehen. Aus den Schuppen waren eine große, moderne Halle und ein zweigeschossiges Geschäft entstanden. Darüber prangte ein großes Schild mit der Aufschrift »Let`s go«. Das danebenliegende alte Haus aus der Gründerzeit stand unter Denkmalschutz. Bradly konnte es kostenlos übernehmen; allerdings mit der Maßgabe, daraus ein vornehmes Hotel mit zwanzig Zimmern zu zaubern.
Bodo wollte auf der Yacht übernachten. Er hatte sich an seine moderne, aber nicht zu große Kajüte gewöhnt.
»Das wäre ja noch schöner«, schnaubte der Hotelbesitzer. »Im Haus ist es ganz bestimmt ruhiger und bequemer, mein Freund. Glaub es mir. Du bekommst das schönste Zimmer im dritten Stock mit Blick auf das Meer.« Mit diesen Worten zog er seinen Gast über die Straße in das Hotel.
Das Zimmer war sehr gut eingerichtet. Bodo stand eine Weile am Fenster, und schaute auf das bunte Treiben. Den meisten dieser Küstenstädte war gemein, dass sie pulsierten und laut waren. Ja, er hatte Meerblick. Da hinten schaukelten die Yachten und die Boote im blauen Wasser des Golfs von Mexiko. Doch dazwischen lag der vielbefahrene Highway 90. Viel lieber wäre er auf der Yacht geblieben. Da war es ruhiger; vor allem in der Nacht. Aber das konnte er Bradly nicht antun.
Er ließ sich nun Zeit und sinnierte. Viele Länder und Erdteile hatte er bereist. Aber es gab so viele Schönheiten dieser Schöpfung, die er noch nicht gesehen hatte. Dazu gehörte der Mississippi. Er hatte vor, drei Wochen hier am Golf von Mexiko zu bleiben. Diesen Fluss, über den so viel geschrieben wurde, wollte er genauer kennen lernen. Darüber würde er einen separaten Artikel schreiben; natürlich mit vielen eindrucksvollen Aufnahmen - von Ewald.
Als er dann später unten vor dem Hotel stand, suchte er vergeblich seine Begleiter. Nachdem er zwanzig Minuten nach ihnen Ausschau gehalten hatte, zuckte er mit den Schultern, und steuerte ein kleines Fischrestaurant in der Nähe des Yachthafens an.
Auf der mit Ried überdachten Terrasse, mit Blick auf die Boote, den Strand und auf das herrlich blaue Wasser, fand er einen ruhigen Tisch. Er wollte hier und jetzt, am Golf von Mexiko, ein gutes Fischgericht genießen, und dabei dem Treiben zuschauen; er wollte versuchen ausnahmsweise an nichts zu denken. Heute wollte er zwei Glas Wein trinken. Der Wirt hatte davon geschwärmt.
Gegen 22:30 Uhr klopfte es laut an der Türe von Bodos Zimmer. Ausnahmsweise schlief er bereits. Der Wein hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Die Türe öffnete sich kurz darauf, und Marco stürzte herein.
»So eine Scheiße«, schrie er. »Da draußen ist vor einer halben Stunde eine Ölplattform explodiert. Jetzt steht sie in Flammen. Komm ans Fenster.«
Bodo sprang aus dem Bett. Das Fenster stand nachts immer offen. Sie beugten sich hinaus.
»Im Süden«, sagte Marco aufgeregt. »Nicht weit von der Mündung des Mississippi-Deltas entfernt.«
In der klaren Aprilnacht konnte man einen roten Feuerball am Horizont erkennen, der weithin leuchtete. Der Feuerball bewegte sich flackernd. Das Feuer war ganz offensichtlich noch nicht gelöscht. Es musste gigantisch sein.
»Das sieht verdammt schlecht aus«, murmelte Bodo leise.
»Hast du Bradly gesehen?«
In diesem Augenblick stürzte Ole ins Zimmer. Er hatte Bodos Frage gerade noch gehört, und prustete, während er ans Fenster trat.
»Ich habe ihn bereits gesucht. Der Kerl ist nicht zu finden. Säuft sich wieder einmal die Hucke voll oder ist bei seinen Tussis.«
Marco schaltete Bodos Nachttischlampe ein, und drückte auf den Knopf des Fernsehgerätes.
»Wir müssen den CBS oder den CNN finden«, brummelte er.
Rasch hatte er den entsprechenden Kanal ausfindig gemacht. Eine Reporterin berichtete gerade aufgeregt:
»Die Küstenwache hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Eine Reportage vor Ort ist nicht möglich. Unsere Informationen haben wir vom Versorgungsschiff Bankston, welches sich in unmittelbarer Nähe befand, als die Plattform mit einer riesigen Stichflamme explodierte. Kurz darauf brach ein verheerendes Feuer aus. Die Flammen sollen über 70 Meter hoch sein. Die Bankston wird in wenigen Minuten bei der Deepwater Horizon sein. Nach neuesten Angaben befanden sich 120 bis 130 Arbeiter auf der Bohrinsel. Offizielle Stellungnahmen seitens der Betreiberfirma Transocean und seitens der Ölgesellschaft gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Wie wir soeben erfahren haben, sollte die Bohrung bereits vor zwanzig Tagen abgeschlossen sein. Warum es zu einer Verzögerung kam, ist unbekannt. Heute sollte die Spezialfirma Halliburton das Bohrloch fachgerecht verschließen. Nach unseren Informationen ist es hierbei zu unvorhergesehenen Komplikationen gekommen, die zu dieser Katastrophe geführt haben könnten. CBS berichtet in Kürze weiter.«
Marco stellte den Ton leiser. Bodo setzte sich auf das Bett. Er hatte sich in den letzten Jahren intensiv in die Offshore-Thematik eingelesen.
Innerhalb weniger Sekunden rauschten mehrere Szenarien durch seinen Kopf. Wenn einer Erhellendes zu diesem Thema beitragen konnte, war es Ole. Er hatte zwei Jahre auf norwegischen Ölplattformen gearbeitet. Wortlos blickte er den Norweger an.
»Für mich gibt es nur eine Erklärung«, begann der Fachmann.
»Beim Verschließen des Bohrloches müssen mehrere Fehler gleichzeitig gemacht worden sein. Ein einziger Fehler reicht da nicht. Für diesen Extremfall gibt es den Blowout Preventer. Dieser 450 Tonnen schwere Brocken wird wie ein Ventil über das Bohrloch gestülpt, um den riesigen Druck, der sich tief unten aufgebaut hat, zu stoppen. Eine größere Anzahl unterschiedlicher Spezialisten müssten eigentlich lange zuvor festgestellt haben, dass sich riesige Mengen Methangas aufgestaut hatten. Das kommt nicht von einer Minute auf die andere. Wenn das mit dem Preventer nicht geklappt hat, sind unvorstellbare Mengen Methangas nach oben geschossen, und haben sich auf der Plattform irgendwie entzündet. Und dann … Bumm.« Ole schleuderte seine beiden Hände nach oben. »Diese armen Teufel auf der Plattform. Oh Gott.«
»Welche Auswirkungen hat das auf das Bohrloch da unten«, fragte Bodo nach einigen Sekunden der Stille. »Kann die Leitung nach oben überhaupt noch funktionieren?«
Ole schüttelte den Kopf.
»Mit Sicherheit gibt es da keine Verbindung mehr. Am Bohrloch oder aus der Leitung, die sich bei der Explosion mit Sicherheit von der Plattform gelöst hat, strömt die schwarze Brühe ins Meer. Hast du eine Ahnung, wie tief hier gebohrt wurde?«
»Wie tief die eigentliche Bohrung war, weiß ich nicht«, antwortete Bodo. »Aber das Bohrloch liegt in 1 500 Meter Tiefe.«
»Da unten ist es stockdunkel. Da kann man nur Tauchroboter einsetzen. Dieses Desaster wird uns noch sehr lange beschäftigen«, brummelte Ole.
»Wartet einmal.«
Marco lief wieder zum Fernsehgerät, um den Ton lauter zu stellen. Zu sehen war wieder die Reporterin. Es war inzwischen 23:05 Uhr.
»Die Deepwater Horizon steht noch immer in Flammen«, sagte die Reporterin; nun etwas ruhiger. »Wir haben neue Informationen über die Mitarbeiter. Nach offiziellen Angaben befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion 126 Arbeiter auf der Plattform. 115 von ihnen haben bislang überlebt. 17 Mitarbeiter sind zum Teil schwer verletzt. Elf Männer werden vermisst. Es wird sicher noch einige Stunden dauern, bis die angeforderten Löschboote vor Ort sind. Da besorgte Bürger von amtlichen Stellen keine Auskünfte erhielten, haben sie unseren Sender angerufen. Vor allem Fischer und namhafte Tourismusunternehmen, aber auch viele Naturschützer wollen wissen, wie es, da unten am Bohrloch – in 1 500 Meter Tiefe – aussieht. Sie wollen vor allem wissen, ob weiterhin Öl aus dem Bohrloch austritt. Es ist uns leider nicht gelungen, wenigstens einen der Führungskräfte ans Telefon zu bekommen. Das Innenministerium und die Beamten der MMS sowie der Küstenwache wiegeln ab oder gehen nicht ans Telefon.
Es gelang uns, zu dieser späten Stunde, mit einem anerkannten Wissenschaftler zu sprechen, der als Offshore-Experte bekannt ist. Er bat darum, seinen Namen nicht zu nennen. Für ihn steht es völlig außer Frage, dass sich da unten mindestens 300 000 Liter Rohöl in den Golf von Mexiko ergießen werden. Pro Tag wohlgemerkt. Welche Mengen, wann und wo die Strände erreichen, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen. Das wird von der Windrichtung und Windgeschwindigkeit abhängen. Die wichtigste Frage ist natürlich, wann das Leck geschlossen werden kann.«
Der letzte Satz der Reporterin wurde jäh unterbrochen.
Die Türe von Bodos Zimmer flog auf, und Bradly kam hereingestürzt. Im ersten Moment war es schwer einzuordnen, ob er nur aufgelöst war oder schwer betrunken. Er stolperte auf Bodo zu, und warf sich vor ihm auf die Knie.
»Diese Schweine … diese Verbrecher … Die werden mich ruinieren«, schluchzte er schwer verständlich. »Der ganze Golf von Mexiko wird in Öl schwimmen. Bodo, Bodo, wie soll es jetzt weitergehen?«
Es war weit nach Mitternacht, als Marco und Ole Bradly endlich beruhigt hatten, und ihn auf sein Zimmer bringen konnten. Dort griff er sofort nach einer Whiskyflasche und schüttete den Rest der Flasche in einem Zug in sich hinein. Wie vom Blitz getroffen sackte er in der Mitte des Zimmers in sich zusammen, und blieb regungslos liegen. Marco und Ole hievten den Betrunkenen auf sein Bett.
»Verdammt«, knurrte er im Schlaf in sein Kopfkissen. »Verdammt.«
Bodo war auf seinem Zimmer geblieben. Er schaltete das Fernsehgerät aus. Angekleidet legte er sich auf das Bett. Morgen würde es ein schwerer Tag werden. In Biloxi und wahrscheinlich im gesamten nördlichen Bereich des Golfs von Mexiko würde sich das Leben schlagartig ändern; für viele Jahre.
Er brauchte seit vielen Jahren wenig Schlaf. Mit offenen Augen starrte er an die Decke. Iris hatte ihm mehrere Male angeraten, sich mit autogenem Training zu befassen.
Anfangs beneidete er alle Menschen, die sich einfach hinsetzen konnten, um in wenigen Minuten in einen kurzen Tiefschlaf zu fallen. Doch im Laufe der Jahre hatte er sich daran gewöhnt, die fortwährend ratternde Maschine in seinem Kopf nicht mehr abstellen zu können. Insbesondere vor Aktionen empfand er diese Gabe als ein Geschenk. Immer und immer wieder rief er Informationen, Meinungen und geplante Vorgehensweisen ab; wie aus einem riesigen Computer. Er suchte nach Fehlern und Lücken, zog viel in Zweifel, fügte neue Überlegungen hinzu - so lange, bis alles aus seiner Sicht logisch und stringent war.
Vor einigen Monaten hatte er einen Artikel über dieses Bohrloch API 60-817-44169 gelesen.
Mit wenigen Millionen Barrel war es eigentlich winzig; gemessen an den 60 Milliarden Barrel Öl, welches nach Schätzungen der US-Regierung unter dem Golf von Mexiko noch schlummerte, und darauf wartete, gehoben zu werden. Dieses gesamte gigantische Vorkommen würde reichen, um die Wirtschaft und den privaten Verbrauch in Amerika voraussichtlich für zehn Jahre über Wasser zu halten; unfassbar - für nur zehn lumpige Jahre!
Unfassbare zwanzig Prozent des international gewonnenen Erdöls wurden allein in den Vereinigten Staaten verbraucht. Dabei hatten die USA lediglich einen Anteil von knapp vier Prozent an der Weltbevölkerung. Aber wer wusste schon genau, ob auf dieser Erde sieben oder gar bereits acht Milliarden Menschen lebten? Und dieses Menschenmeer hatte einen unstillbaren Hunger - auf Nahrungsmittel und zunehmend auf Fleisch, auf sauberes Wasser für Mensch und Tier, auf Ackerflächen, auf Flächen zum Bauen und für Golfplätze, auf Sand und Holz zum Bauen – und vor allem auf Energie in Form von Kohle, Atomstrom, Gas und natürlich auf Öl. Weltweit gab es noch nicht einmal ansatzweise ein Konzept für die kommenden zwanzig Jahre; ganz zu schweigen für die nächsten hundert Jahre? Aber was sind schon einhundert Jahre? Soll dann das Ende der Menschheit anbrechen?
Der Hunger nach Energie prägte seit vielen Jahrzehnten die Politik - weltweit. Bereits vor vierzig Jahren ging der Krieg um diese wichtige Ressource in die nächste Runde. Vor allem die US-Strategen hatten erkannt, dass sie sich nicht von staatlichen Konzernen wie Saudi Aramco, Gazprom, NIOC (Iran) oder PDVSA (Venezuela) und künftig von Petrobras (Brasilien) abhängig machen durften.
Mit der Offshore-Technik hatten sogenannte Experten, im Schulterschluss mit den Politikern, die Büchse der Pandora geöffnet. Die Kosten für diese Art der unterseeischen Erdölförderung lagen 30 Mal höher als für die Gewinnung an Land. Dass sich damit das Risiko für die Umwelt überproportional erhöhen würde, wollten die Manager der großen Konzerne - und auch die amerikanischen Politiker - nicht zur Kenntnis nehmen. Manche behaupteten, dass in den Adern der Bush-Dynastie ohnehin seit jeher kein Blut floss - sondern Öl. Die heimische Versorgung mit diesem kostbaren Nass wurde als eine Frage der nationalen Sicherheit hochstilisiert. Mit dem Begriff Nationale Sicherheit wurden in den Vereinigten Staaten seit jeher Kritiker im Ansatz mundtot gemacht. Wer gegen diese Religion verstieß, war entweder ein Terrorist oder ein Staatsfeind; idealerweise beides. Eben diese Nationale Sicherheit rechtfertigte die Ölproduktion selbst an den hochsensibelsten Orten dieser Welt.
Vor allem die großen Aktiengesellschaften hatten Hunger nach dem schwarzen Gold. Werte, Ethik, Moral und Menschlichkeit waren in der neuen Welt der Zocker, Spieler und Hasardeure hinderlich oder gar lächerlich. Sie hatten schleichend und weitestgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit eine Parallelwelt geschaffen; losgelöst von der Welt der Milliarden menschlicher Ameisen - größer, mächtiger und gefährlicher als die Politik. Wann immer es sinnvoll für ihre Pläne war, sangen sie sogar das Loblied auf die Werte der Demokratie.
Dabei hatten die Welten der Konzerne, Banken und des »Big Oil« sich seit vielen Jahrzehnten ihre eigenen Werte und Gesetze geschaffen; in ihrer eigenen Galaxie; weit weg von diesem Abschaum, der ab und zu ihre Welt störte. Für sie gab es nicht den Anflug eines Zweifels, dass sie diese Welt da draußen regierten, und mittlerweile fest in ihren Fängen hatten. Sie kauften sich Wahlergebnisse. Sie kauften sich Politiker. Sie kauften sich willfährige Wissenschaftler. Sie kauften sich ein Heer an Lobbyisten und hochkarätige Rechtsanwälte. Sie kauften sich Gesetze. Und diese Gesetze ermöglichten es ihnen, noch weniger Steuern zu entrichten und noch mehr Geld beiseitezuschaffen. Niemand sollte nur annähernd eine Chance haben, einen eventuellen Krieg gegen sie zu gewinnen – falls überhaupt jemand auf diese abstruse Idee kam.
Wer in den Olymp dieser Konzerne aufgenommen wurde, hatte es geschafft. Hier gab es keine Demokratie. Hier gab es nur das ungeschriebene »Gesetz der Märkte«. Banken, Versicherungen, viele Mittelständler bis hin zu Rentnern investierten zunehmend in Aktien und obskuren Fonds mit übermächtigen Schattenbanken. Die Aktionäre lechzten nach immer höheren Renditen. Sie legimitierten damit indirekt die neuen Götter, immer risikoreichere Strategien zu verfolgen. Diese Götter wurden gefeiert, und diese Kaste konnte sich selbst schwindelerregende Einkommen verschaffen. Der Gradmesser ihrer Erfolge waren die Aktienkurse.
Und diese Götter konnten sicher sein, dass keine Haftstrafe auf sie wartete, sollten durch ihre Entscheidungen - direkt oder indirekt - viele Menschen verunglücken … oder gar ihr Leben lassen müssen. Sie hatten stillschweigend alle Legitimationen, wenn sie Urwälder rodeten, wenn sie Meere und Sümpfe verseuchten, wenn sie Lebewesen quälten und Gottes Schöpfung in einer unvorstellbaren Zahl und Geschwindigkeit vernichteten - für alle Zeiten. Zur Not hatten sie ein riesiges Heer an hochbezahlten Rechtsanwälten. Die Aufgabe dieser seelenlosen Götterboten bestand darin, Schlupflöcher zu finden, oder sich im Extremfall Zeit zu kaufen; Zeit, die kein Gegner überlebte. Sollten die neuen Götter sich verschätzen, wurden sie lediglich aus diesem Reich ausgespien; oftmals nur für eine kurze Zeit. Als »Trostpflaster« erhielten sie hohe Abfindungen und Pensionen.
So funktionierte das System der neuen Götter auf dieser zunehmend geschundenen Erde.
Die Liste der Ölkatastrophen weltweit wurde immer länger – und die Schäden immer größer. Bodo war zu vielen dieser Katastrophen geeilt. Zusammen mit hunderten und oftmals tausenden Helfern hatten sie das Leben von Millionen Vögeln und Säugetieren zu retten versucht - und Strände zu säubern. Sie schwitzten und froren. Sie klammerten sich verzweifelt aneinander. Sie weinten, beteten und fluchten. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert und verloren später ihre Jobs, weil ihre Hände oder Lungen verätzt waren. Viele wurden geschlagen und in Gefängnisse gesteckt. Bodo hatte dies alles am eigenen Leib miterlebt und durchlebt; war durch viele Höllen gelaufen.