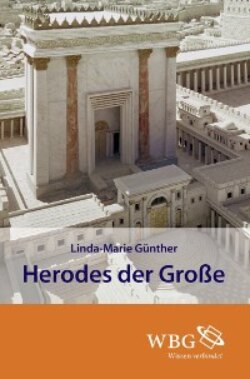Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 11
3. Herodias
ОглавлениеIn den skizzierten Kontext machtpolitischer Ambitionen gehört die Eheschließung des letzten herodianischen Tetrarchen mit der Witwe des Philippus. Wenn auch Flavius Josephus irrtümlich einen anderen Halbbruder des Herodes als vorherigen Gatten der Herodias nennt, so gibt er doch einen wichtigen Hinweis auf den Hintergrund seines Interesses an der Schwägerin: „Als er nun nach Rom reiste, kehrte er bei seinem Stiefbruder … ein. Hier fasste er eine so heftige Neigung zu dessen Gattin Herodias, … dass er mit dem Plan umging, sie zur Ehe zu nehmen. Herodias war damit einverstanden, dass sie gleich nach seiner Rückkehr aus Rom in sein Haus kommen solle, jedoch unter der Bedingung, dass er des Aretas Tochter verstoße. Herodes sagte das zu und reiste nach Rom weiter“ (AJ 18,5,1 / 110 f.). Was wollte er in der römischen Kapitale? Was erhoffte er sich von seiner Aufwartung beim Kaiser Tiberius? Dessen besonderes Wohlwollen für den Tetrarchen zeigte sich schon bald darin, dass er, sobald ihn jener von dem Krieg mit Aretas und von der eigenen Niederlage in Kenntnis setzte, dem Statthalter von Syrien befahl, in den Krieg auf der Seite des Herodes einzugreifen. Dieser Feldzug, zu dem dann Lucius Vitellius auch aufbrach, endete bereits in Jerusalem, wo ihn nämlich die Nachricht vom Tode des Tiberius erreichte. Er zog sich dann in richtiger Einschätzung der Situation, dass nämlich der neue Kaiser Caius Caesar Germanicus, genannt Caligula („Stiefelchen“), kaum eine Fortsetzung des Feldzuges anordnen würde, nach Antiocheia zurück. Hieran schließt Josephus die Bemerkung an: „Des Aristobul Sohn Agrippa aber war bereits ein Jahr vor dem Tode des Tiberius nach Rom gereist, um mit dem Caesar Verhandlungen anzuknüpfen, sobald sich ihm dazu Gelegenheit bieten würde“ (AJ 18,5,3 / 126).
Demnach hatte sich Agrippa,7 ein Bruder der Herodias, seit Herbst 35 n. Chr. in Rom aufgehalten, wo er beste Beziehungen zu Antonia, der Schwägerin des Tiberius, und zu deren Enkel, dem jungen Caius, unterhielt; sein Vater Aristobul hatte als junger Mann einige Jahre in Rom in der engeren Umgebung des Augustus gelebt. Offenbar traf Agrippa am Tiber ein, als sein Onkel Herodes Antipas „seine in Frage stehenden Angelegenheiten“ erledigt hatte. Wenn wir vermuten dürfen, dass es sich dabei um die Bitte handelte, das Herrschaftsgebiet des jüngst verstorbenen Philippus zu erhalten, dann hatte wohl auch Agrippa dasselbe im Sinn: mit dem nördlichen Transjordanien bedacht zu werden – vielleicht sogar unter Hinweis auf seine dortige verwitwete Schwester Herodias. Diese Vermutung ist insofern nicht überzogen, als es dann 37 n. Chr. zu eben dieser kaiserlichen Entscheidung kam. Freilich war es nicht eine Verfügung des Tiberius, dessen Gunst Herodes Antipas hatte. Vielmehr hatte Caligula, der im März jenes Jahres die Nachfolge seines Großonkels Tiberius antrat, sogleich in der Politik gegenüber Judäa eine Wende vollzogen und statt des Herodes Antipas den Agrippa zum Günstling Roms gemacht. Somit erhielt dieser als Nachfolger seines Onkels und Schwagers Philippus nunmehr die Region Gaulanitis, Batanäa, Auranitis und Trachonitis, außerdem sogar den Königstitel, den seit dem Tod Herodes’ I., also seit nahezu 40 Jahren, keiner der Erben mehr hatte tragen dürfen!
Doch zurück zu den Vorgängen im Jahr 35 / 36 n. Chr. und zu Herodes Antipas.8 Nach dem Geschilderten ist deutlich, warum der Tetrarch vor seiner Abreise nach Italien seine Schwägerin aufgesucht und ihr die Heirat angeboten hat: Wollte er von Tiberius das Gebiet des verstorbenen Tetrarchen erbitten, so empfahl es sich, in die gewünschte Abmachung die Witwe Herodias einzubeziehen, um nicht von lokalem Widerstand überrascht zu werden. Nicht zuletzt galt es auszuschließen, dass Herodias angesichts einer ‘Fusion’ des ihr seit Jahren vertrauten Herrschaftsbereiches mit Galiläa und Peräa vielleicht doch ihr Herz für ihren ehrgeizigen Bruder entdeckte. Die als Preis für ihre Zustimmung geforderte Trennung von seiner bisherigen Gattin dürfte dem Herodes nicht allzu schwer gefallen sein, hatte doch auch jene Ehe politischen Zielen gedient, nämlich einer friedlichen Koexistenz mit dem Nabatäerkönig Aretas IV. Wenn folglich mit der Scheidung von dessen Tochter die Gefahr bestand, dass die Friedensgarantie fortfiel, konnte der Tetrarch aufgrund seiner künftigen territorialen Überlegenheit hoffen, vom transjordanischen Norden her den arabischen Nachbarn quasi in Schach zu halten. Dass er sich hierin verrechnet hatte, zeigt dann jene verlustreiche Schlacht, die ihn zum Hilferuf an seinen Protektor Tiberius veranlasste.
Die Bemerkung des Flavius Josephus, dass Söldner aus der Tetrarchie des Philippus durch ihren Wechsel auf die nabatäische Seite die Niederlage des Herodes Antipas verursachten, zeigt zweierlei: dass Herodes die Übernahme der Tetrarchie seines verstorbenen Bruders herrschaftsorganisatorisch realisierte, indem er die dortigen Söldner in seinen Dienst nahm, und dass Philippus seinerzeit – ebenso wie sein mit einer Tochter des Aretas verheirateter Bruder – gute Beziehungen zu den Nabatäern gepflegt hatte. Daher dürfte es auch im Beraterkreis um den transjordanischen Tetrarchen eine pronabatäische Gruppe gegeben haben. Deren Interessen lagen in der Fortsetzung der bisherigen Politik, mit welcher die Beibehaltung der bisherigen Kräfteverhältnisse verbunden war. Diese Kreise stützten sich auf Aretas IV., einen Freund Roms (amicus populi Romani) wie seine judäischen Nachbarn auch, und dürften damit gerechnet haben, dass die römische Vormacht eine Restauration herodianischer Dominanz in jener Region kaum akzeptieren würde. Freilich war eben diese wiederhergestellte Vormacht das Ziel des Herodes Antipas beziehungsweise auch der Herodias. Jedenfalls zeichnet Flavius Josephus von dieser ehrgeizigen Frau ein entsprechendes Bild. Zwar ist zu vermuten, dass sie mit ihrer Forderung, ihr neuer politischer Partner müsse sich für ihre Unterstützung seiner Expansionspläne von seiner nabatäischen Gattin trennen, ihren eigenen künftigen Einfluss sicherstellen wollte, doch ging möglicherweise die Initiative zur Heirat aus denselben Gründen auf sie zurück. Hätte Herodes nicht auch von sich aus auf die Idee kommen können, den Einfluss der Nabatäer-Freunde an seinem eigenen Hof zumindest zu reduzieren? Aretas war zweifellos gezielt provoziert worden, wobei der Tetrarch vermutlich damit rechnete, als Opfer eines Angriffs römische Militärhilfe aus der benachbarten Provinz Syrien zu erhalten.
Darüber, welchen Verlauf der Krieg genommen hätte, wenn Tiberius nicht im Frühjahr 37 n. Chr. gestorben wäre oder wenn sein Nachfolger doch den Marschbefehl für den syrischen Statthalter bestätigt hätte, ist jede Spekulation müßig. Immerhin ist aus dem tatsächlichen Ereignisverlauf – in Rom antichambrierte Agrippa und wurde zum König über jene von Herodes begehrte Region ernannt – zu ersehen, dass jegliche ehrgeizige Rechnung den Wirt in Rom einzubeziehen hatte. Wer im festen Glauben an die fortgesetzte kaiserliche Gunst seine eigene Position so massiv ausdehnen wollte, spielte ein risikoreiches Spiel. Und der Verlust des allmächtigen Protektors traf besonders denjenigen empfindlich, der in der vermeintlichen Gewissheit alternative Optionen zur Erreichung oder auch Reduktion seiner Wünsche vernachlässigt hatte. Diese Lektion hatte einst niemand besser gelernt als Herodes der Große.
Es dauerte dann nur noch zwei Jahre, bis Herodes Antipas von Caligula abgesetzt und nach Lyon verbannt wurde – so ähnlich wie 6 n. Chr. sein Bruder Archelaos von Augustus. Diesmal beschwerte sich freilich nicht die Delegation einer unterdrückten Bevölkerung über ein unerträgliches Regime, vielmehr tappte der Tetrarch unvorsichtig in eine intrigante Falle.
Als Herodes mit seiner Gattin 39 n. Chr. nach Rom reiste, um höchstpersönlich von Caligula seine Erhebung zum König zu erbitten, wurde dies von seinem Nachbarn, dem König Agrippa, konterkariert. Der schickte einen Gesandten an den Kaiserhof, wo man ihm ja sehr gewogen war, mit einem Dossier, das den Herodes nicht nur massiver geheimer Rüstungen, sondern auch der Beteiligung an einem hochverräterischen Komplott beschuldigte. Nachdem durch einen Zufall Caligula diese Anklage schon gelesen hatte, als Herodes seine Audienz erhielt, gab der Tetrarch auf Anfrage zu, „dass er die Waffen besitze. Caius aber glaubte nun auch das für wahr halten zu müssen, was ihm von der Verschwörung berichtet wurde, er nahm daher dem Herodes seine Tetrarchie und vereinigte sie mit dem Reiche Agrippas … Den Herodes verurteilte er zu dauernder Verbannung und wies ihm die Stadt Lugdunum in Gallien zum Aufenthalt an“ (AJ 18,7,2 / 251f.).
Flavius Josephus lässt bei seiner erzählfreudigen Darstellung vom politischen Ende des Herodes Antipas keinen Zweifel daran, dass es Herodias war, die aus Ehrgeiz und Neid auf den nunmehr königlichen Bruder den Gatten zu seiner Bittstellermission in Rom gedrängt hatte: „Sie konnte ihren Neid nicht verbergen, sondern stachelte ihren Gatten an, er solle nach Rom reisen und sich um die gleiche Würde bewerben. Sie vermöge das Leben nicht mehr zu ertragen, erklärte sie, wenn Agrippa … mit der Königswürde bekleidet zurückkehre, während Herodes, eines Königs Sohn, dem seine Verwandtschaft den nächsten Anspruch auf den Thron gebe, sich mit dem Leben eines Privatmannes begnüge … Herodes sträubte sich zwar anfangs gegen den Plan, weil er Ruhe und Bequemlichkeit liebte … Sie … ruhte nicht, bis Herodes wider seinen Willen zur Nachgebigkeit gebracht war; konnte er sich doch überhaupt nicht leicht dem entziehen, was sie einmal beschlossen hatte“ (AJ 18,7,1 – 2 / 240 – 246). Der moralisierende Kommentar desselben Autors über die Verbannung des allzu machtgierigen Paares lautet sodann: „So strafte Gott die Herodias für den Neid gegen ihren Bruder und den Herodes für die Nachgiebigkeit gegen die eitle Rede seiner Frau“ (ebd. 255).
Wir haben am Beispiel des neutestamentlichen Berichts über den Tod des Johannes feststellen können, dass die Schuldzuweisung an Herodias und ihre Tochter den Zweck verfolgte, den Tetrarchen zu entlasten. Indem er als religiös interessiert, friedfertig und zugleich ungemein nachgiebig gegenüber den Frauen seines Hauses charakterisiert wird, erreichen die Evangelisten, dass ein Gedanke gar nicht aufkommt, nämlich dass Herodes vornehmlich aus politischen Gründen – und präventiv – handelte, als er der für bedrohlich gehaltenen Bewegung des Täufers ihren Kopf nahm. Eben diesen Gedanken äußert aber Flavius Josephus, der an der entsprechenden Stelle seiner Berichterstattung irgendeinen Einfluss der Herodias völlig ignoriert.
Können wir das skizzierte Interpretationsmodell, nämlich ein subtiles Ablenkungsmanöver der Evangelisten zu Lasten der Herodias und ihrer Tochter, auch auf die Passage des jüdischen Historiographen übertragen, die als primäre Ursachen für den Sturz des Tetrarchen die moralischen Defekte seiner Gattin präsentiert? Warum werden nicht des Herodes eigene Ambitionen getadelt, sondern Ehrgeiz, Neid und Machtgier der Herodias? Und was ergäbe sich daraus für die Absicht des Autors – etwa mit Blick auf Adressaten und Publikum seines Werkes?
Abb. 2: „L’Apparition“ (Die Erscheinung), Aquarell von G. Moreau.
Eine Antwort liegt in der Person des Agrippa, den Flavius Josephus als einen seines Königstitels durchaus würdigen Konkurrenten des Herodes Antipas insgesamt sehr positiv beurteilt, insofern er durch seine Großmutter Mariamne mit der Hasmonäerdynastie verbunden war. Als Schwester des Agrippa hätte Herodias am Ruhm der Abstammung aus der Hasmonäerdynastie durch die Großmutter Mariamne partizipieren können – und es mag sich ein gutes Stück ihres sicherlich authentischen Ehrgeizes aus einem derartigen Familienstolz gespeist haben. Sollen wir bei ihr eine Anspruchshaltung tadeln, die bei ihrem Bruder politisch akzeptabel erscheint? Nicht von der Hand zu weisen ist indes der Verdacht, dass es Hass, Neid und Machtwille auch des Agrippa waren, die zur Absetzung des Tetrarchen von Galiläa und Peräa führten. Wenn Josephus angesichts des geradezu rasenden Ehrgeizes seiner Gattin den Herodes zum bequemen Ireniker stilisiert, andererseits dann aber von seinen gut gefüllten Waffenarsenalen berichtet, so drängt sich eine Vermutung auf: Sollte die Schuldzuweisung an Herodias kaschieren, dass es hinter den politischen Kulissen für den Tetrarchen nur zu gute Gründe gab, auf Ausdehnung respektive Verteidigung der eigenen Positionen und Ansprüche nicht zu verzichten – und zwar gegen den dynamischen Agrippa, den Günstling des Caligula? In gewisser Weise, so ließe sich behaupten, deckt hier der jüdische Autor die traditionelle kaiserliche Günstlingswirtschaft im Rom des ausgehenden 1. Jahrhunderts auf, die sich nur allzu gern – ob zu Recht oder Unrecht bleibe offen – in Frauengewändern versteckt.
Unsere einführende Beschäftigung mit dem historischen Umfeld einer mehr oder weniger legendären Szene, nämlich des Tanzes der Salome vor Herodes Antipas, hat ein in mehrfacher Hinsicht ambivalentes Bild ergeben: Da sind nicht nur die verwirrenden Familienbeziehungen der herodianischen Sippe, sondern auch die komplizierten Machtverhältnisse im „Heiligen Land“, also in Judäa, Galiläa und den angrenzenden Territorien unter einst judäischer, inzwischen direkter römischer Herrschaft, nicht nur die offizielle Abhängigkeit der Tetrarchen von Rom, sondern auch und besonders ihr prekärer individueller Günstlingsstatus am Kaiserhof, nicht nur innere Spannungen mit symptomatischen religiösen und sozialen Bewegungen, sondern auch mehr oder weniger offene Konflikte mit den benachbarten Nabatäern. Zu den diversen chronologischen Unklarheiten kommt schließlich die – stets für die Arbeit des Historikers grundlegende – Diskussion über die Auswertung der Quellen, sei es der Evangelistenberichte, der Geschichtsschreibung des Flavius Josephus oder anderweitiger Zeugnisse.
Alle diese mit Schwierigkeiten behafteten Aspekte begegnen auch – und zum Teil noch komplexer – bei der Untersuchung, Darstellung und Bewertung einer so hervorragenden historischen Gestalt, wie es Herodes der Große, König von Judäa, war.