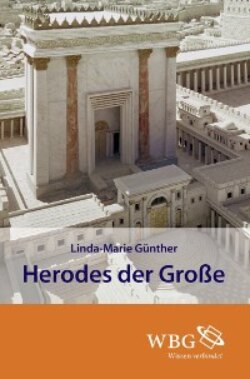Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 7
Vorwort der Autorin
Оглавление„Ein Idumäer … erwarb sich in Judäa ein Königreich, wie man sich ein Vermögen erwirbt, und erkämpfte sich kühn und raffiniert die heilige Krone Salomons und Josaphats. Er erwies sich als ein guter Beamter … und als harter, grausamer Mann. Er erbaute den Tempel, gründete Caesarea, schaffte seinem Volk in Zeiten des Hungers zu essen und ermordete alle seine Feinde. Dies war Herodes der Große.“
(Anatole France, 1892)
In der Reihe der Monographien über bedeutende Gestalten der Antike darf der judäische König Herodes I. nicht fehlen. Erstens war er ein ‘Großer’ in der Geschichte seines Volkes und Landes, zweitens hat er einen festen Platz in der historischen Erinnerung der Europäer, drittens vermittelt uns die literarische Überlieferung ein deutliches Bild von seinen Taten, Motiven und Wesenszügen. Als vierter Punkt ließe sich anführen, dass die internationale Spatenforschung der letzten Jahrzehnte viel zur Ergänzung des literarischen Bildes beigetragen hat. Daher fiel meine Wahl ohne Zögern auf Herodes, als ich von Herrn Kollegen Clauss die Einladung erhielt, in seiner Biographien-Reihe eine Persönlichkeit zu behandeln.
Inzwischen wüsste ich viele Punkte, unter denen von der Wahl Herodes’ I. für eine Biographie abzuraten wäre; einige möchte ich benennen:
Erstens verdankt Herodes seinen festen Platz in der europäischen Erinnerungskultur einer Verleumdung, denn er ist nicht der ‘Kindermörder von Bethlehem’ im Neuen Testament, dem das Matthäusevangelium die Rolle des ersten Schurken der Heilsgeschichte angedichtet hat. Außerdem hat nicht er, sondern sein Sohn Herodes Antipas, den Tod Johannes’ des Täufers auf dem Gewissen.
Zweitens ist das Bild, das der antike jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus überliefert, alles andere als zuverlässig – oder gar ‘objektiv’, und zwar nicht nur, weil seine Werke drei Generationen später entstanden.
Drittens bedient der Buchmarkt das Interesse an Herodes recht gut, zugleich entzieht sich allerdings das Sujet einem einfachen Forschungsresümee. Als historiographisches Objekt ist Herodes nämlich im Verständnis jüdischer – wie auch nichtjüdischer – Geschichtsschreibung keine Frage der Vergangenheit, sondern ein gegenwärtiges Menetekel. Als ein Fall für die wissenschafts- und zeitgeschichtliche Analyse hängt die Bewertung der historischen Persönlichkeit des Herodes auch mit der Bedeutung des Flavius Josephus zusammen, der zudem selbst als Zeitzeuge des ‘Jüdischen Krieges’, der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem und der römischen Eroberung Masadas nicht unumstritten ist.
Wer sich mit Herodes, dem König von Judäa, beschäftigen will, kann heutzutage auf eine Reihe älterer und neuerer Monographien zurückgreifen, unter denen diejenige von Abraham Schalit weiterhin unverzichtbar ist. Das dicke Standardwerk, das 1960 in hebräischer, 1969 in deutscher Sprache publiziert wurde, liegt dankenswerterweise seit 2001 in einem Nachdruck vor, dem ein aufschlussreiches Vorwort von Daniel R. Schwartz beigegeben ist.
Im Jahr 1929, in dem Schalit aus Wien nach Palästina übersiedelte, erschien „Das Haus des Herodes“ von Hugo Willrich, der schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts den Plan zu diesem Buch gefasst hatte. Der vollständige Titel „Das Haus des Herodes zwischen Jerusalem und Rom“ verdeutlicht das Anliegen dieses Autors, „die zwischen jenen beiden Welten gähnende Kluft zu überwinden“. Da seine Perspektive eine spezifisch kulturgeschichtliche ist – oder doch zu sein vorgibt –, setzt er sich viel weniger als Schalit mit der Aufbereitung des bisherigen Forschungsstandes durch Walter Otto auseinander, die der damals noch junge Gelehrte, der später München zu einem Zentrum der Hellenismusforschung machte, 1913 für die Real-Encyclopädie von Pauly und Wissowa vorgelegt hatte.
Wie instruktiv Untertitel zumal bei Herodes-Biographien sein können, zeigen nicht nur Schalit („König Herodes. Der Mann und sein Werk“), der den Blick auf den ‘Realpolitiker’ Herodes erahnen lässt, sondern auch 1957 Steward Perowne („The Life and Times of Herod the Great“), 1968 Samuel Sandmel („Herodes. Bildnis eines Tyrannen“, engl. 1967), 1977 Gerhard Prause („Herodes der Große. König der Juden“; bei den späteren Auflagen auch noch „Korrektur einer Legende“), 1996 Peter Richardson („Herod. King of the Jews and Friend of the Romans“) sowie jüngst 2002 Manuel Vogel („Herodes. König der Juden, Freund der Römer“).
Als Manfred Clauss in seine Reihe „Gestalten der Antike“ Herodes aufzunehmen plante, lag in deutscher Sprache neben dem opus magnum von Schalit und außer den übersetzten Büchern von Perowne und Sandmel lediglich die – inzwischen vergriffene – Biographie von Gerhard Prause vor. Dieses für ein breiteres Publikum geschriebene Buch wollte „das ursprüngliche Bild von Herodes, sein Leben, wie es wirklich war“ offen legen und zugleich die jahrtausendealten „Lügen und Legenden entlarven“, doch hat es dieses Ziel insofern nicht erreicht, als im allgemeinen Bewusstsein einer an Geschichte und Theologie interessierten Öffentlichkeit Herodes immer noch als vermeintlicher Kindermörder von Bethlehem und als brutaler Tyrann und Wüterich gegen seine engsten Familienangehörigen figuriert.
Das wird künftig wohl so bleiben, denn in der literarischen wie künstlerischen Rezeption und im Geschichtsbild Alteuropas behauptet Herodes gerade deswegen seinen Platz, weil er ein Exponent der Alterität, letztlich des Orients ist. An diesem Blick auf den judäischen König hat sich trotz der – von Willrich bis Vogel vorgetragenen – Akzentuierung seiner Romorientierung nicht viel geändert, wird doch, wenn auch subtil, nach Phänomenen einer Akkulturation und einem darin enthaltenen Potential für Friedenssicherung gefragt.
Die hier vorgelegte Biographie könnte im Untertitel Herodes als „letzten hellenistischen König“ charakterisieren, als der er nach meiner Ansicht anzusprechen ist. Für viele seiner Untertanen, die in ihm den Fremdherrscher sahen, machte es keinen Unterschied, ob er als Instrument der neuen Weltmacht oder als ‘zweiter Antiochos Epiphanes’, als Wiedergänger jenes großen Religionsfrevlers, die Juden tyrannisierte.
Somit war Herodes auch aus der Perspektive des jüdischen Volkes, welcher Flavius Josephus weithin verpflichtet ist, ein Exponent der Alterität. Dies erklärt, warum sich gerade jüdische Gelehrte so schwer tun, den König Judäas beziehungsweise der Judäer als ‘König der Juden’ zu erfassen. Am weitesten geht hier Samuel Sandmel, Professor am Hebrew Union College, wenn er den Tyrannen Herodes primär als Psychopathen schildert.
Allen Interpretationen gemeinsam ist freilich die Quellengrundlage: die Darstellung der herodianischen Zeit in den beiden Hauptwerken des Flavius Josephus, den Antiquitates Judaeorum (Jüdische Altertümer) und dem Bellum Judaicum (Jüdischer Krieg). Ich habe mich dafür entschieden, diesen Gewährsmann sehr oft direkt zu Wort kommen zu lassen, nicht zuletzt um einen unmittelbaren Eindruck von seinem teilweise deutlich polemischen Stil zu vermitteln. Dabei wird aus dem Jüdischen Krieg (= BJ) zumeist nach der Übersetzung von O. Michel und O. Bauernfeind (1959), seltener nach derjenigen von H. Clementz (um 1900, ND 1923, 1959) zitiert, aus den Jüdischen Altertümern (= AJ) nach der Übersetzung von H. Clementz, die hier wie dort der neuen Rechtschreibung angepasst und, sehr selten, auch sprachlich retouchiert wurde. Statt in Anmerkungen sind die Zitate in ihrem unmittelbaren Kontext belegt durch die Angaben der Buch-, Kapitel-, Absatz- sowie Paragraphenzählung.
Eine Bemerkung ist zu den Namensschreibungen vorauszuschicken: Ortsnamen werden in der gebräuchlichen Form der deutschsprachigen Literatur angeführt (z. B. Joppe, Hesbon); einige Festungen in der griechischen Fassung (z. B. Herodeion statt Herodium). Bei Personennamen finden bei bekannten wie Alexander die geläufigen, ansonsten die latinisierten Formen Verwendung (Antigonus, Hyrkanus, Malichus, Philippus); für den Namen Antipatros, den in Herodes’ Familie mehrere Männer trugen, ist die genannte griechische Form für den Sohn der Salome, Herodes’ Neffen, gewählt worden, die eingedeutschte Form Antipater dagegen für Herodes’ Vater und ältesten Sohn. Der häufige hasmonäische Name Aristobulos wird für den Bruder des Hyrkanus in der Form Aristobulus verwendet, für den Sohn der Alexandra, den Enkel jenes Aristobulus, dagegen Aristobul, ebenso wie für den Sohn der Mariamne mit Herodes, den Enkel der Alexandra, mithin Urenkel jenes Aristobulus.
Die beigefügten Stammbäume mögen die Orientierung in der Prosopographie der herodianischen Sippe erleichtern, die auch für Fachleute ein extrem dorniges Feld ist. Hier hat Nikos Kokkinos 1998 mit seinem hilfreichen Buch über die herodianische Dynastie den Durchblick sehr erleichtert, aber auch durch neue Datierungen und genealogische Zuordnungen zahlreiche Diskussionen entfacht. Auch die Autorin dieser Biographie mag nicht jedem dortigen Vorschlag folgen, muss sich aber gemäß der Konzeption der „Gestalten der Antike“ ausführliche Diskussionen dazu in den Anmerkungen ebenso versagen wie zu manchen anderen kontroversen Details. Alle Zeitangaben in diesem Buch beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf die Zeit vor Christi Geburt. Bedauerlicherweise muss mit Blick auf ein weiteres Lesepublikum schließlich die Bibliographie auf thematisch einschlägige Monographien beschränkt werden, obgleich bekanntlich die wissenschaftliche Forschung in Aufsätzen und Beiträgen zu Kongressen vorangetrieben wird.
Die Aufgabe, der ich mich gestellt habe, ist mit der Vorlage dieses Buches abgeschlossen. Es bleiben gemischte Gefühle angesichts des Vielen, was in einer Monographie wie dieser keine Berücksichtigung finden kann; es bleibt aber auch die gute Erfahrung, von vielen Seiten Unterstützung erfahren zu haben.
Daher möchte mich gern bedanken: zuerst sehr herzlich bei Herrn Professor Dr. Dr. Manfred Clauss in Frankfurt für seine Initiative und seine Geduld mit der Autorin; sodann bei der Ruhr-Universität Bochum, die mir im Winter 2003 / 04 ein höchst willkommenes Forschungsfreisemester gewährte; schließlich bei meinem lieben Mann Dr. Wolfgang Günther in München, der mir mit grenzenlosem Verständnis und Zuspruch die Arbeit doch auch zu einem Vergnügen hat werden lassen. Er hat mir mit seiner bewundernswerten Kompetenz in diffizilen philologischen Fragen zur Seite gestanden und die Literaturbeschaffung wesentlich erleichtert. Ohne auch seinen Verzicht auf Freizeit und Urlaub, ohne seine – oftmals stumme – Frage „Wann gehst du wieder an den Herodes?“ wäre dieses Buch wohl noch immer nicht fertig geworden.
Bochum/München, im März 2005
Linda-Marie Günther