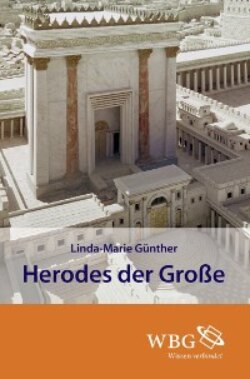Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 6
ОглавлениеVorbemerkung zur Sonderausgabe
Wenn die Sonderausgabe des erstmals 2005 in der Reihe „Gestalten der Antike“ publizierten Buches über den judäischen König Herodes (40 – 4 v. Chr.) erscheint, ist die Weihnachtszeit 2011 bereits vorübergegangen – und damit ein spezifisches saisonales Interesse an den Ereignissen in Judäa zur Zeit der Geburt Christi. Die Weihnachtsgeschichte ist gelesen worden, das Bach’sche Weihnachtsoratorium nach dem Matthäusevangelium ist im öffentlichen Konzert oder auf privatem Tonträger erklungen, und die ‘Heiligen Drei Könige’ hatten um den 6. Januar herum im Aufzug von Kindern, die gegen eine Spende Haustüren mit segensreichen Kürzeln signieren, ihren Auftritt.
Was wäre die Weihnachtsgeschichte ohne den grausamen König Herodes, der von den drei Männern aus dem Orient – eigentlich ja Magiern, frommen Weisen aus Babylonien – überhaupt erst erfuhr, dass ein neuer ‘König der Juden’ geboren sei? Er befahl den Kindermord zu Bethlehem, um das Heranwachsen eines Thronrivalen zu verhindern, und der ‘Unschuldigen Kinder’ gedenkt der katholische Kirchenkalender am 28. Dezember.
Dank himmlischer Intervention wurde indessen Josef gewarnt, die heilige Familie floh nach Ägypten – und die abendländische Kunst erhielt ein weiteres Standardmotiv für den Weihnachtszyklus.
Als meine Biographie über Herodes im Spätherbst 2005 auf den Buchmarkt kam, ließen Reaktionen der interessierten Öffentlichkeit nicht lange auf sich warten, und gerade in der Adventszeit bis nach Weihnachten wurde ich immer wieder um Interviews gebeten. Dabei ging es seitens der Medienvertreter stets um die Frage, wie ich den König beurteile und ob das verbreitete negative Bild berechtigt ist, insbesondere dasjenige vom Kindermassenmörder. Meine Position zu dem letztgenannten Aspekt war und ist sehr knapp: In der anhaltenden Forschungsdiskussion über das Datum der Geburt Jesu halte ich eine Datierung in das erste Jahrzehnt n. Chr. für plausibler als in das von vielen akzeptierte Jahr 6 v. Chr. Diese erklärt sich nämlich allein daraus, dass der angebliche Befehl zum Kindermord alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren erfasst haben soll, sodass man vom gesicherten Todesdatum für Herodes, Frühjahr 4 v. Chr., zwei Jahre zurückrechnet und auf 6 v. Chr. kommt. Abgesehen von den Zweifeln an der Historizität der entsprechenden Details der Weihnachtsevangelien – und generell an einer Auswertung der Evangelien als ‘Primärquellen’ – gibt es unter Althistorikern und auch nicht wenigen Neutestamentlern an den Universitäten weitere Vorbehalte gegen eine Datierung des Heilsgeschehens zu Bethlehem in das Jahr 6 v. Chr. beziehungsweise überhaupt in die Regierungszeit des Herodes.
Eine überaus erstaunliche Breitenwirkung hatte insbesondere ein Interview mit der Katholischen Nachrichtenagentur Bonn, das von verschiedenen Zeitungen aufgegriffen wurde. Dort kamen dann Leserzuschriften in die Redaktionen, die sich etwa auf die Lehrmeinung von Universitätstheologen – oder auch nur auf den Großen Brockhaus – beriefen, um sich den Herodes als Kindermörder nicht nehmen lassen zu müssen. Diese Erfahrung machte auch eine Zeitschrift, die den Agenturtext noch im Dezember 2007 für einen weihnachtlichen Artikel unter der Überschrift „Gerechtigkeit für einen vermeintlichen Bösewicht“ verwendet hatte und dann mir als Autorin des Buches Kopien von Leserbriefen mit der Bitte um Stellungnahme zuschickte. So hieß es gar, wer den Kindermord zu Bethlehem leugne, heiße auch heutigen massenhaften Kindermord durch Abtreibungen gut. Eine andere Kritik stieß sich an einer vermeintlichen Befürwortung der Zerstörung nationaler und kultureller Identität im damaligen Judäa durch die „Multi-Kulti-Bestrebungen“ des Herodes sowie durch die mir unterstellte Absage an ein Selbstbestimmungsrecht des Volkes Israel, das sich damals mehrheitlich gegen den Despoten und die verhasste Besatzungsmacht Rom aufgelehnt habe.
Wie erklärt man einem ignoranten Publikum, dass es in der Geschichtswissenschaft weder um Fragen der Gerechtigkeit noch um moralische Bewertungen historischer Protagonisten geht? – Ist doch das Problem der Moral in der Historie unlösbar.
Selbstredend ist Herodes ein Gewaltherrscher gewesen und hat gewiss mehr als einmal das Recht seiner Zeit missachtet oder gebeugt – sei es bei den Hochverratsprozessen gegen seine Gattin Mariamne und die aus dieser Ehe stammenden beiden Söhne, sei es gegen nicht wenige andere, ebenfalls dem Familienkreis Zugehörigen, die einer Verschwörung verdächtigt wurden. War nicht auch der als ‘Friedensfürst’ gerühmte ‘gute’ Kaiser Augustus als Terrorist und Militärdiktator auf die historische Bühne gekommen?
Im wissenschaftlichen Kontext ist freilich Erklären beziehungsweise Analysieren nicht gleichbedeutend mit Entschuldigen, denn zu entschuldigen oder auch nicht zu entschuldigen hat der Historiker nichts. Dass der Historiker sich generell einer moralischen Be- und Verurteilung zu enthalten hat, gilt indessen auch nicht mehr überall, wie das im Jahr 2007 unter dem Titel King Herod: A Persecuted Persecutor. A Case Study in Psychohistory and Psychobiography erschienene Buch von Aryeh Kasher zeigt. Der Autor hält Herodes für einen Psychopathen von Jugend an, kritisiert die Anwendung von ‘modernen Standards’ der Geschichtswissenschaft auf den König von Judäa, durch welche die traditionelle jüdische Perspektive zu kurz käme, und definiert entsprechende Positionen als counter-history. Wenngleich er fordert, dass nicht ‘anachronistische Aspekte’ zu einer positiven Interpretation der historischen Leistungen des Königs führen dürften, sieht er sich selbst nicht gehindert, für die als megaloman qualifizierte Baupolitik des Herodes Parallelen zu ziehen zu Hitler, Mussolini, Stalin und Saddam Hussein.
Auch andere historische Protagonisten der Antike, die wie beispielweise Caligula und Nero im Verdacht geistiger Krankheit stehen, erscheinen einigen modernen Forschern als Gegenstand einer nüchternen Geschichtsbetrachtung ungeeignet; wird doch der Versuch der Fachwissenschaft, eine überlieferte Aktion in ihrer ratio (oder gar als historiographischen Tyrannentopos) zu verstehen, als Angriff auf Moral- und Humanitätsvorstellungen der Rezipienten aufgefasst.
Auf dem Hintergrund derartiger ‘neuer Moden’ möchte ich der Sonderausgabe meiner Herodes-Biographie eine besonnene und zu eigenen Reflexionsbemühungen bereite Leserschaft wünschen!
Linda-Marie Günther
Bochum, im November 2011