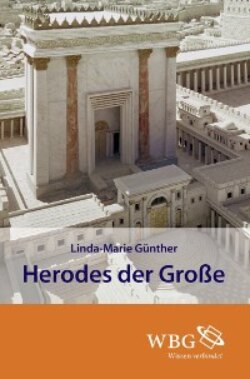Читать книгу Herodes der Große - Linda-Marie Günther - Страница 14
2. Herodes und Hyrkanus – ein latenter Machtkampf
ОглавлениеSeit Caesars Dankesbezeugung war Antipater – genauer: Caius Julius Antipater – Epitropos von Judäa, was seine eminente Stellung neben Hyrkanus unterstrich. Das Wohlwollen des römischen Machthabers gegenüber dem Vasallenregime in Jerusalem zeigte sich zudem in der Erlaubnis, die Stadtmauer, die Pompeius einst hatte schleifen lassen, wieder zu errichten. Man kann annehmen, dass diese Baumaßnahme nicht zuletzt einer verbesserten Verteidigung Jerusalems bei zu erwartenden neuen Aufständen dienen sollte.
Die Entscheidung Caesars, dass jetzt neben dem herkömmlichen Hohepriester und Ethnarchen in Judäa ein von Rom eingesetzter ‘Aufseher’ oder ‘Vormund’ (epitropos) fungierte, stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der gleichzeitigen Revision der Verwaltungsreform, mit der Aulus Gabinius zehn Jahre zuvor eine Dezentralisierung verfügt hatte. Seit 47 unterstanden der Jerusalemer Oberbehörde, dem Sanhedrin, so die aramäisierte Form des griechischen Begriffs synhedrion, wieder direkt die vier anderen Bezirke von Jericho, Amathus, Gadara und Sepphoris. Als Gegengewicht gegen die somit restaurierte Einheit von geistlicher Würde und politischer Verwaltung in der Hand des Hohepriesters und Repräsentanten des Sanhedrin hat Caesar in Judäa den ‘Aufseher’ als einen von Rom bestimmten und folglich auch abhängigen Funktionär etabliert. In dieser Position war Antipater demnach de iure nicht mehr an die Anweisungen des Hyrkanus gebunden, sondern hatte primär der römischen Vormacht gegenüber loyal zu sein. Daher müssen auch seine Entscheidungen – personalpolitische und sonstige – als indirekte römische Anordnungen verstanden werden.6
Diese Überlegungen klären den Rahmen, in dem nunmehr der Konflikt eskalierte zwischen Antipater und Hyrkanus einerseits und der Opposition, die eine Wiederherstellung des hasmonäischen Königtums als Ausdruck staatlicher Unabhängigkeit erhoffte, andererseits. Antipater machte sich kaum Illusionen darüber, dass seine Gegner, die im Sanhedrin vertretene judäische Land- und Priesteraristokratie, weiterhin seinen Sturz betrieben, doch meinte er nun, als Epitropos bessere Möglichkeiten zur Verteidigung seiner Machtstellung haben. So ernannte er seine beiden ältesten Söhne zu militärischen Befehlshabern: den Phasaël für Jerusalem und Umgebung, was Idumäa höchstwahrscheinlich einschloss, den Herodes für Galiläa, wo der etwa fünfundzwanzigjährige Herodes sogleich einen Tatendrang unter Beweis stellte: Er ging im galiläisch-syrischen Grenzgebiet energisch gegen eine „Räuberbande“ vor, die dort zwar ihr Unwesen trieb, sehr vielen Juden freilich als patriotisch-religiöse Eiferer gegen die Fremdherrschaft galten. Zahlreiche Terroristen sowie ihren Anführer Ezechias ließ er nach der Gefangennahme ohne ein Gerichtsverfahren töten. Die Reaktionen darauf waren in Syrien und in Judäa ganz unterschiedlich: Während in der römischen Provinz Dörfer und Städte aufatmeten und Herodes priesen, beschwerten sich bei Hyrkanus vornehme Juden über den Strategen für Galiläa: Seine Eigenmächtigkeit war nach ihrer Ansicht symptomatisch für die usurpatorischen Ambitionen Antipaters und seiner Söhne. Waren Entscheidungen über Todesstrafe und Hinrichtung tatsächlich die vornehmsten Aufgaben des Sanhedrin, so mussten die Aristokraten die Tötung von Juden ohne Verfahren in Jerusalem als mutwillige Anmaßung bewerten. Der Hohepriester lud nun tatsächlich den Herodes vor seinen Gerichtshof; der Angeklagte folgte der Aufforderung, kam in Begleitung einer Leibwache nach Jerusalem – und verließ wenig später die Stadt als freier Mann.
Den Verlauf des Prozesses schildert Flavius Josephus in seinen Jüdischen Altertümern (14,9,4 – 5 / 169 – 179) in vielen Details ausführlicher und anders als in der Geschichte des Jüdischen Krieges (1,10,7 / 211f.), doch geht die Forschung davon aus, dass Herodes nicht aufgrund eines Freispruches wieder abreiste, sondern eine – von Hyrkanus in dieser Absicht arrangierte – Verhandlungspause zur Flucht nutzte. Unstrittig ist, dass der Ausgang des Verfahrens mit einer Intervention des römischen Statthalters in Syrien zu tun hatte; das war damals ein Großcousin des Caius Julius Caesar namens Sextus Julius Caesar. Dieser soll in einem Schreiben an Hyrkanus für den Fall einer Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes Konsequenzen von römischer Seite angedroht und dabei nach der einen Lesart einen Freispruch, nach der anderen die Aufhebung der Mordanklage gefordert haben. Unser Gewährsmann lässt freilich unerwähnt, dass Herodes damals – durch das Geschenk des Bürgerrechts an seinen Vater – römischer Bürger war und dass er daher als Caius Julius Herodes einen Prozess vor einer römischen Appellationsinstanz verlangen konnte.
In diesem Zusammenhang ist ein Detail von Herodes’ Auftritt in Jerusalem aufschlussreich: Nach Flavius Josephus kam er auf Anraten seines Vaters Antipater „nicht nach der Art eines Privatmannes, sondern mit einer Leibwache“, so dass ihm während des Prozesses einer der Ratsherren sein selbstbewusstes Auftreten vorhielt: „Herodes … steht da in Purpur, mit geschniegeltem Haupthaar“ (AJ 14,9,4 / 169. 172 – 174) – Herodes war offenbar in einer Art römischer Amtstracht erschienen!
Nach seiner Abreise oder Flucht aus Jerusalem wandte sich Herodes tatsächlich zunächst an Sextus Julius Caesar, den er in Damaskus traf. Dieser nahm ihn sofort als Strategen für Koilesyrien in römische Dienste, also für die südsyrische Küstenzone mit den nichtjüdischen Städten, die seit Pompeius’ Neuordnung der direkten römischen Herrschaft unterstanden.
Damit hatte Herodes einen entscheidenden Schritt getan: Er hatte nicht nur dank der römischen Protektion den judäischen Autoritäten seine Unantastbarkeit vorgeführt, sondern war jetzt auch aus dem Schatten seines hochangesehenen Vaters, der ihn in Galiläa eingesetzt hatte, herausgetreten. Zugleich sahen die römischen Machthaber in ihm und in Antipater Garanten für die Aufrechterhaltung des Vasallenregimes in Judäa. Einerseits hatte Herodes mit seinem Vorgehen gegen die Terroristen im galiläisch-syrischen Gebiet seine entschiedene Haltung zur Abwehr patriotisch-religiöser Bewegungen frommer Juden bewiesen und sich deren Anhänger zu erbitterten Feinden gemacht. Andererseits konnte die militärische Kompetenz des neuen Bezirksstrategen für Koilesyrien der römischen Provinz gerade dort nützlich werden, wo von Seiten eines revisionistischen Hasmonäer-Regimes in Judäa Rückeroberungen zu befürchten sein müssten.
Flavius Josephus merkt an, Herodes habe sich das Strategenamt von Sextus Julius Caesar erkauft. Allerdings ist hier nicht allein an platte Bestechung zu denken. Vielmehr dürfte Herodes sich dem Statthalter als seinem Retter aus dem Jerusalemer Prozess erkenntlich gezeigt und zugleich auf seine künftige Loyalität und die besondere Gefährung Südsyriens durch die hasmonäischen Gegner hingewiesen haben.
Bald nach der neuen Bestallung soll Herodes mit einem Heer gegen Jerusalem vorgerückt sein, um sich an Hyrkanus für die Vorladung vor den Sanhedrin zu rächen, ja um den Hohepriester abzusetzen, doch habe ihn sein Vater Antipater zu beschwichtigen und zur Umkehr zu bewegen vermocht; „(Herodes) hielt seine Zukunftspläne schon hinreichend dadurch gefördert, dass er dem Volke wenigstens seine Macht gezeigt habe“ (AJ 14,9,5 / 184).
Für eine Beurteilung des jungen, ambitionierten und tatendurstigen Herodes sind die skizzierten Ereignisse des Jahres 47 / 46 interessant. Wie, so müsste man fragen, hat sich Antipaters Sohn eigentlich die eigene unmittelbare politische Zukunft vorgestellt, wie zumal die Reaktion der Römer auf eine derartige grundlegende Änderung der kurz zuvor von Caesar bekräftigten Ordnung in Judäa?
Es liegt nahe, den unerhörten Angriffsplan des Herodes für eine Erfindung der antiken Geschichtsschreibung zu halten: Die fingierte Episode hat primär den Zweck, den Hyrkanus als einen der Familie Antipaters wohlwollenden und allenfalls von anderen Beratern schlecht unterrichteten Mann darzustellen, den Herodes dagegen als ebenso hitzköpfig wie rach- und ruhmsüchtig zu charakterisieren. Mit seinem ‘Marsch auf Jerusalem’ ist er geradezu ein judäischer Sulla oder Caesar, der um seines Ehrgeizes willen einen Bürgerkrieg nicht scheut.
In den folgenden Jahren kam es in Syrien und Judäa tatsächlich zu neuen bürgerkriegsartigen Wirren, deren Ursachen zum einen in der inneren Situation der Region selbst, zum anderen in den Ereignissen in Rom lagen.
Caesar war zwar nach seiner Abreise aus Syrien im Jahre 47 triumphierend nach Rom zurückgekehrt, der Machtkampf mit den Pompeianern ging aber noch bis zum Sieg bei Munda in Südspanien (45) weiter; als der Krieg in Nordafrika geführt wurde, entflammten auch wieder Rivalitäten in Syrien. Dort bewirkte der Pompeianer Caecilius Bassus Unruhe unter den römischen Truppen, in deren Verlauf der Statthalter Sextus Julius Caesar ermordet wurde, und verschanzte sich dann mit den Rebellen in Apameia. Da diese Stadt im nördlichen Phönizien am Oberlauf des Orontes strategisch günstig gelegen war, konnte er relativ ungefährdet sogar vom Partherkönig Hilfe erhalten. Zur Unterstützung der Truppen, die Caesar treu ergeben waren und welche die Stadt belagerten, schickte Antipater ein Aufgebot unter dem Kommando seines Sohnes Herodes. An der insgesamt über längere Zeit ganz unklaren Situation änderte auch Anfang 44 der neue Statthalter Statius Murcus nichts. Dann jedoch wurde in Rom Caesar ermordet, und nun kam Cassius Longinus, einer der Verschwörer, unverzüglich nach Syrien. Er hatte rund zehn Jahre zuvor nach der katastrophalen Niederlage des Licinius Crassus die Provinz vor dem Einfall der Parther bewahrt, jetzt vereinigte er unter seinem Kommando die zerstrittenen römischen Truppen, die Belagerung Apameias wurde aufgehoben.
Cassius zögerte nicht, den Herodes als Bezirksstrategen Koilesyriens zu bestätigen, er ließ auch keinen Zweifel an der fortgesetzten Funktion Antipaters als Epitropos in Judäa. Für seine Rüstungen gegen die Caesarianer Marcus Antonius und Octavian benötigte er nämlich sehr rasch sehr viel Geld, das ihm die genannten und bisher sehr zuverlässigen Mitarbeiter besser als sonst jemand besorgen konnten – allein aus Judäa forderte der Römer knapp 20 Tonnen (700 Talente) Silber!
Antipater, zuständig für die Einziehung dieses Tributs, delegierte die unangenehme Aufgabe an seinen Sohn Herodes und einen gewissen Malchus, einen Söldnerführer möglicherweise arabisch-nabatäischer Herkunft. Dieser Mann, der einst (56) im Auftrag des Hyrkanus gemeinsam mit Antipater die Truppen des Aulus Gabinius gegen den Prätendenten Alexander unterstützt hatte, war inzwischen ein einflussreicher Vertrauter des Hyrkanus geworden, stellte sich allerdings bei seinem neuen Auftrag gegen die römischen Anweisungen. Mit zahlreichen Offizieren trat er an die Seite der protestierenden Bevölkerung, die nach einer Beseitigung der romhörigen Machthaber verlangte, und entging dann Cassius’ Zorn nur dank der Fürsprache Antipaters. Als dieser schließlich erkannte, dass Malchus’ Ambitionen darauf gerichtet waren, im Zuge der allgemeinen Unzufriedenheit ihn selbst bei Hyrkanus zu verleumden, warb er für einen bevorstehenden Machtkampf nabatäische Truppen an. Doch söhnte er sich mit dem bittflehenden Intriganten überraschend aus und nahm ihn sogar ein zweites Mal bei Cassius vor dem offenbar doch sehr berechtigten Vorwurf der romfeindlichen Konspiration in Schutz.
Wie verhielt sich indessen Hyrkanus, der Hohepriester und Ethnarch? Er war in der damaligen äußerst angespannten Situation allem Anschein nach bereit, dem allgemeinen Missbehagen an der willfährigen Haltung seines Regimes gegenüber Cassius und Rom allgemein ein Bauernopfer in Gestalt ausgerechnet des Antipater zu bringen. Dabei glaubte er wohl, den Mann, der durch seine Fähigkeiten einerseits, seine unbedingte Loyalität andererseits ihm die Herrschaft seit rund zwanzig Jahren gesichert hatte, durch einen anderen, zumal einen weniger romtreuen, ersetzen zu können. Kurze Zeit nach jener Aussöhnung, als Cassius zu einem Feldzug gegen einen caesarianischen Konkurrenten, den von Antonius zum Statthalter Syriens ernannten Cornelius Dolabella, aufgebrochen war, wurde Antipater heimtückisch ermordet. Malchus war der Drahtzieher, doch ist umstritten, ob Hyrkanus in das Komplott eingeweiht war.
Für die exponierten Söhne des getöteten Epitropos und Romfreundes empfahl es sich in der aktuellen Situation, mit einer Racheaktion bis zur Rückkehr des Cassius zu warten; jedenfalls soll der besonnenere Phasaël seinen Bruder in diesem Sinne beschwichtigt haben. Es war dann für Herodes ein Leichtes, dem Cassius die Schuld des Malchus darzulegen und einen Anschlag auf den Mordanstifter zu planen; Malchus wurde bei Tyros von römischen Soldaten getötet.
In Jerusalem brachen daraufhin Krawalle aus, deren Phasaël und Herodes nur mühsam Herr wurden. Ein Bruder des Malchus besetzte hasmonäische Bergfestungen, darunter auch Masada am Westufer des Toten Meeres – auch hierfür dürfte er das zumindest stillschweigende Einverständnis des Hyrkanus gehabt haben. Indessen musste Cassius eine militärische Konfrontation mit den Caesarianern gewärtigen und erneut Syrien verlassen – er sollte dann im Oktober des Jahres 42 in der Entscheidungsschlacht bei Philippi sein Leben verlieren.
Im Sommer 42 hatte die vielschichtige Situation in Judäa ein höchstes Maß an Verwirrung, Machtvakuum und Isolierung der einzelnen Protagonisten erreicht: Hyrkanus setzte nicht mehr auf die Antipater-Söhne; Herodes und Phasaël waren ohne Cassius angreifbarer als je zuvor; die Bewegung, an deren Spitze Malchus gestanden hatte, war allerdings führerlos geworden und ganz vom Wohlwollen des Hohepriesters abhängig. Für einen Beobachter, der darauf wartete, dass Judäa reif für das Auftreten eines ‘Retters’ würde, war dies der rechte Moment.
Einen solchen Beobachter gab es – und er handelte auch entsprechend zielgerichtet: Antigonus, der jüngere Sohn des ehemaligen Königs Aristobulus. Er lebte bei dem Kleinfürsten Ptolemaios Mennaei von Chalkis am Libanon-Gebirge, der mit seiner Schwester Alexandra verheiratet war, und hatte zuletzt im Jahr 47 in Antiocheia versucht, Julius Caesar von seinen Thronrechten und von der Unzuverlässigkeit des Antipater zu überzeugen. Jetzt also erschien Antigonus in Galiläa, wo die Hasmonäer traditionell mit sehr großer Akzeptanz rechnen konnten, und besetzte einige Städte. Zudem verbündete er sich mit zwei Männern, die eigentlich dem Cassius verpflichtet waren, nämlich mit Marion, dem in Tyros eingesetzten Dynasten, und Fabius, dem römischen Kommandeur von Damaskus. Dass er damals bereits Kontakte zu Labienus hatte, der wie zahlreiche andere Anhänger des Cassius dann nach dem Sieg des Marcus Antonius nach Ktesiphon an den Hof des Partherkönigs floh, ist sehr wohl denkbar. Zu vermuten ist auch, dass die Pompeianer um Caecilius Bassus, die bereits während des Kampfes um Apameia Beziehungen zu den Parthern geknüpft hatten, damals auch schon in Verbindung mit dem Fürsten von Chalkis und dem bei jenem im Exil lebenden hasmonäischen Prinzen gestanden hatten.
Antigonus, der in kurzer Zeit Teile Galiläas erobert hatte, konnte sich innerhalb Judäas auf alle diejenigen Kräfte stützen, die das Hyrkanus-Regime stürzen wollten und damit zugleich das Ende der römischen Vormacht herbeiwünschten. Der Hohepriester in Jerusalem, der einige Monate zuvor selbst gehofft haben mochte, sich der Präponderanz des Antipater durch seinen Vertrauten Malchus entziehen zu können, erkannte seine Abhängigkeit von der Tatkraft und dem Tatwillen des Herodes, der ja seit rund fünf Jahren der militärische Verwalter Galiläas war. Herodes zog indessen mit seinem Söldnerheer gegen Antigonus und seine Freunde, nachdem er zuvor im Süden Judäas vom Bruder des Malchus die strategisch wichtigen Festungen zurückgewonnen hatte, darunter auch die Berganlage von Masada. In Galiläa gewann er nicht nur die vor allem vom tyrischen Machthaber eingenommenen Festungen zurück, sondern besiegte in mehreren militärischen Begegnungen Antigonus, der nun wieder über die Grenze abzog; begeistert wurde er in Jerusalem von den Freunden des Hyrkanus und jenem selbst empfangen.
Der Hohepriester und Ethnarch war damit zwar durch seinen idumäischen ‘Haudegen’ erfreulich rasch von einer unerwarteten Gefahr befreit worden, doch dürfte er sich keine Illusionen darüber gemacht haben, dass die Bevölkerung Galiläas seine Herrschaft gerade wegen der faktischen Dominanz zuerst des Antipater, jetzt seiner Söhne wenig liebten. Und er wusste auch, dass die meisten Juden ebenso dachten und für sie jener Antigonus eine personelle Alternative zu Hyrkanus war. Hingegen gab es evidenterweise für den – genau genommen seit drei Generationen – effizienten Idumäer-Clan keinen Ersatz. Hyrkanus mochte fürchten, dass sich eines Tages Antigonus mit Phasaël und Herodes arrangieren könnte – notfalls unter römischem Druck und jedenfalls auf seine Kosten. Daher entschloss er sich, Herodes als den Stützpfeiler seiner Herrschaft näher als bisher an sich zu binden, nämlich in seine Familie aufzunehmen: Er trug ihm die Hand seiner Enkelin an, der damals etwa elfjährigen Mariamne. Sie lebte mit ihrer Mutter, Hyrkanus’ Tochter Alexandra, am hasmonäischen Hof in Jerusalem, seit ihr Vater Alexander, Hyrkanus’ Neffe, im Jahr 49 unter dem syrischen Statthalter Cornelius Metellus hingerichtet worden war. Herodes willigte ein, obgleich er eine Gattin namens Doris hatte und auch bereits einen Sohn von ihr, der nach seinem Großvater Antipater hieß.
In der Forschung sind angesichts dieser dynastischen Verbindung verschiedene Fragen gestellt worden, die auf den ersten Blick nicht zusammenhängen7: Was bedeutete die Verlobung für Herodes’ politische Zukunft? „Was mag wohl den Herodes dazu bewogen haben, in die Hasmonäerfamilie einzutreten?“ Warum machte Hyrkanus sein Angebot nicht dem Phasaël, dem älteren Antipater-Sohn? Aus den jeweiligen Antworten lassen sich gewisse Vorurteile gegenüber den Hauptakteuren ablesen. Auffällig ist dabei, dass Herodes als ehrgeizig und skrupellos angesehen wird, Hyrkanus als hilflos-passiv, nahezu ohne eigenen Willen. So soll die Verlobung mit der Hasmonäerin Mariamne ein „kluger Schachzug“ des Herodes gewesen sein; Hyrkanus hätte zugestimmt, um die Herrschaft seiner Familie zu sichern. Strebte nun Herodes selbst nach der ‘Königskrone’ oder nicht? Welchen Stellenwert hatte eine künftige hasmonäische Gattin für Herodes? Wäre er ungebunden ohne Verlobung eine veritable Gefahr für Hyrkanus gewesen?
Offenbar war die Verlobung der Mariamne mit Herodes eine politische Initiative des Hyrkanus und resultierte aus der jüngsten Bedrohung durch den Neffen Antigonus. Wollte der Hohepriester sich gegen eine erneute Aktion des Thronrivalen wappnen, musste er Herodes als den militärischen Machthaber in Galiläa an sich binden; an der Zuverlässigkeit Phasaëls, des Strategen von Jerusalem und Umgebung, gab es offenbar keine Zweifel. Aus den Berichten bei Flavius Josephus geht nicht mit hinreichender Deutlichkeit hervor, inwieweit die beiden Brüder in politischen Fragen differierten oder sich nur in ihrer Impulsivität voneinander unterschieden. Dass Phasaël den Herodes des Öfteren besänftigt und von unüberlegten Handlungen abgehalten hatte, verweist möglicherweise auf abweichende Zielvorstellungen des jüngeren Antipater-Sohnes. Dass in diesem Sinne Herodes allerdings bereits mit dem Gedanken gespielt haben sollte, sich selbst an die Stelle des Ethnarchen zu setzen und zu diesem Zweck den Hasmonäer Antigonus als neuen Hohepriester zu favorisieren, ist höchst unwahrscheinlich, wusste er doch nur zu gut, dass Antigonus, der Sohn des ehemaligen Königs Aristobulus, nichts Geringeres als die Restauration der hasmonäischen Königsherrschaft anstrebte. Welche Perspektiven eröffnete ihm also dann die Verlobung mit Mariamne? Eine Antwort liegt in der Absicht des Herodes, wie einst sein Vater Antipater der entscheidende Mann neben oder gar über dem Hohepriester zu sein, selbstverständlich mit der nötigen Akzeptanz durch Rom. Dazu musste er die Widerstände gegen sich und seinen idumäischen Clan systematisch verringern, musste rivalisierende respektive potentielle Machtzentren ausschalten, nämlich die hasmonäische Dynastie als Regenten einerseits, den Einfluss der frommen Juden und der Priesteraristokratie im Sanhedrin andererseits. Da Hyrkanus keinen Sohn hatte, sondern nur einen Enkel, Mariamnes (jüngeren?) Bruder Aristobul, lag es nahe, dass sein Neffe Antigonus sein Nachfolger würde. Ebenso stand zu erwarten, dass jener in eine dynastische Verbindung mit der Familie seines Onkels eintreten würde – ähnlich wie sein Bruder Alexander, der im Jahre 57 seine Cousine Alexandra geheiratet hatte. Indem Herodes mit Mariamne das einzige Mädchen, das für eine solche Aussöhnung der seit rund 25 Jahren zerstrittenen Herrscherfamilie zur Verfügung stand, zur Ehe erhielt, verhinderte er eine vergleichbare hasmonäische Konsolidierung.
Die Frage, ob Hyrkanus durch die Verlobung der Mariamne mit Herodes die Zukunft seines Enkels sicherte oder ob er nicht doch eher dessen nichthasmonäischem Schwager den Weg zum Thron ebnete, stellte sich damals, im Herbst 42, so gerade nicht. Für Hyrkanus wäre die Alternative eine Heirat der Mariamne mit Antigonus gewesen, doch dies hätte wenn nicht schon für ihn selbst dann für Aristobul den Ausschluss von Hohepriester- und Herrscherwürde bedeutet.
Wenn Herodes damals schon die Absicht gehabt haben sollte, künftig einem Hasmonäer nur noch das Hohepriesteramt zu überlassen, so dürfte Hyrkanus um diese Ambition nicht gewusst haben; aber selbst wenn er dieses Risiko gesehen hätte, wäre es im Vergleich zu einer künftigen Königsherrschaft des Antigonus das kleinere Übel gewesen. Kurz: Hyrkanus sicherte mit der Verlobung seine eigene Herrschaft und die künftige seines Enkels; Herodes signalisierte als künftiger Gatte der Mariamne nicht die eigene Ambition auf den Königstitel, sondern allenfalls die Absicht, profane und religiöse Herrschaft in Judäa dauerhaft zu trennen und selbst „Ethnarch“ zu werden.
Somit war ein drohender innerjudäischer Bürgerkrieg beigelegt; im Herbst desselben Jahres endete der Kampf der Caesarianer gegen die Caesarmörder auf dem Schlachtfeld bei Philippi mit der Niederlage von Brutus und Cassius. Während der eine Sieger, der junge Caesar, bekannt unter dem inoffiziellen Namen Octavian, nach Italien zurückkehrte, wandte sich der andere, Marcus Antonius, nach Kleinasien und Syrien, um hier das Erbe seines Gegners Cassius anzutreten. Schon in Bithynien traf er auf eine jüdische Gesandtschaft, die sich bitter über die beiden Antipater-Söhne beschwerte; Herodes persönlich kam zu seiner Verteidigung hinzu, die ihm dadurch erleichtert wurde, dass Antonius für den Sohn seines alten Gastfreundes aus den gemeinsamen Kämpfen unter Aulus Gabinius gegen den Hasmonäerprinzen Alexander viel Sympathie hegte. Über Ephesos, die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, wo ihm unter anderen eine Gesandtschaft des Hyrkanus und des judäischen Volkes mit einem wertvollen Goldkranz huldigten, und über Tarsos in Kilikien, wo er seine berühmt-berüchtigte Liaison mit Kleopatra VII. begann, kam der neue Machthaber im Herbst 41 in die ehemalige Seleukidenresidenz Antiocheia. Dort bemühten sich wiederum vornehme Juden, diesmal in einer sehr großen Gesandtschaft von 100 Personen, ihren Beschwerden über Herodes und Phasaël Gehör zu verschaffen – möglicherweise in der Hoffnung auf Unterstützung durch die ptolemäische Königin. Diesmal war Hyrkanus persönlich anwesend und musste zu den Vorwürfen Stellung nehmen. „Nachdem Antonius in Daphne beide Parteien angehört hatte, fragte er Hyrkanus, welche von beiden das Volk besser zu regieren verstehe. Und als dieser entgegnete, Herodes und seine Verwandten, ernannte Marcus Antonius … die beiden Brüder zu Tetrarchen (und) übertrug ihnen in verbriefter Form die Verwaltung von Judäa“ (AJ 14,13,1 / 325 f.). Im gleichen Zusammenhang erfahren wir bei Flavius Josephus, dass Antonius fünfzehn persönliche Gegner des von ihm soeben bestätigten, ja aufgewerteten Hyrkanus-Regimes auf der Stelle verhaften ließ; dass sie nicht sogleich hingerichtet wurden, verdankten sie dann nur der Fürsprache des Herodes.
Was genau die Machtbefugnisse der neuen Tetrarchen Herodes und Phasaël waren und in welchem Verhältnis diese zur Herrschaft des Ethnarchen standen, ist ungeklärt. Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass de facto die Positionen der beiden Antipater-Söhne gestärkt, die Kompetenzen des Hyrkanus dagegen auf Repräsentanz und die religiösen Aufgaben konzentriert wurden.
Nachdem die judäische Aristokratie wiederholt versucht hatte, der römischen Vormacht die für sie unerträgliche Machtfülle gerade jener beiden Männer klarzumachen, stand nicht zu erwarten, dass es angesichts der demonstrativen Unterstützung der Römer für Herodes und Phasaël im Lande ruhig bleiben würde. Vielmehr wurde die römische Herrschaft durch diese neue unbedingte Förderung des Antipater-Clans zusätzlich diskreditiert.
Das letzte Öl goss der Römer ins Feuer, als er einen Massenprotest von 1000 Juden, die ihn in Tyros erwarteten, von seinen Soldaten blutig auflösen ließ. Zwar sollen Herodes und Hyrkanus kurz zuvor die aufgebrachte Menge gewarnt und zur Beendigung ihrer Aktion aufgefordert haben, doch wurden sie nicht ernst genommen. Als es infolge dieses Massakers in Judäa zu weiteren Protesten gegen Herodes kam, ließ Marcus Antonius die Gefangenen hinrichten, die er seit der Erhebung der Antipater-Söhne zu Tetrarchen als deren Gegner in seinem Gewahrsam hielt. Dann reiste er mit Kleopatra nach Alexandria, wo er den Winter 41 auf 40 verbrachte.
In Judäa stand als Konsequenz der Eskalation ein neuer Bürgerkrieg bevor; es konnte auch nicht zweifelhaft sein, wer das Volk in seinem Begehren nach Abschüttelung der Gewalt- und Fremdherrschaft unterstützen würde: der Hasmonäer Antigonus und die Parther.